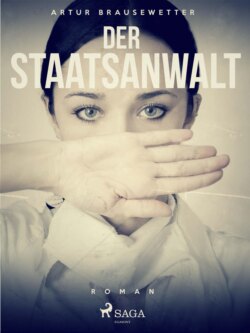Читать книгу Der Staatsanwalt - Artur Brausewetter - Страница 7
ОглавлениеGrosse Aufregung herrscht in der Pension Falke.
Die Freifrau von Türck hat sich verlobt, endlich wirklich verlobt — natürlich mit dem blonden Rittmeister der Husaren.
Einigen näheren Bekannten war die freudige Nachricht schon in der Frühe des Morgens mitgeteilt, die anderen sollten sie bei der gemeinsamen Tafel erfahren — als Ueberraschung.
Pünktlicher als sonst ist alles versammelt, gespannte Erwartung liegt auf den Gesichtern, jeder Platz ist besetzt, nur ein Stuhl ist noch leer: der für die Freifrau von Türck.
Der Wirt, der in das Geheimnis eingeweiht ist und schon mehrere Flaschen Sekt auf Eis gelegt hat, lässt rücksichtsvoll mit dem Auftun der Suppe warten — fünf Minuten — zehn Minuten — eine Viertelstunde. Die Unterhaltung wird einsilbiger, nur Fragen werden hier und da laut, welch einen Grund wohl das lange Ausbleiben der jungen Braut haben könne.
Die Suppe ist aufgetan, man beginnt zu essen. Der zweite Gang wird gereicht — noch immer ist der eine Stuhl leer.
Der Wirt weiss ganz genau, dass die gnädige Frau bereits seit zwei Stunden auf ihrem Zimmer ist, auch die bedienenden Mädchen haben sie gesehen. Er will eben eine von ihnen hinaufschicken, da tritt sie ein.
Auf den Lippen liegt das gewohnte Lächeln, aber nicht in jener herausfordernden Gefallsucht wie sonst, ein gezwungener, fast verzerrter Zug lagert sich um die zuckenden Mundwinkel, die schönen blonden Haare sind sorgsam frisiert wie immer, auf der Brust liegt sogar ein leicht gebundener Strauss üppiger dunkler Rosen. Aber das Antlitz über diesem Strauss ist so bleich und regungslos, so ernst blicken die sonst stets lachenden Augen, und alle Kunstaufwendung, sie zur gewohnten Fröhlichkeit zu zwingen, ist vergeblich.
Was ist geschehen?
Keiner fragt es. Stille herrscht im Saal, unterbrochen nur vom Klappern der Teller, die die Mädchen wechseln, saumseliger als gewöhnlich.
Die junge Frau hat sich gesetzt. Sie gibt sich den Anschein, als ob sie eifrig esse, aber sie berührt die Speisen kaum. Sie beginnt eine lebhafte Unterhaltung, aber sie spricht ziemlich allein; es hat auch nicht viel Sinn und Verstand, was sie sagt.
Die Tafel ist beendet, der Sekt ist vergeblich kaltgestellt, schneller als sonst erhebt man sich.
Nach dem Essen pflegt sich eine kleinere Gesellschaft, die sich enger zusammengeschlossen hatte, in einer kleinen Laube im Garten zusammenzufinden und dort gemeinsam Kaffee zu trinken.
Der Justizrat hat das Verdienst, diese gemütliche Plauderstunde eingeführt zu haben.
Als wäre nichts geschehen, waltet Frau von Türck ihres Amtes, die Tassen zu füllen. Nur erscheint ihr Antlitz hier in der freien Luft noch bleicher als vorher im Esssaal.
Der Justizrat hat die Frage gewagt — sie brauche ja nicht zu antworten, wenn sie nicht wolle.
„Warum nicht?“ erwidert sie nach kurzer Pause. „Ihnen als alten Freunden, und ich nehme keinen aus von allen, die in dieser stillen Laube versammelt sind, will ich gerne Rede stehen.“
Mit einem schnellen, aber vielsagenden Blick hat sie dabei Gerda und Bolkow gestreift; mit dem Instinkt, der Frauen ihrer Art eigen ist, hat sie längst gefühlt, dass sie beiden von Herzen unangenehm ist.
„Es ist Ihnen allen kein Geheimnis mehr, dass ich mich gestern abend verlobt habe. Ich danke Ihnen sehr, danke herzlich, mein liebes Fräulein ... Nun, Herr Staatsanwalt, Ihr Glückwunsch kommt zwar so düster heraus wie eine Beileidsbezeigung, gleich als ahnten Sie in Ihrem hellsehenden Geiste, dass die Sache für mich noch ein sehr ernstes Nachspiel haben sollte. Und Sie haben ganz recht — hören Sie nur weiter.“
Sie hat einen Versuch gemacht, in den leicht tändelnden Ton zu fallen, mit dem sie auch das Ernsteste zu behandeln pflegt, und der Gerda unangenehmer ist als ihre auffallende Erscheinung und ihr gefallsüchtiges Gebaren.
Doch dieses Mal missglückt der Versuch; schwerfällig und stockend ringen sich die Worte von den müden Lippen.
„Als mein Bräutigam sich gestern mit mir verlobte, stellte er mir eine Bedingung. Du meine Güte, wer wollte sie ihm verdenken? Er ist noch jung und verkehrt in den ersten Kreisen, wo man sehr peinlich ist und alles Ungewöhnliche und gar Abstossende ... kurz, er verlangt, dass ich den Jungen — Sie kennen ihn ja, den armen Kerl, den einzigen Sohn meines seligen Mannes, der mit einer nahen Verwandten verheiratet war —, dass ich den also ein für allemal aus dem Hause gebe.“
„Allerdings eine schwere Bedingung für Sie.“
„Gewiss, sie kam mir zuerst auch hart vor, aber ich liess die Vernunft walten und musste meinem Verlobten recht geben. Der arme Junge! Ihm ist es ja auch ziemlich gleichgültig, wo er ist. Ich entschloss mich also und stimmte ihm zu.“
Eine Pause. Die mit vielen Ringen geschmückte Hand nestelt nervös an dem Spitzenumhang des grünseidenen Kleides.
„Nun denken Sie an. Ich lasse Annemarie — Sie wissen, Alfreds Pflegerin — auf mein Zimmer bitten und teile ihr meinen Entschluss mit. Und was geschieht? Sie können sich keinen Begriff machen, was ich erlebte, wie ausser sich die Person gerät, als ich ihr diese Eröffnung mache. O, Sie kennen sie nicht, wie ich sie kenne. Sie ahnen nicht, welch eine Leidenschaft und Wildheit sich hinter dieser sanften Maske versteckt; ich sage Ihnen, es gibt Fälle, in denen sie zu allem entschlossen wäre. Sie geht so weit, mir ins Antlitz zu sagen, dass sie glaube, gewisse heilige Rechte auf den Jungen zu besitzen, die man nicht eines Tages so ohne weiteres durch eine Kündigung über den Haufen werfen könne. Und dabei brennt und funkelt es in ihren Feueraugen, dass mir ordentlich unheimlich zumute wird und ich meinem Gotte danke, als ich endlich heil zur Tafel hinunterkomme.“
Sie hält inne, als erwarte sie ein zustimmendes Wort. Keiner spricht es.
„Eins ist mir jetzt zur Gewissheit geworden. Alfred muss von dieser Person loskommen. Sie verweichlicht und verwöhnt ihn auf unverantwortliche Weise.“
„Was gedenken Sie mit dem armen Jungen denn zu tun?“ fragt endlich Frau Niebert.
„Ich habe bereits an seinen Vormund, meinen Schwager Berg in Berlin, geschrieben. Wenn er auf meinen Vorschlag eingeht, so gebe ich ihn in eine gute Anstalt. Aber davon darf sie nichts wissen — um Gottes willen nicht, meine Herrschaften. Sie hat einen Hass auf diese Anstalten wie alle halbgebildeten Leute, besonders seitdem sie in der einen ein Jahr lang als Wärterin gewesen ist. Nun, was ich später tue, geht sie ja auch nichts mehr an, dann möchten ihre „Rechte“ wohl endlich verlöscht sein! Eine bezahlte Pflegerin — und heilige Rechte! Was sagen Sie nur dazu?“
„Dass sie recht hat.“
Gerda hat es ganz ruhig, aber auch ganz bestimmt gesagt. Bolkow lächelt ihr zustimmend zu.
„Sie vergessen vielleicht, Frau von Türck,“ wendet er sich dann in seiner ernst-kühlen Art an die Freifrau, „dass die Aufopferung dieser Person für Ihr krankes Kind, die schweren Dienste, die sie unermüdlich tut, dass die allerdings Rechte verleihen. Doch verzeihen Sie, dass ich Ihnen, zwecklos genug, eine Meinung aufdränge, die Sie nicht teilen, vielleicht nicht einmal verstehen können. — Sie hatten bereits nach dem Essen Lust zu einer kleinen Strandwanderung, gnädiges Fräulein,“ wendet er sich dann zu Gerda. „Wenn es Ihnen recht ist, machen wir sie jetzt zusammen.“