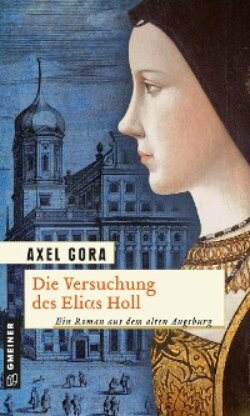Читать книгу Die Versuchung des Elias Holl - Axel Gora - Страница 11
3
ОглавлениеZum elften Mal überpinselte Matthias den Vorhang des Freskos – eine Replik Raffaello Santis Sixtinischer Madonna –, das er auf die Westwand seines Ateliers übertragen hatte. Nur diese Wand war für das Kunstwerk der geeignete Ort, selbst wenn er dafür den Kamin hatte verlegen müssen. Die Westwand wurde an klaren Morgen von der Sonne durch die beiden großen gegenüberliegenden Fenster so kraftvoll beschienen, dass dies dem Gemälde eine noch gewaltigere Dominanz verlieh. Ursprünglich hätte er das Fresko schon letzten Monat vollendet haben wollen; sein klerikaler Förderer Matthäus Rader, wie dessen Vertrauter Caspar Scioppius und ein holländischer Gelehrter namens Corvin van Cron, den sie als Begleitung angekündigt hatten, brannten darauf, es endlich in Augenschein nehmen zu dürfen. Sie hatten aber auch Verständnis gezeigt dafür, dass er es ihnen nicht präsentieren mochte, bevor er nicht selbst vollständig damit zufrieden wäre. Ende Februar, hatte er ihnen versichert, dürften sie exklusiv zur Enthüllung erscheinen. Er war schon eine Woche überfällig. Die Einladung lag geschrieben auf dem Tisch, nur das genaue Datum fehlte noch:
… möchte ich hochlöblichen Herrschaften, den ehrwürdigen lieben Pater Matthäus Rader, Professor am Sankt Salvator Kollegium, den Philologen Caspar Scioppius und den Doktor der Theologie und Astronomie Corvin van Cron, gegenwärtig Gastdozent an der Theologischen Fakultät der Universität Dillingen, zur Enthüllung des Freskos Die Sixtinische Madonna am … in meinem Atelier des Domkapitels Auf unser Frauen Graben zwischen Dom und Frauentor gelegen, mit diesem Schreiben meine Einladung aussprechen.
Für leibliches Wohl an Speis und Trank ist gesorgt.
Mit hochachtungsvollem Gruß
Johann Matthias Kager, Kunst- und Freskenmaler in Augsburg
Augsburg, den 12. Februar 1614 AD
Matthias hatte sich ganz bewusst für eine Replik dieses Bildes und dieses namhaften welschen Meisters entschieden, nicht weil er sich von möglichen Assoziationen an seine ehemaligen Lehrer am Bayrischen Herzogshof Friedrich Sustris, Peter Candid und Hans Rottenhammer zu distanzieren suchte, und auch nicht, weil er unfähig gewesen wäre, eine eigene Komposition zu schaffen und eindrucksvoll zu inszenieren – sein Können hatte er im Grunde schon an den inneren Tortürmen und am Weberhaus bewiesen. Raffaels Sixtinische Madonna war überall bekannt und wurde wie keine zweite bewundert; gerade auch von denjenigen, die sich in den Schönen Künsten sachverständig glaubten, doch darin nicht wirklich wissend waren, geschweige denn technisch ausgebildet. Es gab außer Raffael genügend andere welsche Künstler, von Federico Barocci und Michelangelo Merisi da Caravaggio über Antonio da Correggio bis zu Marietta Robusti, Tintorettos ältester Tochter, deren Kompositionen einer Sacra Conversazione14 der des Raffaels an Ausdruckskraft und ikonografischer Brillanz sehr wohl das Wasser reichen konnten. Raffael jedoch hob sich von ihnen durch wenige untypische Stilmittel ab. Ob das der Grund war, weshalb sich alle Welt um ihn und seine Sixtinische Madonna scherte, darüber konnte Matthias nur mutmaßen. Allein die außerordentliche Wertschätzung, die man dem Maler entgegen brachte, war Matthias’ Grund, sich dieses berühmten Werks als Vorlage für seine Replik zu bedienen, und damit seinen Stand als Augsburger Kunstmaler auf einen festen Sockel zu stellen, mehr noch, von diesem Sockel aus endlich zum hiesigen Mäzenat vorzudringen und die Chance zu erhalten, zum offiziellen Stadtmaler ernannt zu werden – Hans Müller, der jetzige, wurde diesem Titel nicht mehr gerecht; sein Augenlicht war schwach geworden und seine Hand zitterte, letztlich malte er grauenhaftes Zeug, und Matthias fragte sich immer wieder, wie lange Protektion allein den alten Mann noch in diesem Amt halten mochte. Matthias wusste um die Gunst der Protektion – dass er und seine Frau Ibia so zügig das Augsburger Bürger- und er zudem das Handwerksrecht erhalten hatten, als sie vor elf Jahren von München hierher übergesiedelt waren, war einzig einem entsprechenden Schreiben Herzog Wilhelms15 zu verdanken. Mit dem Ausscheiden aus den dortigen Diensten hatte Matthias diese Quelle der Förderung versiegen lassen. Nicht nur Hans Müller hatte seine Karriere gedrosselt, ärger noch war ihm Joseph Heintz im Weg gestanden. Der hatte sich seinerzeit dermaßen geschickt mit den höheren Augsburger Kreisen verwoben, dass es für Matthias ein Schweres gewesen war, auch ein Schläufchen des Geklüngelteppichs zu erheischen. Das berechnende sich Infiltrieren in den Elitärfilz war dem Basler Meister besser als Matthias gelungen, nicht nur, weil er älter an Jahren gewesen war, über mehr Berufserfahrung verfügte und einiges länger in Augsburg weilte, sondern weil er es bravourös beherrscht hatte, der oberen Eitelkeit ergebenster Diener zu sein. Erst nach Heintz’ Tod, durch Garbs Gunst und dank Raders Fürsprache war Matthias ein allmählicher, doch für sein Empfinden beschämend langsamer Aufstieg gelungen. Rottenhammer, ihm zu Münchner Zeiten noch voraus gewesen, hatte erst vier Jahre nach ihm das hiesige Bürgerrecht erhalten und war meist auswärtig beschäftigt; der bot keine Gefahr.
Matthias legte den Pinsel ab, rieb sich die Kniegelenke, hauchte sich in die Hände und schritt wieder zur Mitte des Ateliers, um das Fresko in seiner Ganzheit wahrzunehmen; das war der Tribut an großformatige Bildnisse, man musste in den vielen Stunden des Malens tausende Schritte hin- und hergehen, um Inaugenscheinnahme und anschließendes Fortfahren zu verbinden. Die Stimmungen der Gesichter des Figurenensembles waren ihm vortrefflich gelungen; die Fürsorge der Madonna, die Ängstlichkeit des Jesuskindes, die Erhabenheit der Heiligen Barbara und die Demut des Papstes Sixtus II., die Tiara abgesetzt, das schüttere Haupt entblößt. Nicht nur deren Physiognomie hatte er originalgetreu wiedergegeben, auch stand das Augenspiel der einzelnen Figuren der Vorlage in nichts nach; Madonna folgte dem Fingerzeig Sixtus II., während die Heilige Barbara auf die beiden Putten sah, die wiederum ihren Blick erwiderten. Stolz war er auch, die Farben aller Bildelemente selbst in kleinsten Nuancen getroffen zu haben: das elfenbeinige Sand im aus jungen Engelsköpfen bestehenden Himmel, das bernsteinerne Honiggold des päpstlichen Chormantels, das tintige Nachthimmelblau und scharlachrote Purpur des Madonnengewandes, und das moosige Waldlichtgrün des Vorhanges, der die Komposition zum oberen Rand hin geometrisch abschloss. Allein Verdruss bereiteten ihm immer noch die Faltenwürfe. Rottenhammer hatte ihn schon seinerzeit gelehrt, dass Gesichter einfach, Faltenwürfe jedoch am schwersten zu malen seien, und Recht hatte er bis heute behalten. Es half nichts; Matthias musste die ganze Kraft seines technischen Könnens in den Schlag der Falten legen und nicht eher ablassen, bis deren Ausführung dem Fresko genau den glanzvollen Rahmen schenkte, das es verdiente, aber auch brauchte, um Ehrfurcht bei seinen Betrachtern zu erwecken, die ihm nur dann weitere Gönnerschaft entgegenbrächten.
Die Zeit drängte. In sieben Tagen würde er die Enthüllung vornehmen, ein Unding, die drei Geladenen länger warten zu lassen. Er schritt zum Tisch, griff sich eine der zahlreichen Federn aus dem Becher, tunkte sie ins Tintenfass und setzte 13. März in die Einladung ein, die er noch heute abgeben würde. Somit zwang er sich, alles daran zu setzen, rechtzeitig mit der Freske fertig zu werden. Mit einem Ziehen in den Knien strebte er zurück an die Wand, nahm den Pinsel auf und machte sich an die dritte Falte von links des rechten Vorhangs.
»Matteo!« Ibia rief von draußen und trat wenige Augenblicke danach ins Atelier, den kleinen Matthias, ihren Sohn, im Arm.
»Gott, wie kalt es hier wieder ist! Man sieht jeden Atemhauch. Du wirst mich eines Tages noch unterm Malen zur Witwe machen und unseren kleinen Matteo zum Vaterlosen!«
Ibia schlug das Schultertuch übers rußschwarze Haar und drückte den Kleinen noch näher an die Brust. Schon öfters hatte Ibia Matthias vorgehalten, dass er nie einheize – der Ofen im Atelier fasste mehr Holz als der in der Wohnstube, und Scheite lagerten genügend draußen unter dem Verschlag –, doch stets vertieft in seine Arbeit, vergaß er es schlichtweg oder wollte sich nicht aus seinem schöpferischen Akt durch so etwas Banales wie heizen herausreißen lassen. Lieber fror er, als auch nur einen Moment eines kreativen Aktes – und das konnte manchmal nur ein einziger Pinselstrich sein – verlustig zu werden. Als Ibia für die Madonna seiner Replik Modell gestanden hatte – sie war das einzige lebende Modell, sonst malte er nach einer Vorlage, seinerzeit aus Rom mitgebracht –, war ihm der Ofen nur deshalb nicht erloschen, weil sie ihn immer wieder darauf hingewiesen hatte; so vertieft war er in ihr Gesicht gewesen, so verliebt in sie, die wie keine andere Frau aus dem Welschland der Sixtinischen Madonna glich. Am liebsten hätte er Madonnas braunem Haar unter dem ockerfarbenen Kopfschleier Ibias Schwarz gegeben, aber diesen Kunstfrevel zu begehen, traute er sich nicht, bei aller Liebe zur Fantasie und zu seiner Frau.
Matthias hielt inne und beobachtete, wie Ibia sich geschickt mit nur einer Hand am Ofen zu schaffen machte, während sie den Kleinen sicher mit der anderen weiter an die Brust drückte. Ihm gefielen ihre flinken Finger und ihre behänden Bewegungen; obwohl sie ihm manchmal Muße war, so war sie ihm mehr noch seine Muse. Um das Feuer zu entzünden, legte sie das in ein Tuch gehüllte Kind auf den Tisch, nahm es aber sogleich wieder in die Arme. Matthias ging auf die beiden zu und gab erst Ibia, dann seinem Söhnchen einen Kuss.
»Na, mein kleiner Scheißer!«
Der Bub strahlte. Das rührte Matthias, doch er ließ sich nichts anmerken. Er wollte nicht, dass seine Frau zu oft seine weiche Seite spürte. Sie liebte ihn der anderen Seite wegen.
»Gerade war ein Bote der Stadtpfleger da. Du sollst morgen um acht im Rathaus sein, der Geheime Rat trifft sich.«
»Du meist den Großen Rat, dem gehöre ich an. Dem Geheimen Rat werde ich es zeitlebens nicht.«
»Ich habe mich nicht verhört, der Bote sprach vom Geheimen Rat. Außerdem weiß ich sehr wohl den Unterschied, du hast ihn mir oft genug erklärt.«
»Was hat er noch gesagt?«
»Der Stadtwerkmeister habe das Problem mit der Ratsglocke gelöst. Sie käme in den Perlachturm. Jetzt könne man endlich ans Werk. Das könne für dich sehr interessant sein. Alles Weitere morgen.«
Der kleine Matthias fing zu schreien an.
»Er hat Hunger. Ich gehe wieder mit ihm hinüber.«
Ibia gab Matthias einen langen Kuss, rieb ihm dabei den Hosenlatz und hauchte ihm ins Ohr: »Der kleine Matthias will ein Geschwisterchen. Also komm bald.«
Sie trat aus der Tür. Bevor sie sie schloss, mahnte sie Matthias: »Leg Holz nach! Ich brauche einen gesunden Mann.«
Matthias wusch die Pinsel aus. Was er sonst mit Hingabe machte – er liebte es, zu sehen, wie die Farbe sich von den Borsten löste und im Wasser zu Schlieren verfloss –, tat er jetzt gedankenversunken; hatte Elias es tatsächlich geschafft. Wie oft war er Matthias in den Ohren gelegen damit, dass er nicht ablassen werde, bis die Entscheidung für das neue Rathaus falle. Das Geld säße locker für den Prunk, man verfüge über genügend; in ein paar Jahren könne das vorbei sein, hatte er gesagt und dabei die Prognosen des hiesigen Kalendermachers und Astronomen Georg Henisch zitiert; der sähe nichts Gutes für die Zukunft – Krieg, Pest und Hungersnöte sollten uns mehr denn je heimsuchen. Immer wieder schicke der Herrgott Zeichen, nur würden diese entweder nicht wahrgenommen oder wenn doch, als Schwarzmalerei, gar Hysterie abgetan oder komplett missachtet werden. So in Gedanken, schabte Matthias die restliche Farbe von der Palette und strich sie in die tönernen Gefäße, die er mit Korkdeckeln verschloss. Er war in guter Stimmung; die ferne Zukunft war zu weit weg, als dass sie ihn bekümmern mochte. Ihn trieb der Gedanke an die nahe Zukunft zur Freude – es sollte sich tatsächlich anschicken, dass er morgen bei der Sitzung des Geheimen Rats zugegen sein durfte. Das war noch nie der Fall gewesen. Wenn es in Augsburg darum ging, Visierungen für Fassaden neuer Bauwerke zu zeichnen, war er bislang einzig von Elias dazu beauftragt worden. Elias hatte ihm exakt bemaßte Skizzen überreicht, die er veredeln sollte. Wenn es fein und kunstvoll sein musste, hatte sich Elias immer an ihn gewandt. Nicht, dass Elias nicht auch etwas aufs Papier brachte; aber bei ihm war es ein totes Zeichnen, angewandte Geometrie mit Zirkel und Winkelmaß, da lebte nichts. Malerei war etwas anderes.
Matthias fragte sich, warum er diesmal mit eingeladen wurde. Sollte das Erhoffte eintreten? Stand seine Ernennung zum Hofmaler an? Hatte Marx Welser das für ihn lanciert? Der Patrizier und er verstanden sich gut, beide waren überzeugte Katholiken, und nicht umsonst war Welser Taufpate bei seinem Sohn gewesen. Oder waren sie gar auf seinen Loggiaentwurf zurückgekommen? Seinen begnadeten Entwurf? Dieser war der einzige, der ganz aus seiner Feder stammte, ohne Elias’ Vorgabe. Der Loggiaentwurf war ein Meisterwerk; vom Format eines Palladios. Elias hatte sich damals gegen den Entwurf gewandt, er sei viel zu teuer, das Material zu schwierig zu bekommen, die Bauzeit würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, der Bau sei zu welsch und passe nicht ins Stadtbild et cetera et cetera. Matthias glaubte damals, Elias sei neidisch auf ihn, da der Rat nicht einhellig für seine arg nüchternen Ideen gestimmt hatte, sondern einige Mitglieder den Loggiaentwurf befürworteten. Dabei wäre es doch Elias gewesen, der die Loggia schließlich in Stein und Marmor verwirklicht hätte. Matthias hatte nur seinen Genius aufs Papier gebracht. Bloße Zeichnungen. Was gab es dagegen zu tönen? Und jetzt? Was war jetzt geschehen? Hatten sie sich also besonnen und gedachten des genialen Schöpfers. Gut, Heintz’ hatte ihn darauf gebracht, und auch dessen Entwurf war recht ansehnlich, doch der lebte ja nun nicht mehr … Matthias, deine Zeit ist gekommen! Mit jedem weiteren Gedanken spürte er Kräfte in sich aufsteigen. Sein Loggiaentwurf für das neue Rathaus würde ihn unsterblich machen. Der Titel des Stadtmalers käme dann ganz von allein. Eine zusätzliche Gratifikation.
Eine Siegeshymne summend faltete Matthias die Einladung für Rader, versiegelte sie und steckte sie in die Umhängetasche. Mit raschen Bewegungen zog er sich an und machte sich auf den Weg zum Sankt Salvator Kollegium. Jedem, der ihm entgegenkam, einerlei ob er ihn kannte oder nicht, hob er die Hand zum Gruß; heute waren ihm alle Menschen Freund. Das Summen begleitete ihn bei jedem Schritt. Er musste an sich halten, nicht in Singen auszubrechen, obwohl es ihm gebührte, ihm, dem Schöpfer des neuen Loggia-Rathauses.
In wenigen Minuten war er beim Kollegium im Georgsviertel angelangt. Nach dreimaligem Klopfen an der schweren Eichenpforte am Ostflügel wurde ihm geöffnet. Ein junger Mann, ganz in dunkelbraunem Tuch, mit gedrungenem Körper, rosa Wangen und Wulstlippen unter der kantigen Nase, gab ihm Bescheid: »Professor Rader ist nicht zugegen. Er lehrt am Münchner Kolleg bei Sankt Michael und besucht uns nur sporadisch zu besonderen Anlässen.«
Vor zwei Jahren hatte Herzog Maximilian Rader zu sich geholt. Der Herzog war durch seine Publikationen auf ihn aufmerksam geworden. Rader lehrte seitdem dort als Professor für Rhetorik und Humaniora16. Ein ›besonderer Anlass‹ bot sich Rader durch die Enthüllung der Madonna.
»Kommt er nicht nächste Woche wieder für mehrere Tage hierher?«
»Das ist richtig. Ein holländischer Astronomieprofessor wird uns beehren. Zudem muss Professor Rader hier einige wichtige Unterredungen führen. Morgen wird ein Kurier nach München reisen, um ihm vorab Auskünfte zu überbringen.«
»Dann darf ich Euch bitten, ihm diesen Brief mitzugeben. Professor Rader weiß Bescheid.«
Der Wulstlippige nahm die Einladung entgegen und sah auf das Siegel, das die Rückseite des Briefes verschloss.
»JMK steht für …? Nur, damit ich es in die Liste eintragen kann.«
»Johannes Matthias Kager. Ich bin hiesiger Kunst- und Freskenmaler.«
»Oh, Ihr habt die Fresken am Weberhaus gemalt.«
»Ja, sie sind mein Werk.«
»Sie sind wunderschön. Professor Rader hat sie mit uns angesehen und uns die Symbolik erklärt. Er hält große Stücke auf Euch. Er findet es schade, dass Ihr immer nur auf das Weberhaus begrenzt werdet, wo Ihr doch noch das Heilig Kreuz- und das Frauentor bemalt habt.«
»Und nicht nur die. Meine Arbeiten sind weit umfangreicher. Das Weberhaus liegt eben zentral, man kommt nicht an ihm vorbei. Will man meine anderen Arbeiten sehen, muss man sich nach München, Zwiefalten oder nach Hall in Tirol bequemen.«
Der junge Jesuit verabschiedete sich ehrfurchtsvoll und schloss lautlos die Pforte. Matthias machte sich auf den Nachhauseweg. Er summte erneut, seine Stimmung war durch dieses kurze Gespräch noch gestiegen.
Im kalten Atelier zog er die alten Loggiaentwürfe hervor und nahm sie mit in die warme Wohnstube, um sie dort noch einmal im Detail zu studieren. Ibia hatte die Stube stärker als gewöhnlich geheizt, weshalb sie zum Kleid ohne Wolljacke und nur im weißen Leinenhemd sein konnte. Matthias knöpfte sich das Wams auf, setzte sich an den gedeckten Tisch und erzählte Ibia vom Wiederaufgreifen der Loggiaidee. Dabei sah er sie an, wie sie schräg zum Herd kniete und Holz im Ofen nachlegte. Die Flammen spiegelten sich auf dem Halbprofil ihres Gesichts und der bernsteinfarbene Schimmer ihrer Haut gab Ibia etwas Göttliches. Ihr Haar, sonst zu einem Turm nach oben gesteckt, trug sie offen, es glänzte wie gewässert im Licht des Ofenfeuers. Matthias schien, als ob Ibia gar Gesichtsfarbe auf Wangen und Lippen gegeben hatte. Auch hatte sie üppiger als sonst zum Nachtmahl aufgetischt. Es gab Fisch und den Wein unverdünnt. Ibia füllte die Teller und wünschte guten Appetit. Sie sprachen das Tischgebet.
»Ein Festmahl heute. Ist es wegen morgen?«
»Ja, auch.«
»Du glaubst also, dass sie meinen Entwurf nehmen?«
Ibia verzog das Gesicht, eine Miene, die Matthias nicht recht zu deuten wusste. Er aß kaum und trank nicht vom Wein, auf den Ibia ihn immer wieder hinwies. Zu vertieft war er in seine Visionen über den morgigen Tag. Er redete nur noch davon und Ibia, die anfangs miteingestimmt hatte und längst zu Ende gegessen, wurde zusehends stiller, bis sie am Ende schweigend am Tisch saß. Es dauerte eine Weile, bis Matthias ihr Verstummen wahrnahm.
»Was ist, cara mia?«
»Wie wär’s, wenn du für heute mal die Entwürfe vergisst und dich auf was anderes besinnst? Du hast den ganzen Tag Zeit für deine Malereien und Zeichnungen gehabt!«
»Aber Liebes … verstehst du denn nicht? Ich versuche dir die ganze Zeit zu erklären, was das neue Rathaus für uns bedeutet. Wenn morgen der Auftrag in meiner Tasche steckt, haben wir es geschafft! Es bringt uns Geld und Ansehen. Wir können ein eigenes Haus erwerben … in der Frauenvorstadt auf dem Domberg. Das hast du doch schon immer gewollt! Du kannst dir neue Kleider kaufen und Schmuck; sogar Parfüm, wie Antons Frau.«
»Das ist alles sehr schön und ich freue mich für dich wie niemand sonst auf der Welt, aber …«
»Aber was?«
»Hast du keine Augen im Kopf?«
»He, ich bin Maler! Wer sollte besser wahrnehmen als ein Künstler?«
»Dann nimm mal wahr! Was soll ich denn noch anstellen, Stupido?«
Ibia stand auf und verschwand in der Schlafkammer. Matthias hatte verstanden. Er würde seinen ehelichen Pflichten auch fraglos und liebend nachkommen, nur … ein letztes Mal noch die Pläne studieren, es war wirklich zu wichtig … dann würde er zu Ibia … nur noch einmal über die herrlichen Entwürfe schweifen, dann …
Als Matthias endlich in die Schlafkammer kam, saß Ibia aufrecht im Bett, das Federkissen im Rücken, die Arme über der Brust verschränkt, das Haar streng nach hinten gezogen, zu einem Zopf geflochten. Ihr Gesicht wirkte wie aus Stein, der Blick war scharf nach vorne gerichtet. Matthias zog sich aus und schlüpfte zu ihr unters Laken. Er wusste, dass er etwas gutzumachen hatte. Er wusste aber auch, dass Ibias welsches Temperament, derentwegen er sie ja so liebte und sie geheiratet hatte, ihm das in solchen Situationen sehr schwermachen konnte. Wenn Unbill sich in ihr breitmachte, wandelte sie sich zu einer unbestimmbaren Größe: Versuchte er es mit Schmeicheleien, konnte es angehen, dass sie ihn als Lecchino17 beschimpfte; ließ er versöhnende Worte weg und ging ihr sogleich an die Wäsche, setzte es eine Sberla, eine Ohrfeige, und es folgte die vorwurfsvolle Frage, wo er seinen christlichen Anstand gelassen habe. Gott sähe alles, vor allem seine schmutzigen Hände, mit denen er sie überall befingere! Da sie bereits unter dem Laken steckten, für alle Blicke – auch für die schaulustigen des Herrgotts da oben – verborgen, sah Matthias gute Chancen für die wortlose Strategie. Er entschied sich für das bewährte, moderate Hinübergleiten zu ihren Brüsten. Ibia liebte es, wenn er mit dem angefeuchteten Finger über ihre kastanienbraunen Warzenhöfe strich. Das Schlimmste, was diesen durchaus geschickten Einstieg vereiteln mochte, war, dass Ibia ihm mit einem begleitenden »Smettila!«18 die Hand wegschob. Dann brauchte er drei, manchmal vier, schlimmstenfalls fünf Anläufe, bis die anschwellenden Höfe die wegdrängende Hand lähmten und Ibia milde Wonneschauer durchfuhren. Das erste »Smettila!« ertönte schon, die Hand tat das Erwartete. Das beruhigte ihn; bestätigte es doch seine Frau in ihrer Berechenbarkeit, was ihn wiederum in Sicherheit wiegte und zum zweiten Anlauf ermutigte. Und tatsächlich, schon nach dem zweiten »Smettila!« war sie besänftigt und ließ ihn gewähren. Dem feuchten Finger über dem linken Warzenhof folgte der feuchte Finger über dem rechten, folgten zwei feuchte Finger gleichzeitig über beide Höfe, in gleichmäßigen Kreisen, mal rechts mal links herum, gleich- oder gegenläufig. Matthias kreiste variantenreich in Druck und Tempo und flocht in unregelmäßiger Folge ein spielerisches Schnippen der Fingerkuppen gegen die steifgewordenen Nippel ein, was Ibia ihm mit Schluchzen, einem Grätschen der Schenkel und zielsicherem Griff in Matthias aufgewühlte Leisten dankte.
Es nahm seinen Lauf. Allerdings einen ungewollt holprigen. Matthias wusste mit einem Mal nicht, wie ihm geschah, stoßend zwischen Ibias weit geöffneten Schenkeln. Er grunzte wie ein Keiler, schwitzte und stank wie ein ruchloser Gerberknecht. Die Bettlade, ruckelnd und quietschend, holperte synchron mit jedem seiner Stöße gegen die Wand. Ibia keuchte. Ihr Dutt hatte sich gelöst, das schweißnasse Haar klebte ihr wie ein Kokon im Gesicht. Matthias fühlte sich mit jedem Stoß, den er seiner Frau versetzte, seltsamer. Er war wohl in ihr, doch nicht bei ihr und auch nicht bei sich. Er war weg …
Nicht das Festkrallen ihrer Fingernägel in seinem Rücken ließ ihn aufschreien und den Akt mit einem Aufschrei zum Höhepunkt kommen, sondern ein Wort, ein einziges Wort machte alles zunichte.
»Loggia!«, schrie Matthias wie im Wahn und mit diesem Ausruf endete abrupt der Akt.
»Du Scheusal!«
Ibia versetzte ihm eine Sberla. Ein roter Abdruck blieb. Matthias holte aus und wollte parieren, doch er zog entsetzt die Hand zurück. Ibia strampelte ihn von sich weg, wandte sich ab und heulte. Matthias war fassungslos.
Die halbe Nacht hatte Matthias zugebracht, um die Wogen zu glätten. Selten hatte er sich so um die Gunst seiner Frau bemüht. Er wusste, er hätte sich ganz anders aus der Affäre ziehen können, ihr mit drei, vier rauen Sätzen Bescheid stoßen, ihr Vorwürfe machen über ihr Unverständnis und fahrlässiges Verkennen der Situation, dann sich anziehen und ins Wirtshaus gehen, im ›Prinz von Oranien‹ bekäme er auch noch spät nachts ein Bier. Doch das wollte er nicht. Hier hatte er gefehlt, hatte er der Frau, die er liebte, Unrecht getan. Einzig an ihm war es, das wieder ins Lot zu bringen.
Sie lagen nebeneinander im Bett. Einen erneuten Liebesversuch unterließen sie, doch hielten sie einander die Hand.
»Wieso kommst du eigentlich auf den verrückten Gedanken, die wollten deine Loggia bauen?«
»Bitte?«
»Sie haben sie damals alle abgelehnt. Du hast mir die Gründe lang und breit erklärt. Erst hast du gewettert und alle im Rat als nichts wissende Stronzi bezeichnet. Dann hast du es nach und nach eingesehen. Elias war’s doch, der dich überzeugt hat, dass die ganze Sache ein Luftschloss war!« Ibia machte eine kurze Pause. »Was ist jetzt eigentlich mit seinem Weib? Geht’s Rosina wieder gut?«
»Mein Entwurf ist vor vier Jahren abgelehnt worden. Und auch nicht ›von allen‹. Elias hat seitdem einen Kunstbau nach dem anderen hochgezogen. Der Rat trachtet die ganze Stadt zu veredeln. Augsburg soll die Prachtstadt im Reich werden. Was meinst du, Ibia, wieso sie die Metzg verlegt haben? Stinkendes Fleisch macht sich in heißen Sommern nicht gut, wenn die feinen Leut vor dem Augustusbrunnen flanieren. Dort, wo Elias jetzt den Neuen Bau errichtet, hätte ursprünglich die Loggia hinsollen. Das geht jetzt nicht mehr, darum kommt das alte Rathaus weg und meine Loggia dort hin. So einfach ist das.«
»Das glaube ich nicht. Die Abfuhr kam nicht nur wegen des Platzes. Die Loggia war denen viel zu venezianisch und das Geld in der Stadtkasse ist in den letzten Jahren nicht mehr, sondern weniger geworden. Das hat Garb mir erzählt.«
»Was soll ich dann morgen da auf der Sitzung? Wenn alles beim Alten bliebe, brauchte ich nicht hinzugehen. Dann bekäme ich meine Aufträge nach wie vor vom Baumeisteramt über Elias.«
»Was du da sollst? Überleg doch mal selbst. Deine Stärke sind nach wie vor die Fresken. Die paar Fassadenentwürfe, die du gemacht hast … Die waren ja eh nie ganz allein von dir. Entweder hat Heintz dir die Vorlagen gegeben oder Elias.«
»Das heißt was?«
»Sie wollen, dass du das neue Rathaus mit Fresken bemalst. Die Malerei am jetzigen Rathaus ist ja nicht üppig. Der Rat will etwas ganz Besonderes, so wie du es beim Weberhaus gemacht hast, bloß noch mehr, richtig grandios. Du bist der Maler, der das kann!«
Matthias schwieg. Diese Möglichkeit hatte er nicht bedacht. Ibia hatte es trotz ihres welschen Bluts nüchtern auf den Punkt gebracht. Herrgott nochmal, wie konnte es sein, dass dieses Weib ihn immer wieder derart klar und deutlich eines Besseren belehrte? Er presste die Lippen zusammen. Ein dumpfes Gefühl fühlte er in sich, eine Form von Trauer, so wie sie ihn manchmal heimsuchte, wenn er die grenzenlose Liebe Ibias zu ihrer beider Sohn beobachtete. So etwas hatte er und sein Bruder Hans nie erfahren – seine Eltern hatten außer Arbeit nichts im Sinn gehabt – und er zweifelte, ob er jemals so viel Liebe schenken konnte, wie es Ibia vermochte. Ibia schien seine Enttäuschung zu spüren. Sie legte ihren Kopf auf seine Brust und strich ihm sanft durchs Kräuselhaar. Lange fiel kein Wort.
»Matthias, soll ich dir zum Einschlafen noch etwas Gutes tun? Ich meine etwas ganz Gutes?«
Er nickte. Ibia verschwand unter der Decke. Nach einer Weile kam sie wieder hervor – ohne Erfolg. Sie wischte sich mit dem Laken über den Mund, küsste Matthias auf die Stirn und drehte sich wortlos zur Seite. Nach wenigen Minuten hörte er ihr Schnarchen – ein weiterer Grund, weshalb er bis weit in die Nacht kein Auge zubekam.
Bereits um viertel vor acht stand Matthias am nächsten Morgen im Sitzungssaal des Rathauses und strich sich die Kleidung zurecht. Er war allein, ein Bediensteter hatte ihn eingelassen und geheißen zu warten, die Herrschaften geruhten jederzeit einzutreffen. Er ging zu einem der Fenster, legte die Hände auf das Sims und sah hinaus gegen die aufgehende Sonne. Es hatte aufgeklart, seit Tagen zeigte sie sich zum ersten Mal wieder über der Jakobervorstadt. Ihre Strahlen fielen noch matt und in einem flachen Winkel auf ihn und den großen Eichentisch hinter seinem Rücken, auf dem vor noch leeren Stühlen dreizehn venezianische Gläser standen und an dem in den nächsten Stunden wohl Augsburger Stadt- und Kunstgeschichte geschrieben würde. Er hatte seine Referenzmappe mit den Abbildungen der Weberhausfresken und weiteren Entwürfen auf eine der drei Sitztruhen gelegt, er wollte nicht, dass man seine Nervosität an den Abdrücken seiner Schwitzhände auf dem hellen Leder entlarven konnte. Um sich abzulenken, besah er sich die Konterfeis der Stadtältesten – allesamt Kupferstiche, die meisten von den Gebrüdern Kilian – und suchte vergebens nach handwerklichen Mängeln, als die hohen Herrschaften nacheinander eintraten. Zuerst schritten die beiden Stadtpfleger Marx Welser und Johann Jacob Remboldt zur Tür herein. Sie trugen obligat den pelzbesetzten Talar, Amtskette und Mühlsteinkragen. Es folgten die Geheimräte Jeronimus Walter, Conrad Peuttinger, Bernhard Rehlinger, David Welser und Hans Fugger der Jüngere. Deren Talare zierten zwar ebenfalls Pelzbesätze, doch fielen diese wie auch die Mühlsteinkragen und Amtsketten nicht ganz so üppig aus. Danach betraten Constantin Imhoff, Wolfgang Paller und Bartholomäus Welser als Ädile den Saal. Sie waren am wenigsten schmuck gekleidet, allein die Farbe schwarz vom Scheitel bis zur Sohle und nur ein einfacher weißer Kragen zierten ihren Staat. Zuletzt erschienen Elias und, zu Matthias’ Überraschung, Anton Garb, der seines Wissens kein reichsstädtisches Amt bekleidete. In letzter Zeit sah Matthias ihn öfter mit Marx Welser zusammen. Das hatte Gründe, nur welche?
Es wurde nach Sitzordnung Platz genommen, Remboldt und Marx Welser saßen an der Stirnseite, die Längsseiten wurden rechts und links nach Reihenfolge des Eintretens besetzt. Garb begrüßte Matthias mit Handschlag und setzte sich neben ihn, beide saßen Elias gegenüber. Elias nickte Matthias zu und Matthias erkannte deutlich dessen Erstaunen über sein Hiersein, wenngleich es Matthias schien, als suche Elias es zu verbergen.
Zwei Bedienstete brachten Wein und Wasser herbei. Es wurde zugeprostet und gemeinsam getrunken. Remboldt stand auf und eröffnete die Sitzung. Nach Verlesung der Anwesenden erzählte er in ausschweifenden Worten über das stete Voranschreiten Augsburgs trotz seiner schwierigen Geschichte.
Als er nach vielen Sätzen mit seiner Einleitung zufrieden schien, nahm er sein Glas und prostete erneut allen zu.
»Bei der letzten Sitzung vor drei Tagen«, sprach er, »hat der Rat den einhelligen Entschluss verabschiedet, das alte Rathaus noch im Sommer abzureißen und ein neues zu bauen.«
Remboldts Worte wurden von heftigem Knöchelklopfen auf den Tisch begleitet. Remboldt rollte ein Pergament aus, zeigte es in die Runde und kommentierte die darauf befindliche Zeichnung. Es war ein Entwurf von Elias. Er zeigte den neuen Perlachturm. Recht ansehnlich, doch nicht wirklich etwas Besonderes. Man habe in punkto Glockenproblem und dessen Lösung schon alles im Geheimen Rat ausführlich diskutiert, fuhr Remboldt fort, weswegen er hier nur kurz darauf eingehen werde. Er verlor ein paar Sätze über die Aufstockung, für die gänzlich der Stadtwerkmeister verantwortlich zeichne, um zum eigentlichen Thema der Sitzung zu gelangen: Man habe sich hier und heute getroffen, um über den Modus operandi bei der Entwurfserstellung des neuen Augsburger Rathauses übereinzukommen. Damit meine er nicht irgendeinen Allerweltsentwurf, sondern einen wahrhaft großen, ja einen geradezu heroischen. Das neue Rathaus müsse das alte nicht nur übertreffen – was im Übrigen bei dem alten Kasten, so ehrbar er sei, keine Kunst wäre – sondern alle Rathäuser im ganzen Heiligen Römischen Reich! Die Mienen der Anwesenden spiegelten selten gesehenen Ernst. Remboldt trank einen Schluck und fuhr fort. Mit dem allseits bekannten und hochgeschätzten Stadtwerkmeister Elias Holl und dem Freskanten Matthias Kager, einem Kenner der welschen Kunst, wie er vor Jahren mit seinen Loggiamodellen eindrucksvoll unter Beweis gestellt habe, verfüge die Stadt über zwei herausragende Sachverständige, die wie niemand anders sonst befähigt seien, einen solchen Entwurf zu kreieren. Matthias merkte auf. Er sollte tatsächlich das neue Rathaus entwerfen. Es kribbelte in ihm. Die Worte Remboldts hallten nach. Er versuchte, den Überschwang der Gefühle zu zügeln. Garb reichte ihm die Hand herüber und sprach ihm flüsternd seine Gratulation aus. Matthias antwortete nur halbherzig, er sah hinüber zu Elias. Der schaute ihn gar nicht an, sondern stierte zu Remboldt. Selten hatte Matthias ihn mit solch starrem Blick gesehen.
Remboldt erhob sich.
»Werte Herren Architekten. Der Rat ersucht Euch, die ersten Entwürfe bis zum achtundzwanzigsten Tag dieses Monats einzureichen. Wir gehen davon aus, dass die alten Entwürfe gut aufbewahrt wurden. Die räumlichen Gegebenheiten des Perlachplatzes haben sich nicht geändert, es kann also auf die gleichen Maßvorgaben zurückgegriffen werden.«
Nach Remboldt sprach Welser noch einige erläuternde Worte. Er betonte, dass sehr wohl und unverkennbar welsche Manier in die Entwürfe einfließen sollte, man aber auf ein eigenes Augsburger Stadtgesicht zu achten habe. Er wünsche sich eine fruchtende Kooperation zwischen den beiden Architekten und dem Rat. Mit Gottes Willen sei nicht nur der Stadt und seinen Vätern, sondern auch allen seinen Bürgern und künftigen Gästen ein Rathaus beschieden, wie es kein zweites im Reich anzutreffen sei.
Man erhob noch einmal gemeinsam die Gläser und Remboldt schloss die Sitzung. Die Ratsmitglieder gratulierten einander und wünschten den beiden Architekten viel Inspiration und gute Ideen.
Elias selbst blieb wortlos und konnte sich nur ein Nicken abringen. Auch als Matthias und er sich die Hand reichten, schwieg er.
Bis auf Elias und Remboldt verließen alle den Saal. Unten vor dem Rathaus löste sich die Gruppe auf, die Mitglieder verließen einzeln oder zu mehreren den Platz. Es blieben nur mehr Marx Welser, Anton Garb und Matthias.
Marx Welser wandte sich Matthias zu. »Na, Meister Kager, damit habt Ihr nicht gerechnet, hm? Ihr seht, Eure Leistung wird nicht nur wahrgenommen, sie wird auch honoriert. Wir sind sehr auf Eure Entwürfe gespannt.«
Garb blinzelte gegen das Sonnenlicht, das über dem Rathausdach hervorschien. »Endlich Sonne!« Er wandte sich Matthias zu: »Und, Kager, was Euren Auftrag angeht … wir Handelsleute sagen schon immer: Konkurrenz belebt das Geschäft. Ist schon recht, wenn nicht immer nur dem Holl alles zugeschanzt wird.«
Inzwischen erschienen Remboldt und Elias vor der Tür. Remboldt sah in die kleine Runde, verabschiedete sich mit erhobener Hand und ging in Richtung Weinmarkt. Elias stand allein und sah auf den Boden. Matthias ging auf ihn zu.
»Ich soll Dir und Rosina schöne Grüße von Ibia ausrichten. Sie fragt, wie es ihr geht«, log er. Es war allerdings nur eine halbe Lüge – die Frage hatte Ibia ja gestern tatsächlich gestellt, nur der Gruß war von ihm vorgeschoben. Erst nach wenigen Augenblicken antwortete Elias gedämpft.
»Wir suchen ein Kindermädchen.«
Die Antwort war unzulänglich, doch Matthias wusste, jetzt war nicht Zeit und Ort, darauf einzugehen. Garb und Marx Welser kamen dazu. Als Marx Welser erwähnte, Remboldt habe ein paar dezente Äußerungen hinsichtlich Rosina gemacht, erzählte Elias über ihren schlechten Zustand. Die ersten Worte holperten ihm über die Lippen, doch dann sprach er in einem monotonen Fluss. Er sprach, anders als sonst, langsam und leise, und er erzählte unerwartet viel, wohl mehr als die Umstehenden gewünscht hätten. Er klagte sein Leid und es schien ihm einerlei, ob man ihn bemitleidete oder nicht.
»Ich werde mich für Euch umhören«, versprach Marx Welser Elias und selbst Garb, der noch vor wenigen Tagen so derbe auf dem Neuen Bau gesprochen hatte, stellte ihm Hilfe in Aussicht. Bei den Geschlechtern habe jeder Kindsmägde und man wisse gute herbeizuschaffen. Morgen schon, spätestens übermorgen, habe er eine im Hause, versprach ihm Anton.
»Das ist sehr ehrbar von Euch, aber das kann ich nicht annehmen. Ich finde schon selber eine. Es ist ja nicht so, als ob ich niemanden kennte.«
Anton wiegte den Kopf. »Holl, Edelmut ziert, doch warum Hilfe abschlagen? Ihr seid kein Bittsteller, also was soll’s? Ich gebe Euch mein Ehrenwort, morgen habt Ihr eine!«
In Welsers Blick deutete Matthias Wohlwollen. Elias war ein Eigenbrötler, der seine Probleme allein lösen wollte, doch auch er kam, wie kein Mensch auf der Welt, nicht gänzlich ohne fremde Hilfe aus.
Die vier verabschiedeten sich per Handschlag und gingen in verschiedene Richtungen. Matthias ging nicht nur, er schritt wie ein Fürst – er hatte den offiziellen, vom Rat beschiedenen Auftrag erhalten, das neue Rathaus zu entwerfen. Er, der nicht einmal einen Titel wie Stadtmaler innehatte, wurde vom Rat als Architekt bezeichnet – sehr zum Leidwesen Elias’. Der Münchner Kunst- und Freskenmaler Johannes Matthias Kager war auf einmal dem großen Augsburger Stadtwerkmeister Elias Holl zum Konkurrenten geworden, wo dieser ihn bislang nur mehr als besseren Handlanger ausnutzte. Jetzt hatte sich ein nicht unwichtiges Blatt gewendet und Elias musste sehen, wie er damit umzugehen gedachte. Wo stand geschrieben, dass es alleinig an Elias war, zu entwerfen und zu konstruieren? Nur weil dieser bis jetzt alles an sich gerissen hatte und keinem, der unter ihm stand, die Chance ließ hochzukommen. Die viele Arbeit am Loggiaentwurf hatte sich also doch gelohnt. So enttäuscht er damals über die Ablehnung gewesen war, jetzt konnte er die Lorbeeren ernten. Er würde ein epochales Rathaus entwerfen, eines, das Elias vor Neid zergehen ließe. Elias würde nichts Großes, nichts Besonderes zuwege bringen. Er war ein guter Techniker, hatte sich viel angelesen und selbst beigebracht, doch was die Gestaltung anlangte, kupferte er doch schamlos alles von den großen welschen Meistern ab. Ein eigener Schöpfergeist wohnte ihm nicht inne. Joseph war gestorben, den konnte Elias nicht mehr fragen, und Welsers Worte über eine fruchtende Kooperation zwischen den Architekten war nur ein frommer Wunsch. Die reale Welt sah anders aus. Dass es Rosina so schlecht erging, dafür konnte Elias nichts, aber auch Matthias und Ibia hatten schlechte Zeiten. Nur wer solche durchzustehen imstande war, der zeigte, ob er fürs Leben taugte.
Je näher Matthias seinem Zuhause kam, umso weniger interessierte ihn Elias und umso euphorischer wurde er.
Ibia brauchte nicht einzuheizen oder sich besonders für ihn zurechtzumachen. Statt einem Schwall rauschhafter Worte, nahm er sie bei der Hand und führte sie in die Schlafkammer.
Seinen Faux-pas der gestrigen Nacht machte er mehr als wett.
14 Italienisch für heilige Unterredung. Bezeichnung für die Abbildung der Madonna mit dem Jesusknaben in Gesellschaft von zwei oder mehr Heiligen
15 Wilhelm V., Herzog von Bayern (1548 – 1626)
16 Die (Pural), das griechisch-römische Altertum als Basis der Bildung
17 Schleimer
18 »Lass das!«