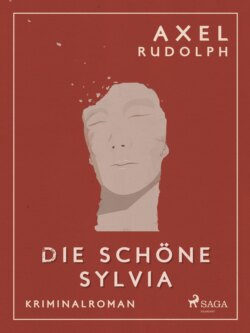Читать книгу Die schöne Sylvia - Kriminalroman - Axel Rudolph - Страница 5
2.
ОглавлениеEs ist doch viel schwerer, als sie gedacht hat. Sylvia Gauda dreht nervös an ihrem Kelchglas und wirft von der Seite verstohlene Blicke auf das Gesicht ihres Freundes. Hernando Las Feras wendet ihr sein Profil zu, sein klassisches Profil: Hochgewölbte Stirn, kühn geschwungene Nase, energisch modelliertes Kinn. Darunter sitzt eine tadellos gebundene weiße Schleife im weißen Frackausschnitt. Ein Kavalier, ein Gentleman, wie er auszusehen hat. Es ist wirklich nicht leicht, Hernando Las Feras zu beichten, was doch gebeichtet werden muß.
Sylvia hat trotz ihrer Jugend schon ihre Erfahrungen gemacht mit der Männerwelt. Ihre Schönheit hat manchen gelockt. Von Zudringlichkeit aber ist sie bisher verschont geblieben. Sie kennt die schüchternen oder tolpatschig draufgängerischen, die wohlerzogen zurückhaltenden und die harmlos ein wenig „angebenden“ Jungens ihrer Kreise. Weil sie der übrigen Männerwelt meist zu oberflächlich ist, hat Sylvia bisher — wie es ihrer eigenen Art entsprach — eigentlich nur harmlose Jungen, die gern als große Herren und gewiegte Lebemänner gelten wollten, wirklich kennengelernt. Bei Hernando Las Feras ist alles ganz anders.
Gerade die Offenheit, mit der er gleich zu Anfang von seinen Verhältnissen gesprochen hat, obenhin, wie ein Mann, der sich seines Wertes bewußt ist, auch wenn er keine Hunderttausende zur Verfügung hat, und der doch mit einer gewissen Ängstlichkeit bestrebt ist, keine falschen Ansichten über seine Verhältnisse aufkommen zu lassen — gerade das hat sie nur noch mehr für ihn eingenommen.
Seine Mutter ist eine geborene Fürstin Dolgoruki gewesen. Andere hätten vielleicht versucht, damit Eindruck zu machen, aber Feras hat es nur einmal leichthin erwähnt, mit einem nachsichtigen Lächeln, das über Adelsstolz und äußeren Glanz erhaben schien. Immer ist sein Gesichtsausdruck beherrscht, vornehm verhalten, überlegen. Nur einmal hat Sylvia Gauda dieses Gesicht dunkel gesehen vor Haß. Das war auch hier im Kaiserhof, sogar an demselben Tisch. Ein Herr war da eingetreten und hatte sich breit und aufdringlich an einen der kleinen Tische dicht unter dem Podium des Kabaretts gesetzt, ein Mann, dem der Abendanzug am Leibe saß wie ein unbequemer Panzer, ein Mann mit einem gemeinen, widerlich groben Gesicht.
„Wenn dieser — Herr da nicht wäre, könnten wir glücklich sein,“ hat Las Feras dann gesagt, und seine aristokratisch lange Hand hat sich auf dem Tischtuch geballt.
„Der da drüben?“ Sylvia hat überrascht den Mann angesehen und wiedererkannt. „Das ist merkwürdig. Der war neulich bei uns in der Bank. Ich mußte ihn beim Chef, bei Geheimrat Herkrath persönlich, melden. Er heißt … wart’ mal … es war ein russischer Name.“
„Er ist auch Russe. Es gab eine Zeit, da war er der Hausverwalter meiner Mutter.“
„Aber du sagst, wenn er nicht wäre …?“
Da hat Las Feras ihr zögernd die Geschichte erzählt:
„Seine Mutter war nach dem Tode ihres Mannes, kurz vor dem Kriege, in ihre russische Heimat zurückgekehrt. Beim Ausbruch der Revolution lag sie krank auf ihrem Landgut im Kaukasus. Alles wurde ihr von den Roten genommen, das Palais in Petersburg, das Landhaus, die Güter im Gouvernement Twer. Aber ihre Juwelen, besonders das kostbare Diadem, das noch aus der Zeit des Zarenbefreiers stammte, konnte sie in Sicherheit bringen. Selbst eine halbe Gefangene, hatte sie in den Tagen höchster Not die Juwelen dem Hausverwalter Jussow anvertraut, der sie außer Landes bringen sollte.
Da Ilina Feodorowna Dolgoruki durch ihre Heirat mit Las Feras portugiesische Staatsangehörige geworden war, hatte das große Blutbad sie verschont. Mit Hilfe der portugiesischen und englischen Gesandtschaft erhielt sie endlich die Erlaubnis, Rußland zu verlassen. Den Tod im Herzen, kam sie in Paris an, und wenige Monate später starb sie dort. Auch Jussow tauchte eines Tages in Paris auf, behauptete aber, von den Juwelen nichts zu wissen. Er habe zwar gewisse Wertstücke in Verwahrung, aber die seien ihm von dem Grafen Nebridow, einem Nachbarn der Fürstin Dolgoruki, anvertraut worden. Alle Versuche, ihn zur Herausgabe der Kostbarkeiten zu bewegen, blieben erfolglos. Jussow blieb bei seiner Behauptung und weigerte sich entschieden, die Sachen herauszugeben. Graf Nebridow aber konnte nicht mehr sprechen. Er schlief längst in irgendeinem Grab im fernen Rußland.
„Ich habe ein kleines Vermögen für Rechtsanwälte und Detektive ausgegeben,“ hat Las Feras düster geschlossen. „Es ist nichts zu machen. Ich habe keine Beweise, daß die Juwelen das Eigentum meiner Mutter sind. Und Jussow ist schlau wie ein Fuchs. Er hat anscheinend nur einige kleinere Stücke zu Geld gemacht, so daß er gerade davon leben kann. Die eigentlichen Wertstücke hat er vorläufig nicht angetastet. In Paris hat er sie zuerst beim ‚Credit Lyonnais‘ deponiert. Seitdem er nach Deutschland übergesiedelt ist, hat er — ich weiß das genau — ein Safe in der ‚Westbank‘ gemietet. Aber beizukommen ist ihm nicht. Könnte ich ihn zwingen, mein Eigentum herauszugeben, so … Ich selbst brauche keine Reichtümer. Ich pfeife auf das Geld, wenigstens auf das überflüssige Geld. Aber seitdem ich dich kenne, Sylvia, sehe ich rot, wenn ich nur an den Kerl denke. Hätte ich das Diadem meiner Mutter, so könnte ich dir das Leben bieten, auf das du Anspruch hast!“
Später haben sie noch manchmal davon gesprochen. Las Feras besaß ein kleines Bankkonto. Er wohnte im Hotel du Nord und lebte anständig, ohne großen Luxus. Aber Sylvia merkte, er litt unter dem Zwang, sich einschränken zu müssen, wenn er mit ihr zusammen war. Manchmal sprach er auch davon, daß er neue Versuche gemacht habe, zu seinem Recht zu kommen, daß aber sein Anwalt selbst so gut wie keine Hoffnung mehr gebe.
Hernando Las Feras war ein stattlicher Mann von vollendeten Formen, ein Mann, an dessen Seite man sich mit Stolz sehen lassen konnte. Sylvia zweifelte nicht, daß er sie liebte. Sylvia, die sonst ohne Schwierigkeit allzu zudringliche Huldigungen abzuwehren verstand, ist seinem Zauber rettungslos verfallen.
Las Feras ist ritterlich, zartfühlend und sucht ihr jeden Wunsch zu erfüllen, soweit er kann. Aber das ist es eben: Sie weiß, er kann nicht alles, was er will. Darum ist es so schwer, ihn um Geld zu bitten.
„Sehr gute Arbeit!“ Las Feras wendet einen Augenblick das herrische Gesicht von der Bühne ab und Sylvia zu. „Welche Summe von zäher Kleinarbeit, Fleiß und Energie steckt hinter diesen Akrobatennummern! Die Leute verdienen ihr Brot wahrhaftig im Schweiße ihres Angesichts.“
„Aber sie verdienen wenigstens.“ Sylvia hat, ihren eigenen Gedanken nachhängend, die Vorführung kaum beachtet. „Ich würde gern ebenso halsbrecherische Kunststücke machen, wenn ich dadurch viel Geld verdienen könnte.“
Las Feras lächelt nachsichtig. „Ich glaube, du überschätzt das Einkommen der Artisten, Liebe. Übrigens: Findest du das Programm mittelmäßig?“
„Nein. Warum?“
„Pardon, ich dachte, weil es dich anscheinend nicht interessiert. Oder hast du Unannehmlichkeiten gehabt?“
Nun ist es an der Zeit. Sylvia überlegt blitzschnell noch einmal, ob sie nicht doch lieber die Hilfe der Schwester annehmen soll. Es ist so beschämend, so erniedrigend, Hernando um Geld zu bitten. Aber eben jetzt sieht er sie so verständnisvoll gütig und besorgt an und — sekundenlang taucht das herbe Antlitz Helens vor ihr auf, die strengen Augen, der wahrhaftige Mund, der unumwunden jedes Ding ehrlich beim Namen nennt, ohne auf irgendwelche Gefühle Rücksicht zu nehmen. —
„Ich bin in einer verzweifelt peinlichen Lage,“ stößt Sylvia rasch hervor, als wollte sie sich selbst den Rückzug abschneiden. „Bitte, lies diesen Brief, Hernando!“
„Nicht sehr liebenswürdig in der Form,“ stellt Las Feras mit hochgezogenen Brauen fest und gibt Sylvia das Schreiben der Firma Bendler & Croy zurück. „Solchen Krämerseelen fehlt nun einmal jedes Taktgefühl. Aber ich nehme an, die Leute werden mit sich reden lassen.“
„Wie denn?“ Sylvia faltet in nervöser Hast den Brief wieder zusammen. „Ich habe leider keine Ahnung, wie ich die Rechnung begleichen soll.“
„Das ist doch sehr einfach. Du bist bei einer angesehenen Bank angestellt. Wenn deine monatlichen Abzahlungen auch naturgemäß nur gering sein können, wird sich die Firma lieber mit dir vergleichen, als die Schuld einklagen und dabei Gefahr laufen, gar nichts zu erhalten. Du brauchst den Leuten nur eine Sicherheit zu bieten, daß die Raten pünktlich gezahlt werden.“
„Was für eine Sicherheit denn?“
„Nun — etwa so, daß du die Firma ermächtigst, die Raten direkt von der Bank einzuziehen und dein Monatsgehalt damit zu belasten.“
„Dann müßte ich meinem Chef beichten!“ Sylvia flutet ein heißes Rot über die Wangen. „Das kann ich nicht, Hernando! Geheimrat Herkrath ist ein Ekel! Ich habe dir ja schon erzählt, wie er mich behandelt. Immer hat er etwas auszusetzen, zu mäkeln, zu knurren. Nicht einen freundlichen Blick hat er mir gegönnt, seitdem ich als Sekretärin in seinem Vorzimmer sitze. Wenn nicht Gerhard Lenneberg mich empfohlen hätte, wäre ich bestimmt längst entlassen!“
„Hm. Und Herr Lenneberg? Vielleicht, wenn du dich an ihn wendest …“
„Er würde schon helfen. Aber er würde auch sofort meine Mutter ins Vertrauen ziehen, und gerade das muß vermieden werden. Mutter darf unter keinen Umständen davon erfahren, daß ich … daß ich Schulden gemacht habe.“
„ Ja, dann … hm, dann wird es für dich allerdings schwer sein.“
„Ich habe gedacht,“ sagte Sylvia so leise, daß er ihre Worte mehr erraten muß, als er sie verstehen kann, „daß du mir helfen könntest, Fernando.“
Sie hält den Kopf tief gesenkt, spielt beschämt mit ihrer Serviette und sieht nicht das kurze, blitzhafte Aufleuchten in den Augen des Mannes. In der nächsten Sekunde hat Las Feras sein Mienenspiel wieder in der Gewalt. Ehrlich bekümmerte Anteilnahme liest Sylvia in seinen Zügen, als er antwortet:
„Das ist schön von dir, Sylvia. Ich danke dir für diesen Beweis deines Vertrauens. Überflüssig zu sagen, daß ich es rechtfertigen werde. Zwar — du kennst ja meine Verhältnisse — den ganzen Betrag kann ich dir im Augenblick leider nicht zur Verfügung stellen, wenn dir mit — hm — dreihundert Mark vorläufig gedient ist …“
Die Röte in Sylvias Antlitz wird noch tiefer. „Du machtest mir doch neulich eine Andeutung, daß deine Aussichten sich besserten und daß wir bald …“
Las Feras seufzt wehmütig. „Das war leider etwas voreilig von mir. Heute sieht meine Lage gar nicht so rosig aus. Die Hoffnung, von der ich dir neulich sprach, war Geheimrat Herkrath.“
„Mein Chef?“
„Ja. Ich hatte gestern eine Unterredung mit ihm. — In seiner Privatwohnung,“ fügt Las Feras hinzu, da ihm gerade noch einfällt, daß Sylvia jeden Besucher im Direktionszimmer selber anmelden muß. „Ich habe ihm meine Angelegenheit haarklein auseinandergesetzt in der Hoffnung, ihn dafür zu interessieren. Leider völlig vergebens. Dein Herr Chef zieht es vor, den Worten eines Herrn Jussow zu glauben.
„Das hätt ich dir vorher sagen können.“ Sylvia verzieht verächtlich den Mund. „Herkrath ist wirklich ein Ekel. Aber ich versteh’ nicht… was wolltest du von ihm?“
„Um dir das zu erklären, muß ich dich einmal mit meinen Privatangelegenheiten belästigen, so ungern ich das tue. Es gibt wohl erfreulichere Gesprächsthemen zwischen zwei Freunden als diese leidige …“
„Nein, nein, erzähle! Es interessiert mich natürlich.“
„Es könnte dich allerdings interessieren, wenn es glückte, denn unsere gemeinsame Zukunft hängt letzten Endes davon ab.“ Las Feras macht eine kleine Pause, bis der Ober die Weingläser gefüllt und sich zurückgezogen hat. „Also mir fehlt, wie ich dir bereits sagte, der positive Beweis dafür, daß die Kostbarkeiten, die dieser Jussow in Besitz hat, tatsächlich mein Eigentum sind. Ich habe indessen Grund zu vermuten, daß sich in der Kassette, die meine Mutter ihm seinerzeit übergeben hat, außer den Juwelen auch Familienpapiere und Briefe befinden, Papiere, verstehst du, aus denen klar hervorgeht, daß der Schmuck nicht, wie Jussow behauptet, von dem verstorbenen Grafen Nebridow, sondern von meiner Mutter stammt, Verzeihung, du wolltest etwas sagen, liebe Sylvia?“
„Ach, ich dachte nur eben … Ist es nicht wahrscheinlich, daß der Mensch diese Papiere, die ihn verraten können, längst vernichtet hat?“
„Es wäre von seinem Standpunkt aus das Vernünftigste. Aber man macht oft die Erfahrung, daß der geriebenste Schurke einmal eine bodenlose Dummheit begeht. Der Teufel mag wissen, zu welchem Zweck Jussow diese Dokumente noch benutzen möchte. Jedenfalls weiß ich durch einen Detektiv, daß die Kassette, die er in Paris deponierte, sowohl Schmuck wie Dokumente enthielt. Es ist kaum anzunehmen, daß er sie seither vernichtet hat.“
„Und was sollte mein Chef …?“
„Ich habe ihm, wie gesagt, meine Verhältnisse offen dargelegt. Ich hoffte natürlich, daß ich ihn veranlassen könnte, mir in seiner Gegenwart wenigstens einen Einblick in die Kassette des Herrn Jussow zu gestatten.“
„Das Safe eines Kunden öffnen!“ sagte Sylvia. „Wie konntest du glauben, daß Herkrath das tun würde!“
Las Feras zuckt die Achseln. „In meiner Lage, liebe Sylvia, greift man nach jedem Strohhalm. Nun, der Geheimrat Herkrath hat, wie du richtig vermutest, mein Ersuchen glatt abgelehnt. Ich muß sogar damit rechnen, daß er dem Halunken Jussow nun einen Wink gibt. Denn meine Bitte um Diskretion hat er ebenso schroff zurückgewiesen. Die Folge wird sein, daß Jussow nun wirklich die betreffenden Papiere vernichtet. Dann wäre für mich jede Hoffnung dahin, wenn ich im Glauben an mein gutes Recht nicht immer noch hoffen würde, wenigstens einen Menschen zu finden, der mir vertraut und der mir zu helfen bereit ist.“
„Und was willst du tun?“
Las Feras schönes Antlitz wird hart wie Stein. „Ich kämpfe bis zum äußersten um mein Recht und mein Eigentum. Gegen einen Gauner und Betrüger wie Jussow, der sich des schwersten Vertrauensbruches schuldig gemacht hat, scheint mir jedes Mittel erlaubt. Ich werde eben einen Versuch machen, auch ohne Einwilligung des Herrn Geheimrat Herkrath mir anzusehen, was Jussow in seiner Stahlkammer deponiert hat.“
„Du?“ Sylvia starrt ihn verständnislos an. „Wie willst du da möglich machen?“
„Gewalt gegen Gewalt, liebe Sylvia. Ich werde nach Paris fahren und einen Agenten beauftragen, einen erfahrenen — Fachmann zu engagieren, verstehst du, einen Mann, der es — gegen entsprechende Bezahlung — fertigbringt, sogar in eine Bank einzudringen und ein gewisses Safe zu öffnen.“
Hart und kalt funkeln Las Feras’ Augen. Mit einem Gemisch von Angst und Bewunderung sieht Sylvia zu ihm auf. „Um Gottes willen, Hernando! Du kannst doch nicht einen Verbrecher zu deinem Helfer machen!“
„Doch, ich kann es!“ sagt Las Feras leise und sehr eindringlich. „Vergiß nicht, daß ich nicht nur um mein Recht kämpfe, sondern auch um — dich!“ Unter den halbgesenkten Lidern schießt einer jener heißen Blitze hervor, die Sylvia schon so oft Herzklopfen verursacht. haben. „Gesetz und Polizei verweigern mir jede Hilfe. Also muß ich mir selbst helfen. Und — ich will ja nicht stehlen. Will niemanden schädigen! Ich will nur einem Halunken, den die Polizei nicht fassen kann, seinen Raub entreißen. Ich will nicht einmal nehmen, was mir gehört. Nur die Papiere will ich sehen. Kenne ich die, so kann ich vor den Behörden den Beweis führen, daß Jussow ein Lump und Betrüger ist. Alles Weitere ergibt sich dann auf ganz gesetzlichem Wege.“
„Aber es ist so unheimlich, Hernando!“
Er streichelt zärtlich ihre Hände. „Wenn ich nicht auch das Letzte versuche, Sylvia, dann wären alles Geld und alle Mühe, die ich daran gewandt habe, umsonst gewesen. Es bleibt mir nichts übrig, als den Weg zu Ende zu gehen. Ein schönes Stück Geld wird’s freilich kosten. Der Mann, der den Mut und dieFähigkeit hat, mir zu helfen, wird nicht billig sein. Auch der Agent, der mich mit ihm in Verbindung bringen soll, wird ziemlich viel Geld verlangen. Das ist der Grund, warum ich dir das alles überhaupt erzähle. Du wirst nun verstehen, daß ich mein ganzes kleines Kapital benötige, um diese verzweifelte Sache zu finanzieren, und mir nicht zürnen, wenn ich dir nicht so helfen kann, wie ich es gerne möchte.“
Die Musik setzt mit einem Tusch ein. Auf der Bühne feuert ein bekannter Komiker seine Pointen ab. Lachsalven dröhnen auf. Sylvia zieht wie im Schmerz die Brauen zusammen. Schal, läppisch, dumm erscheinen ihr die Witze, die der Komiker zum besten gibt. Wie kann sich ein Mann überhaupt hinstellen, Gesichter schneiden und alberne Witze machen! Ein Clown, ein Bajazzo! Aber Hernando, der ihr mit beherrschtem, entschlossenem Gesicht gegenübersitzt, das ist ein Mann! Einer, der sich nicht unterkriegen läßt, und wenn die ganze Welt gegen ihn steht! Einer, der weder Furcht noch Rückzug kennt!
„Wenn ich dir nur helfen könnte …sagt Las Feras überlegend, als der Komiker unter dem Beifall der Zuhörer abgetreten ist. „Wie gesagt, einige hundert Mark stehen dir zur Verfügung. Aber sonst — ich muß morgen nach Paris und die Sache in die Wege leiten, ehe es zu spät wird.“
Sylvia antwortet nicht. Sie hört nur das eine: Las Feras will fort. Morgen schon. Nur flüchtig streifen ihre Gedanken die Rechnung von Bendler & Croy. Das ist jetzt beinahe unwichtig! Da muß man eben doch in den sauren Apfel beißen und Helens Hilfe annehmen. Aber Las Feras? Ob er zurückkommt? Wenn sein Plan auf unüberwindliche Schwierigkeiten stößt, wenn er den Mann nicht findet, den er sucht? Es wird sicher nicht einfach sein, jemand aufzutreiben, der einen Einbruch in die Bank wagt. Wird Las Feras dann zurückkehren? Oder wird er mit seinen Hoffnungen auch seine Liebe begraben? Die Lichter ringsum scheinen vor Sylvias Augen zu flackern, grell, mißtönig ist das leise Klingen der Gläser. Vorbei! Grau und inhaltlos scheint die Zukunft, ohne all die Farben, die das Dasein lebenswert machen für ein Mädchen, wie Sylvia Gauda. Es wird nicht viel Schönes übrigbleiben, wenn Hernando fort ist. Acht Stunden tägliche Arbeit in der Bank, unter den Augen des gestrengen Geheimrat Herkrath! Keine Vergnügungen, keine lustigen Abende mehr! Schulmeisterliche Strenge der gräßlich nüchtern denkenden jüngeren Schwester! Auf lange Zeit an jedem Monatsersten ein Abzug vom Gehalt, der nur das Allernotwendigste übrig läßt! Und da ist ja nicht einmal nur die Rechnung von Bendler & Croy. Sylvia denkt mit Schrecken daran, daß sie noch andere Schulden hat, die bald bezahlt werden müssen: beim Friseur, in der Konditorei, bei der Hutmacherin. Kleine Beträge, aber zusammengerechnet ergeben sie wieder eine Summe, die zu neuen Demütigungen vor Helen und zu weiteren Einschränkungen zwingt. Aber das Schlimmste wäre doch, wenn Hernando nicht wiederkäme.
„Es gibt eine Möglichkeit …“ sagt Las Feras langsam, „eine Möglichkeit, dir sofort und gründlich zu helfen. Ich müßte meinen Plan allein durchführen, ohne Mitwirkung eines bezahlten Helfers.“
„Du? Wie meinst du das?“
„Ganz einfach, ich könnte das Geld, das ich für fremde Hilfe beim Besuch der Stahlkammer zahlen müßte, für dich frei machen.“
Sylvia schüttelt ungläubig den Kopf. „Es ist nicht so leicht, in die Stahlkammer der Westbank zu kommen.“ Trotz allem muß Sylvia fast lächeln, wenn sie sich den stolzen aufrechten Hernando als Einbrecher vorstellt. Las Feras aber lächelt nicht.
„Es hat schon etwas für sich,“ sagt er überlegend. „Sich einem Fremden anzuvertrauen, das wäre doch der letzte, verzweifelte Ausweg. Der Schlag kann mißlingen, der Einbrecher gefaßt werden. Dann würde so ein bezahlter Kerl natürlich seinen Auftraggeber glatt verraten und …“
Ein neuer Schreck durchzuckt Sylvia. Hernando verhaftet, von seinem „Mann“ preisgegeben, als Mitbeteiligter an einem versuchten Bankeinbruch angeklagt, vielleicht zu langer Freiheitsstrafe verurteilt — nein, das darf nicht sein! Hernando darf sich dieser Gefahr nicht aussetzen! Er muß seinen Plan aufgeben.
„Es ist nicht so leicht,“ fährt Las Feras halblaut fort. „Aber — unter Umständen wäre es doch möglich. Das betreffende Fach zu öffnen, traue ich mir schon zu. Die Schwierigkeit liegt nur darin, unbemerkt und ungehindert in die Stahlkammer zu gelangen. Dazu müßte man die Sicherheits- und Alarmvorrichtungen der Bank genau kennen, also einen Einblick haben, der mir natürlich vollkommen fehlt. Man müßte wissen, wo die Alarmvorrichtungen liegen. Weißt du, es gibt in jeder Bank einen genauen Plan dieser Vorrichtungen;“
„Ja, das stimmt,“ sagt Sylvia atemlos. „Geheimrat Herkrath hat erst kürzlich mit Dr. Rentz, seinem Sekretär, einige Veränderungen in diesem Plan besprochen.“
„So, so. — Und — dieser Plan liegt in seinem Geldschrank, ja?“
„Nein, im Privatbüro Herkraths, in einem Schreibtischfach. Aber — laß uns von etwas anderem reden, Hernando — oder denkst du etwa im Ernst daran, bei der Westbank — einzubrechen?“
Las Feras’ Antlitz verfinstert sich. „Wenn es sein müßte, ich würde auch das tun, um zu meinem Recht zu kommen, Sylvia. Aber es ist leider völlig ausgeschlossen. Ebensogut könnte ich den Versuch wagen, ohne Kenntnis der Alarmanlagen in die Stahlkammer einzudringen. Aber wenn ich — den Plan hätte! Sylvia! Dann wäre alles gut. Eine Zukunft, wie ich sie erträumt. Deine kleinen Läpperschulden — pah! Das Erbe meiner Mutter würde mich mit einem Schlage zu einem reichen Mann machen. Ich könnte zu deiner Mutter gehen und um deine Hand bitten. Und wenn sie mich abweisen sollte, ich würde dich auf meine Arme nehmen und mit mir forttragen, weit fort, in meine sonnige Heimat, Ich will dir den Platz im Leben geben, der dir gebührt, schöne, wundervolle, liebe Sylvia. Wenn wir in unserer Villa über den Palmen säßen, wenn wir auf unserer Jacht das blaue Meer durchkreuzten, würden wir lachen in der Erinnerung an diese graue, schwere Zeit, stolz und glücklich lachen: Zwei Menschen, die zusammen gekämpft haben um ihr Glück, gekämpft und — gesiegt! Sylvia —!“ Zwingend, strahlend senkt sich sein Blick in ihre Augen. Ganz nahe sieht Sylvia in sein kampffrohes Gesicht. Heiß und fordernd hört sie seine halblaute Stimme. „Verhilf mir zu dem Plan, Sylvia! So verhilfst du uns zu unserem Glück!“
Ein Glas fällt um und zerschellt klirrend am Boden. Dienstbeflissen steht der Ober mit einem neuen Glas vor Sylvia. Ein rotbefrackter Page fegt schnell die Scherben auf. Wie im Traum sieht Sylvia, daß Hernando mit der Lässigkeit eines großen Herrn die Rechnung begleicht und den Pagen fortschickt, die Garderobe zu holen; wie im Traum hört sie seine halb bittende, halb befehlende Stimme:
„Wir wollen gehen, Sylvia. Es spricht sich nicht gut über so ernste Dinge, hier in dem Lärm und Trubel.“
Ihre Knie zittern leicht, als sie schweigend vor ihm her durch die Tischreihen dem Ausgang zuschreitet. Furchtbar häßliche und furchtbar schöne Bilder flattern im Nebel vor ihren Augen: Hernando als Einbrecher, Hernando mit Handschellen gefesselt, Helen zählt streng und schulmeisterhaft die Geldscheine, die Sylvia ihr zaghaft reicht, der Geheimrat Herkrath wirft ihr schroff einen Stoß Briefe auf den Tisch, Hernando hockt verzweifelt, arm, als Bettler irgendwo am Wege, ein weißes Schloß, umrauscht von Palmenkronen, Dienerschaft, ein mächtiger, nagelneuer Rennwagen, zwei Menschen auf einer breiten, marmorglänzenden Terrasse, sonnenüberstrahlt, glücklich — Hernando und Sylvia — Sylvia Las Feras.
„Wir müssen noch einmal darüber sprechen.“ Im Flur, der zur Straße hinausführt, faßt Las Feras ihren Arm, preßt ihn heftig an sich. „Das Geld für deine Rechnung geb’ ich dir heut’ abend noch. Ich weiß, daß du mir helfen wirst. Um unserer Zukunft willen!“
*
„Die Zeit ist um, Sylvia.“ Helen vertritt mit ernstem Gesicht ihrer Schwester den Weg, die fröhlich trällernd in ihrem Zimmer verschwinden will. „Du wolltest mir doch heute abend Bescheid sagen.“
„Bescheid sagen? Wieso?“
„Bitte, spiel nicht die Unwissende, Sylvia! Heute mittag, als ich heimkam, warst du schon wieder fort, ohne etwas für mich zu hinterlassen. Jetzt ist’s bald Mitternacht. Seit zwei Stunden warte ich auf dich. Die Sache muß doch in Ordnung gebracht werden. Ich nehme an, daß du damit einverstanden bist, daß ich morgen zu Bendler & Croy gehe?“
„Ach so, das meinst du!“ Sylvia öffnet ihr Täschchen und kramt ein Papier hervor. „Wie du siehst, ist die Angelegenheit bereits erledigt.“
„Betrag dankend erhalten?“ Helen sieht überrascht auf und mustert argwöhnisch noch einmal Unterschrift und Firmenstempel der Empfangsbescheinigung. „Du hast die ganze Rechnung bezahlt? Woher hast du denn …?“
Sylvia lacht herzlich, wie über einen wohlgelungenen Streich. „Nicht so neugierig sein, liebe Helen. Wie du siehst, sind deine Sorgen jetzt überflüssig. Meine Schulden sind bezahlt. Und gestohlen habe ich das Geld ganz gewiß nicht!“
„Das hab’ ich auch nicht angenommen … So ist das also!“ Helen blickt traurig zu Boden. Eine Hoffnung, die sie sich nie eingestanden hat, die aber nicht vergehen wollte, sinkt endgültig ins große Nichts. „Du wirst dich — bald — verloben, Sylvia?“
„Vielleicht werde ich sogar bald — heiraten! Gute Nacht, Helen!“
Mit einem unbeschwerten Lächeln nickt Sylvia ihrer Schwester zu. Dann verschwindet sie in ihrem Zimmer.