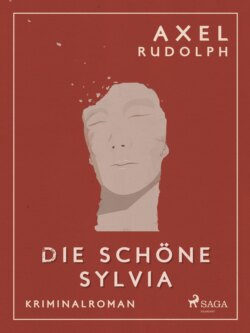Читать книгу Die schöne Sylvia - Kriminalroman - Axel Rudolph - Страница 6
3.
ОглавлениеHerbert Rohde und Helen, die eben aus der Tür getreten sind, grüßen, sich umwendend und winkend, noch einmal zu dem Atelierfenster ’hinauf, hinter dem Valerie mit Gerhard Lenneberg steht.
„Herbert Rohde ist wirklich ein ungewöhnlich netter junger Mann.“ Frau Gauda schaut den beiden nach, die im ’gleichen Schritt wie gute Kameraden nebeneinander die Straße entlang gehen. Auch Lenneberg sieht den jungen Leuten nach. Es liegt etwas Gemeinsames, Verbundenes in diesem raschen, gleichmäßigen Schreiten.
„Mir scheint, Helen und der junge Rohde verstehen sich ausgezeichnet.“
„Kameradschaftlich, ja, “lächelt Frau Gauda. „Vielleicht könnte man sogar sagen: geschwisterlich.“
„Nicht mehr?“ Nun lächelt auch Lenneberg. „Der junge Rohde kommt oft zu euch ins Haus, nicht wahr?“
„Nicht oft. Ich sehe ihn höchstens alle drei Wochen einmal. Aber er ist viel mit den Kindern zusammen, mit Helen im Tennisklub und mit Sylvia — ja, ich vermute, daß er mit Sylvia noch viel öfter zusammenkommt.“
„Du vermutest?“
„Erwachsene Töchter haben immer ein kleines Geheimnis vor der Mutter. Sylvia braucht nicht zu wissen, daß ich es längst durchschaut habe. Darum frag’ ich sie auch selten, wo sie ihre Abende verbringt. Bis sie eines Tages von selber zu mir kommt und mir das große Geheimnis anvertraut.“
„Also Sylvia?“ Lenneberg ist überrascht. „Ich hatte den Eindruck, daß Helen …“
„Keine Spur, Gerhard. Helen ist zwar zuerst mit dem jungen Rohde bekannt geworden, beim Tennisspielen. Aber daß er nur für Sylvia Augen hat und nur ihretwegen zu uns kommt, das sieht ein Blinder. Er ist wirklich ein netter Junge.“
Lenneberg nickt ernst. „Und mehr als das! Er ist ein besonders fleißiger und tüchtiger Arbeiter. Ich war nicht sehr erbaut davon, daß der Sohn meines alten Freundes Rohde als Volontär in unser Werk kam, aber ich bin da angenehm enttäuscht worden. Der junge Rohde arbeitet mit einem Ernst und einem Eifer, als hätte er es wirklich nötig.“
„Ich freue mich, Gerhard, daß du ihm ein so gutes Zeugnis ausstellst.“
„Es wäre ungerecht, mit dem Lob hinter dem Berge zu halten. Ein junger Mensch, einziger Sohn und Erbe des verstorbenen Bankiers Rohde, ein im Überfluß aufgewachsener Bursche, der das Geld seines Vaters nicht zum Fenster hinauswirft, sondern so lebt, als ob er sich das Leben verdienen müßte, so ein junger Kerl hat Anspruch auf Anerkennung.“
„Um so mehr freue ich mich für Sylvia.“
Lenneberg stimmt entschieden zu. „Ich bin überzeugt, daß Sylvia an der Seite des jungen Rohde wohlgeborgen sein würde. Sein ernster Charakter würde vielleicht ihre manchmal etwas oberflächliche und unbedachte Jugend im Zaum halten.“
Während Frau Valerie und Lenneberg diese Ansichten austauschten, drückte Helen auf dem Bahnhofsvorplatz dem jungen Rohde kräftig die Hand.
„Wiedersehen, Herbert. Ich muß machen, daß ich meinen Zug kriege. Langenberg wartet nicht.“
Herbert Rohde sieht ihr nach, wie sie leichtfüßig die Stufen zum Bahnsteig emporspringt, und freut sich über die natürliche Anmut, die ungewollt in jeder Bewegung Helen Gaudas liegt. Dann fährt er mit der „Linie 14“ zu den Tennisplätzen am Zoo hinaus. Umziehen in der Kabine, ein paar rasche Trainingsspiele, nachher noch eine gemütliche Stunde im Klubhaus. Eines der Vorstandsmitglieder, der Oberstleutnant a. D. von Paffroth, ladet den jungen Rohde ein, den Abend in seiner Familie zu verbringen. Herbert Rohde erscheint drei Stunden später im Hause Paffroth. Sein Anzug ist untadelhaft, ohne überelegant zu sein. Die Blumen, die er der Frau des Hauses mitbringt, sind ausgesucht, ohne zu protzen. Die Paffroths stellen im stillen wieder einmal fest, daß Herbert Rohde „tadellose Schule“ ist, obwohl diese Feststellung durchaus nichts Neues bedeutet. Im Tennisklub, im alten Bekanntenkreis seines Vaters, überall, wo Herbert Rohde verkehrt, herrscht die gleiche wohlwollende und achtungsvolle Ansicht über ihn. Der Bankier Johannes Rohde ist ein angesehener Mann gewesen. Er hat sich zwar schon Jahre vor seinem Tode vom Geschäft zurückgezogen, aber niemand zweifelt daran, daß er sein Schäfchen damals ins Trockene gebracht hatte. Man hat zu viel Takt, um geradezu danach zu fragen, aber Kenner der Rohdeschen Familie schätzen das Erbe, das Johannes Rohde seinem einzigen Sohn hinterlassen hat, auf mindestens eine halbe Million. Um so liebenswerter wirkt die Einfachheit und Bescheidenheit des jungen Erben. Herbert Rohde arbeitet zwar, wie Lenneberg sagt, so eifrig und ernsthaft, als ob er es nötig hätte, aber ohne sich durch allzu starke Betonung seiner Werktätigkeit seinen ursprünglichen Kreisen zu entfremden. Herbert Rohde lebt anständig, aber nicht auffallend. Er ist immer gut gekleidet wie jeder andere junge Mann aus guter Familie, er spielt Tennis und ißt ab und zu im Klubhaus. Er schließt sich auch keineswegs aus, wenn die „Jungen“ im Klub mal einen lustigen Bummel oder ein kleines Zechgelage veranstalten. Aber er wirft nicht mit Sektflaschen um sich, schafft sich keinen hundertpferdigen Mercedes an und prahlt nie mit dem Geld seines Vaters. Alles an ihm ist ruhig, anständig und verläßlich. Der junge Rohde hat es nicht nötig, sich durch große Geldausgaben Geltung zu verschaffen. Man weiß auch so, wer er ist, und achtet ihn. Doch schließlich ist Herbert Rohde weder ein Duckmäuser noch ein überlegener alter Mann, sondern ein lebenslustiger junger Mensch von dreiundzwanzig Jahren. Trotzdem behält er seine vornehm-bescheidene Lebensweise bei, und das hat ihm die aufrichtige Achtung seines ganzen Bekanntenkreises erworben.
Daß der Bankier Johannes Rohde in der Inflationszeit sein Vermögen hat hinschmelzen sehen, daß sein Sohn bei der Öffnung des Testaments feststellen mußte, daß ihm nur ein ganz kleines Kapital blieb, daß Herbert Rohde zu Hause oft genug mit Kartoffelpuffern oder einer kleinen Bockwurst als Abendessen vorliebnehmen und sich auf das äußerste einschränken muß, um wenigstens nach außen hin diese bescheiden-vornehme Lebensweise aufrecht zu erhalten, daß weiß außer dem alten Notar Lerch und Herbert selbst niemand.
*
Auch Hernando Las Feras weiß davon nichts. An einem Abend, wenige Tage nach dem entscheidenden Gespräch mit Sylvia, bringt er klug und bedächtig das Gespräch auf Herbert Rohde. Sylvia lacht herzlich auf, als er den Namen erwähnt.
„Du bist doch nicht eifersüchtig, Hernando ? Der gute Herbert ist zwar ein lieber Junge, aber nicht mein Typ. Wenn du Wert darauf legst, brech’ ich den freundschaftlichen Verkehr mit ihm unter irgendeinem Vorwand ab.“
Las Feras betrachtet nachdenklich seine gepflegten Fingernägel. „Im Gegenteil, Liebe, ich möchte dich bitten, diesen Verkehr noch intensiver als bisher zu pflegen.“
„Mit Herbert Rohde? Warum das? Mir liegt nicht das geringste an ihm.“
Las Feras Hand tastet einen Augenblick wie liebkosend über seine Brusttasche, in der ein zusammengefaltetes Papier leise knistert. „Es hat seinen Grund, Sylvia. Du sprachst gestern davon, daß du deinen Urlaub in Westerland verbringen willst.“
„Aber natürlich doch mit dir, Hernando! Was hat Herbert Rohde damit zu tun?“
„Ich bin unabkömmlich. Du weißt doch, Sylvia: die Vorbereitungen. Es wäre unverantwortlich gegen uns beide gehandelt, wenn ich jetzt auch nur einen Tag an etwas anderes denken würde als an — unsere Zukunft.“
„Schade.“ Sylvia seufzt ein wenig. „Ich hatte mich auf Westerland so gefreut. Endlich einmal hier heraus, endlich mal ein bißchen aus dem vollen …“
„Daß ist eben der Punkt,“ unterbricht Las Feras sie mit ernstem Gesicht. „Es liegt nicht in deiner Art, auf die Dauer zu verheimlichen, daß du — Geld hast.“
„Findest du das schlimm, Hernando?“
Ein zärtlicher Blick trifft Sylvia. „Ich möchte dich gar nicht anders, Liebe. Du bist geschaffen, auf den Höhen zu leben. Aber zurzeit hat das noch eine gewisse Gefahr.“
„Für mich?“
„Nein, für mich und für uns, Sylvia. Es wäre immerhin möglich, daß deine — sagen wir — eigenmächtige Handlungsweise in der Bank vorzeitig entdeckt würde.“
Sylvia lachte sorglos. „Kein Gedanke, Hernando. Der Plan liegt ja wieder an seinem Platz. Niemand kann ahnen, daß er einen halben Tag lang — ja, so! Davon sollte ich ja ‚kein Wort über die Lippen’ bringen.“
„Es freut mich, Sylvia, daß du meine Ratschläge gewissenhaft befolgst, wie dies für das Gelingen unseres Planes unbedingt erforderlich ist. Ich hoffe, du wirst auch die Zweckmäßigkeit des Rates einsehen, den ich dir jetzt geben will.“
Das ernste Gesicht des Freundes macht Sylvia ein wenig kleinlaut. „Bitte, Hernando. Du weißt, daß ich dir unbedingt folge.“
„Das mußt du, wenn der Erfolg nicht in Frage gestellt werden soll. Also bitte, hör zu! Selbst wenn es mir gelingen sollte, bereits in kurzer Zeit die Beweise gegen Jussow in die Hand zu bekommen, so werden immer noch einige Tage, vielleicht Wochen, vergehen, bevor ich mit ihrer Hilfe das Ziel erreiche. Verschwinden aber die Briefe aus dem Safe, so wird es für die Bankleitung ein Leichtes sein festzustellen, daß sie nur von jemand entwendet sein können, der mit allen Alarmvorrichtungen völlig vertraut war. Der Verdacht wird sich also gegen diejenigen richten, denen der Plan zugänglich war. Das sind, wenn ich dich recht verstanden habe, nur der Geheimrat Herkrath selbst, du, meine Liebe, und die beiden Mitdirektoren der Bank.“
„Und Dr. Rentz, der Sekretär!“
„Meinetwegen. Man wird genau nachforschen, ob sich im Privatleben der Betreffenden ein Anhaltspunkt ergibt. Man wird im Zuge dieser Nachforschungen schnell feststellen, daß die Sekretärin, Fräulein Gauda, in der letzten Zeit größere Geldausgaben gemacht, in Westerland im ersten Hotel gewohnt hat und so weiter — und man wird von dir den Nachweis verlangen, woher du das Geld dazu hast.“
Sylvia sieht nervös auf. „Glaubst du wirklich, daß …?“
„Ich glaube, daß es für uns beide sehr unangenehm werden könnte, wenn man hinter gewisse Ausgaben käme, die sich mit deinem Gehalt nicht vereinbaren ließen. Andererseits will ich nicht, daß du darunter leiden und dich einschränken sollst. Die Summe, die ich durch deine Hilfe erspare, steht zu deiner Verfügung, wie wir vereinbart haben. Nur — brauche sie mit Verstand!“
„Ja, Hernando. Ich werde also die schöne Reise nach Westerland aufgeben.“
„Und dafür hier in Köln Ausgaben machen! Nein, Sylvia, du bist gar nicht imstande, im Besitz größerer Mittel so unauffällig zu leben, wie es erforderlich wäre. Du sollst es auch nicht. Fahr du ruhig nach Westerland, und lebe, wie es dir paßt, aber — veranlasse diesen Herrn Rohde, dich zu begleiten!“
„Herbert? Du sprichst in Rätseln, Hernando!“
„Durchaus nicht. Soviel ich weiß, ist dieser Herbert Rohde reich?”
„Ja. Als einziger Erbe seines Vaters …“
„Des Bankiers Johannes Rohde,” nickte Las Feras. „Du siehst, ich weiß Bescheid. Die Folgerung ist einfach: Wenn man wirklich eines Tages deinen Spuren nachgeht, so wird man nur herausbekommen, daß du mit dem jungen Rohde in Westerland warst. Darin wird niemand etwas Verdächtiges finden, denn man wird ohne weiteres annehmen, daß selbstverständlich Herr Rohde als dein Kavalier die Ausgaben bestritten hat.”
Sylvia schweigt eine Weile. Ihre Sorglosigkeit und ihr blinder Glaube haben sie bisher über alles andere hinweggleiten lassen. Hernando wird sein Ziel erreichen, durch den verzweifelten Vorstoß endlich in den Besitz seines Eigentums gelangen. Hernando selbst ist in seiner Sache so sicher, daß er unbedenklich ihr nicht nur den Betrag zur Deckung der Schulden, sondern die ganze Summe gegeben hat, die er seiner Behauptung nach durch ihre Hilfe einspart. Es ist schön, wunderschön, so viel Geld zu haben! Die großen und kleinen Schulden sind bezahlt. Sylvia braucht nicht mehr ängstlich mit ihrem Gehalt zu rechnen, kann an Anschaffungen denken, an eine Badereise — sorglos und vergnügt hat Sylvia Gauda die letzten Tage verlebt. Erst in dieser Stunde steigt bei den ernsten, eindringlichen Worten Hernandos eine leichte Unruhe in ihr auf.
„Meinst du wirklich, daß man — mir nachspionieren wird?“
Las Feras zuckte die Achseln. „Vorläufig ist das schwerlich anzunehmen. Was ich dir rate, ist nur eine Vorbeugungsmaßregel zu unserer erhöhten Sicherheit. Hoffentlich gelingt es dir, deinen Freund Rohde zu der Fahrt zu überreden.”
Nun lacht Sylvia wieder unbekümmert. „Es wird nicht schwer fallen, Hernando. Der Junge ist sehr verliebt in mich. Du würdest also — trotzdem — damit einverstanden sein, daß er mich nach Westerland begleitet?”
Stolz und zärtliches Vertrauen liegen in seinem Blick. „Ich bitte dich, Sylvia! Wir beide wissen, daß wir zusammen gehören, wir sind doch wohl über Anwandlungen kleinlicher Eifersucht erhaben.”
„Also gut, ich werde mit Herbert sprechen. Er wird vor Freude kopfstehen, wenn ich ihm den Vorschlag mache, mit mir zu reisen.”
„Ich danke dir, Sylvia. Und noch eines: Was du auch in der nächsten Zeit zu tun beabsichtigst, sei es auch die geringste Kleinigkeit — unternimm nichts, ohne dich vorher mit mir darüber verständigt zu haben! Alles hängt davon ab.”
Wieder ist die Stimme Las Feras’ so ernst, daß auch Sylvias vergnügtes Gesicht unwillkürlich den Ausdruck wechselt.
„Ja, Hernando, ich werde alles genau so tun, wie du es für richtig hältst. Aber jetzt muß ich fort! Fünf Minuten vor zwei! Ich werde kaum noch rechtzeitig in meinen Laden kommen. — Das wird eine Wohltat sein, wenn ich nicht mehr an diese Sklavenarbeit gebunden bin!“
*
„Ich wünsche größere Pünktlichkeit, Fräulein Gauda. Ihre Arbeitszeit beginnt um zwei Uhr, nicht um zwei Uhr zehn!“
Geheimrat Herkrath ist groß und gewichtig, die harten Augen voll Vorwurf auf die Sekretärin gerichtet, in der Tür des Vorderzimmers zu seinem Privatbüro stehengeblieben. Sylvia senkt den Kopf über einen Stoß Briefe und antwortet nicht, aber eine unwillige Röte färbt ihre Wangen. Zehn Minuten. Wie kleinlich, deswegen aufzubegehren! Zu dumm, daß der Chef gerade durch das Vorzimmer kommen und ihren Platz leer finden mußte!
Zu allem Überfluß kommt dann, als Herkrath bereits in seinem Arbeitszimmer verschwunden ist, der Sekretär Dr. Rentz noch einmal darauf zu sprechen.
„Pünktlichkeit ist das Steckenpferd des Geheimrats. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, Fräulein Gauda, so sorgen Sie dafür, daß er gerade in diesem Punkt keinen Anlaß zum Tadel erhält!”
Das ist zuviel für Sylvia. Den Kopf hebend, blitzt sie den Sekretär zornig an. „Danke, Herr Doktor. Mit Ratschlägen bin ich versehen.”
Ärgerlich geht Dr. Rentz hinaus. Er hat es gutgemeint, und diese Antwort ist eigentlich eine grobe Ungehörigkeit. Aber — dieses Fräulein Gauda scheint ja so etwas wie ein Protektionskind zu sein, von dem Industriellen Lenneberg persönlich empfohlen. Und Dr. Rentz ist noch jung, erst seit einem Jahr hat er den verantwortungsvollen Posten als Sekretär des Geheimrat Herkrath. Da ist es besser, zu schweigen.
Abschriften, Telefonate, Anmeldungen — um vier Uhr kommt Geheimrat Herkrath noch einmal durch das Vorzimmer — schon in Hut und Überzieher und anscheinend ausnehmend gut gelaunt. Vielleicht wünscht er, seine Schroffheit von vorhin wieder auszugleichen, denn er bleibt vor dem Tisch der Sekretärin einen Augenblick stehen.
„Wie war das doch…? Richtig, Sie wollten ja Ihre acht Tage Urlaub nächsten Monat antreten. Fräulein Gauda. Ich habe nichts einzuwenden. Dann erholen Sie sich gut bei Muttern!”
Ekelhaft, diese unfeine Ausdrucksweise Herkraths — denkt Sylvia und antwortet fast ein wenig von oben herab: „Ich fahre nach Westerland, Herr Geheimrat.”
„Soso, ausgerechnet nach Westerland. — Ich würde ja lieber in ein ruhigeres Bad gehen.”
„Ich fahre mit einem Bekannten,” fügt Sylvia hinzu. „Mit Herrn Rohde, dem Sohn des …”
„Ihre Bekanntschaften interessieren mich nicht weiter,” brummt Geheimrat Herkrath. „Guten Abend, Fräulein Gauda!”