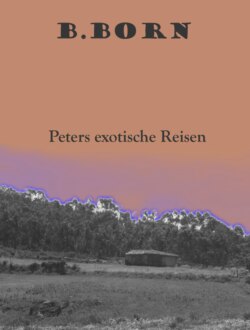Читать книгу Peters exotische Reisen - B. Born - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 Erster Tag (Donnerstag, der 1. August)
Wenn ich etwas gar nicht leiden kann, ist es reisen. Ich hasse das Gewarte, das Fahren oder Fliegen, das Herumtragen von Gepäck, einfach alles. Reisen ist für mich entblößend, so als hätte ich auf dem Weg zur Arbeit vergessen, meine Hose anzuziehen und es erst in der U-Bahn bemerkt, weil alle mich anstarren. Kaum hat man einen Rucksack oder einen Koffer dabei, ist man halbnackt. Dass neuerdings alle Koffer uniform sind, nützt kaum etwas, denn das Outfit eines Menschen mit dem Stempel ‚Reisender‘ im Gesicht, wird genaustens analysiert und es lässt sich wirklich viel Privates an ihm ablesen. Die Reisekleidung ist ebenfalls verräterisch. Für den Flughafen zum Beispiel ist sie praktisch gehalten, aber nicht zu alt und relativ schick. Die Socken haben garantiert bei keinem Flugreisenden Löcher, da man vielleicht die Schuhe ausziehen muss. Beobachtet man Reisende, kann man sofort erkennen, ob sie ihre Reise antreten oder sie zu Ende ist. Wenn sie gerade abreisen oder ihr Ziel erreichen, wirken sie unsicher und nervös, haben ein Luchsauge auf ihre Sachen und das Gepäck, denn es sind die Stücke, die normalerweise in irgendwelchen Schubladen zu Hause schlummern. Auf dem Rückweg sind sie ausgelassen oder müde, etwas abgeranzt und leicht abwesend, weil sie schon an Zuhause denken.
Die U-Bahnfahrt zum Flughafen Heathrow war in vielerlei Hinsicht zäh. Mir gegenüber saß ein kleiner Mann, der eine Uhr aus blankem Kupfer trug, die nicht nur wegen des Materials surrealistisch an ihm wirkte, sondern weil sie so überdimensional groß war, dass sie weit über sein Handgelenk hinausragte und schlackerte.
‚Ein Mann, der Uhr ist, sonst nichts‘, dachte ich. Die Fahrt dauerte zwei Stunden. Durch die Innenstadt war die U-Bahn voll, so voll, dass Marlis und ich unseren Sitzplatz an Bedürftige hergeben mussten. Als sie im Westen Londons draußen fuhr, saßen wir auf der Sonnenseite und die Sonne brannte uns gebündelt auf den Pelz. Neben Marlis saß eine chinesische Familie. Der Vater fotografierte jedes Detail im Inneren der Bahn, jede Station und natürlich auch uns, erst mit der Kamera in seinem Handy und anschließend noch einmal mit einer digitalen Spiegelreflexkamera, zwischendurch laufend seinen Sohn etwas fragend, da er von moderner Technik anscheinend überfordert und verunsichert war. Die Mutter dachte wohl an nichts.
In Heathrow angekommen und die Strapazen des Eincheckens hinter uns gebracht, lechzte Emil nach ‚Fish and Chips‘, da es dieses Gericht in Galicien ja nicht gäbe. Wir steuerten also die ‚Bridge-Bar‘ an. Eine zickige Kellnerin bremste uns, da sie uns den Platz erst anweisen wollte. Das erlaubten wir ihr halt notgedrungen, aber sie interviewte uns zuvor genauestens, ob wir auch wirklich zu speisen gedächten. Woraufhin ich, um sie zu ärgern, ausweichend Antwort gab, in der Art, dass wir uns vielleicht ein Mahl teilen wollten. Schließlich gewährte sie uns einen Platz in einer unschönen Ecke. Der ‚Asphall-Cider‘ (‚Asphall‘ ist ein alter Familienbetrieb für Apfelwein und Apfelessig aus der Grafschaft Suffolk), den man eiskalt sehr gut ertragen kann, der aber warm, wie jeder Cider, klebrig und eklig ist, war völlig unverständlicherweise tatsächlich nicht kalt. Da wahrscheinlich keine kühlere Version, als die gerade servierte zu bekommen war, kühlten wir ihn mit den Eiswürfeln, aus der Cola, mit der wir unseren ersten Durst gestillt hatten und die zu 90 Prozent aus Eiswürfeln bestanden hatte. Die honigmarinierten Hühnerbeinchen die Marlis probieren wollte, waren jedoch ganz anständig. Ein Mann in unserer Nähe forkte in der Panade seines Fischs herum, als wäre es eine Schuhsohle, was mich an unsere einschlägigen Erfahrungen in Lowestoft erinnerte. Emil dagegen haute rein.
Der Flieger war dann ein Stündchen zu spät. Aber die spanische Billiggesellschaft war verglichen mit ihren Konkurrenten sehr human. Es gab Platzkarten und Familien mit Kindern wurde beim Einsteigen sogar Priorität eingeräumt, wodurch das Geschubse wegfiel. Da konnte man nicht meckern, allerdings ließ das graugelbe Design stark zu wünschen übrig.
Der kleine Flughafen von A Coruña erinnerte stark an den Flughafen von Valencia, auf dem wir vor zwei Jahren wegen einer irischen Billig-Fluggesellschaft einen ganzen Tag hatten zubringen müssen. Das Flugzeug hatte einen Defekt gehabt und die Fluggäste hatten vom Morgen bis zum späten Abend warten müssen, bis eine Maschine eingetroffen war, die zunächst ihre planmäßigen Flüge zwischen Frankreich und London absolviert hatte, worüber man natürlich nicht informiert worden war. In dieser langen Zeit war es nicht erlaubt gewesen, das Flughafengelände zu verlassen und weil die Fluggäste keine Sitznummern hatten, hatten sie stundenlang, auf dem Boden sitzend, stehend oder liegend, in einer langen Schlange vor dem Schalter für den Flugsteig gewartet. Im Laufe des Tages wurde aber drei mal dieser Flugsteig geändert und die Menschen waren wie eine wildgewordene Rinderherde zu dem neuen Ausgang gehechtet, weshalb sich die Schlange jeweils von hinten nach vorne sortiert hatte. In dieser Zeit plante diese Fluggesellschaft sogar sich mit weiteren schrulligen Ideen, wie Stehplätze in den Fliegern und Geld für Toilettengänge, bei den Kunden noch unbeliebter zu machen.
Die schon umgesetzten Ideen, wie Lotterien beim Fliegen, skurrilen Selbstbeklatschungen vom Band, wenn der Flieger pünktlich gelandet war (oder weil er gelandet war?) und anderen konstanten Werbe-Lärmbelästigungen trieben einen sowieso schon konstant zur Verzweiflung.
Wir hatten jedenfalls den ganzen Tag in einem kleinen Café zugebracht, was mit dem damals erst sechs Jahre alten Sohn einige Strapazen mit sich gebracht hatte. Auf dem Rückflug hatten wir auch tatsächlich nicht zusammen sitzen können. Glücklicherweise hatte ein Fluggast sich erbarmt und Emil bei Marlis sitzen lassen.
Überhaupt hatte mich der Kurzurlaub in Valencia einige Nerven gekostet, da die Freunde, die wir besucht hatten, zwei sabbernde Vierbeiner und viel zu viel Zeit hatten, um sich um uns zu kümmern. Ein konstanter Wind, wie er wahrscheinlich im Frühling für Valencia ganz üblich ist, hatte die ganze Zeit Sand vom Meer in unsere Gesichter geschleudert und wie eine Sandstrahlmaschine meine Nerven bloßgelegt.
Wir verließen also das Flughafengebäude und verhandelten kurz mit einem Taxifahrer, der 70 Euro bis Malpica de Bergantiños vorschlug und wozu wir zähneknirschend einwilligten.
Der Fahrer, in einem blau, weiß und schwarz gestreiften T-Shirt ließ sich nochmals bestätigen, dass wir wirklich bis nach Malpica mit dem Taxi fahren wollten, dann warf er irgendwelche Unterlagen vom Beifahrersitz auf seinen Schoß, wo er sie ließ, obwohl es eine beträchtliche Behinderung der Fahrbequemlichkeit darstellen musste. Dicke blauschwarze Wolken türmten sich auf. Die nagelneue Autobahn, die tief in die Landschaft gefräst worden war, führte durch einen smaragdgrünen Wald, der an den Seiten weit oben auf den Felsen wuchs. Ich sah das Meer, es spiegelte kein Licht, war tiefblau wie ein Loch.
Es wurde dämmerig, was den Fahrer dazu veranlasste, laufend das Fernlicht an- und abzuschalten. Ich mutmaßte, dass er extrem nachtblind war. Das Fernlicht bewirkte aber nur, dass die entgegenkommenden Fahrer geblendet wurden. Beunruhigt beobachtete ich, was er so tat, bis er tatsächlich um ein Haar auf ein Auto auffuhr. Ich hatte schon: „Careful!“ gerufen und mich mit den Händen am Armaturenbrett festgehalten, als er gerade noch voll bremsen und neben das Auto, das banal wegen einer Kreuzung angehalten hatte, lenken konnte.
Wir erreichten Malpica, ein kleiner Ort, der auf einer felsigen Landzunge liegt. Auf der rechten Seite ist ein funktionierender Hafen und auf der linken ein brauchbarer Stadtstrand.
Auf dem Hauptplatz wählte ich auf meinem Handy die Handynummer, die uns Señora Sanchez Brulles, die Wirtin für das Apartment, das wir mit Hilfe meines spanischen Kollegen telefonisch gebucht hatten, mitgeteilt hatte. Es meldete sich eine Frau, die aber kein Englisch sprach und die ihr Telefon einem Mann übergab, dessen rudimentäre Englischkenntnisse nicht zuließen, dass ich mich verständlich machen konnte, bis der einfach auflegte. Erstaunt sahen wir uns an, dann versuchte es Marlis noch einmal, aber auch diesmal legte er wieder auf. Ratlos verglich ich die Nummer mit dem, was ich notiert hatte und wählte wieder. Diesmal flehte uns der Mann in gebrochenem Englisch an, wir möchten ihn bitte nicht mehr belästigen. Ratlos standen wir herum, bis ich Marlis und Emil bei den Koffern zurückließ und in einem Hotel eine englisch sprechende Rezeptionistin um Hilfe bat. Schnell hatte sie die Haustelefonnummer von Señora Brulles herausbekommen und erlaubte mir, mit ihr zu telefonieren. Zum Glück war sie zu Hause und versprach zu kommen. Es stöckelte eine kastanienfarben gebräunte Frau mit hellblonden Haaren den schmalen Fußweg herunter und erklärte, dass leider ihre Mutter die Schlüssel für die Wohnung habe. Auch diese Dame traf irgendwann ein, mit einem übergroßen Hund, den sie wohl gerade ausführte. Dicke Speichelfäden hingen ihm aus dem Maul und er bellte ungeduldig.
Im Zwielicht der schwachen Glühbirnen, die schirmlos an den Decken hingen, wirkte die Wohnung schlicht. Eigentlich richtig hässlich und bestenfalls praktisch. Die Vorführung des Gasherdes scheiterte, da die Gasflasche fast leer war und nur ein kleines hutzeliges Flämmchen erschien. Der Boiler ließ sich gar nicht erst entzünden und so stieg ich mit Señora Brulles auf den Dachboden. Sie beugte sich über etliche Flaschen, schwenkte sie etwas um festzustellen, dass sie alle ohne Inhalt waren. Das schummerige Licht färbte die Wand nikotingelb und ihr Blümchenkleid verblasste darin. Sie erklärte mir, ihre blonden Haare, die vielleicht sogar echt waren, außer die Haare ihrer Mutter waren auch gefärbt, nach hinten schüttelnd und ihr Dekolleté etwas aufblähend, dass sie morgen mit einer Gaslieferung rechne. Dann aber, versteckt hinter einem Bügelbrett, fand sie doch noch eine gefüllte Flasche. Sie erwartete natürlich, dass ich ihr unter die Arme griff und letztendlich musste ich die bleischwere Flasche alleine die Treppen hinunterwuchten. Sie balancierte unterdessen vorneweg. Ihre rasierten Beine wiesen die typische großporige Haut ausgerissener Haare auf. Ich war verwundert, dass ich dies sogar in diesem spärlichen Licht erkennen konnte, konzentrierte mich aber lieber auf die Stufen und meinen schwachen Rücken, damit ich mir nicht am Tag der Ankunft einen Hexenschuss zuzog.
Bei einer genaueren Inspektion der Wohnung fiel der ätzende Geruch von scharfen Desinfektionsmitteln auf, mit denen man den Dreck der Vorgänger zu einem klebrigen Film über die braunen Bodenkacheln verschmiert hatte.
Wir öffneten einige der Rollläden und konnten direkt auf den Hauptplatz des Dorfes sehen, der im gelben Licht der Straßenlampen recht romantisch wirkte. Trotzdem bekam ich etwas Sorge, was die Nachtruhe anging, da man die Konversationen der, die Straße entlangziehenden, Leute im Zimmer verstehen konnte - vorausgesetzt man wäre der spanischen Sprache kundig gewesen.
Der abschließende Abstecher, in eine Kneipe und Tapas-Bar mit dem Namen ‚J&B‘, fiel kurz aus. Sie gehörte zu einem kleinen, fünfstöckigen, betonmodernen und zugleich maroden Hotel, von dessen Zimmern man bestimmt einen guten Blick über das Meer hatte. Die Luft war mild, das Meer rauschte im Dunkel. Weit draußen drehte sich das Licht eines Leuchtturms. Den wollte Emil sofort besuchen und weil man ihm dies nicht sogleich für den nächsten Tag versprach, fing er deswegen und aus Müdigkeit an zu weinen. Wir aßen frittierte Tintenfischringe, die in reichlich Öl schwammen. Emil nagte an Geschnetzeltem vom Schwein mit Pommes Frites.