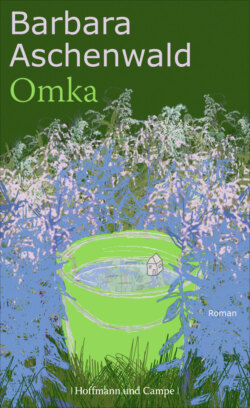Читать книгу Omka - Barbara Aschenwald - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel I Die Bindung
ОглавлениеEs war einmal oder war auch nicht vor langer Zeit ein Mädchen mit einer Seele aus Wasser, das nicht zur Welt kommen konnte, weil seine Mutter nicht bemerkt hatte, dass sie ein Kind unter dem Herzen trug. Das Kind wurde trotzdem geboren und glaubt seitdem, es sei gar nicht da. Ich kannte die Mutter, aber das Mädchen kenne ich nicht, seine Seele war niemals auf der Welt. Sie ist noch im Bauch seiner Mutter, am Meeresgrund, und das Mädchen sucht sie.
Diese Geschichte ist keine wahre Geschichte. Sie ist gemacht aus Luft und Phantasie.
Aber das Mädchen gibt es wirklich, ich habe es selbst gesehen.
Und die Geschichte beginnt so:
Ein Mann war in einem Einkaufszentrum und fiel um und bekam keine Luft mehr. Die Ambulanz holte ihn ab und brachte ihn ins Krankenhaus. Es hieß Sankt Annenhospital.
Eine Frau lag wie tot am Ufer eines Sees und bewegte sich nicht mehr. Ihr Brustkorb hob und senkte sich nur ein bisschen und nur selten. Ihre Haare hatten die Farbe von schmutzigem Weizen, und ihre Haut war weiß. Ein altes Ehepaar ging am See spazieren, und die Frau deutete mit dem Finger auf sie. Der Mann begann zu laufen. Die Frau rief die Polizei an.
Der Mann lag im Krankenhaus, und man gab ihm Sauerstoff. Der Arzt kam zu ihm und sagte, das, was er habe, sei angeboren. Das Blut reichere sich nicht genug mit Sauerstoff an. Es gebe aber eine Therapie. Man könne operieren und zwei Stimulatoren in die Lunge einsetzen, dann lebe man mit der Krankheit ganz normal, wenn man ein bisschen aufpasse. »Und wenn ich mich nicht operieren lasse?«, fragte der Mann.
»Sie bekommen immer weniger Luft«, sagte der Arzt »und irgendwann ist es, als ob man an der frischen Luft erstickt.«
Die Polizei kam. Die Polizisten stellten fest, dass sie noch lebte. Sie sahen das alte Ehepaar an.
»Wir dachten, sie sei tot«, sagten sie.
Da machte sie die Augen auf.
»Was ist denn passiert«, fragte man sie. »Sind Sie geschwommen? Hatten Sie einen Krampf?«
Sie nickte und begann, laut zu lachen und hörte nicht mehr auf.
»Wir haben hier eine verunglückte Schwimmerin«, sagte einer in sein Funkgerät. Dem Einsatzleiter wurde unbehaglich. Vor zwei Wochen war vor seinen Augen jemand mit dem gleichen unbeherrschten Lachen nach einem Autounfall verwirrt mitten auf die Autobahn gelaufen und angefahren worden. Er deutete mit seinem Finger links und rechts neben die Frau, und zwei Polizisten kamen und hielten sie fest, als ob sie sie stützen wollten. Unwillkürlich ging sie in die Knie, und neben ihr bildete sich eine kleine Pfütze vom Wasser, das aus ihren Haaren floss. Ihr Lachen war etwas verebbt, und man konnte nicht mehr hören, ob es in ein Wimmern übergegangen war.
Ein paar Schritte weiter stand eine kleine, scharlachrot gestrichene Bank, wohin die Polizisten sie führten, sie hinsetzten und nahe bei ihr links und rechts stehenblieben. Sie schluchzte. Der Einsatzleiter machte mit dem Kopf eine Bewegung in Richtung des Polizeifahrzeugs, und einer der Männer ging und holte zwei Decken. Man wickelte die zitternde Frau ein und fragte sie nach ihrem Namen. Sie überlegte kurz.
»Omka«, sagte sie dann.
Die Ambulanz kam.
Der Mann im Krankenhaus lag auf dem Operationstisch. Er bekam eine Vollnarkose und tauchte tief unter in ein dunkles, stilles Wasser. Man brach seinen Brustkorb auf, die Knochen erzeugten ein hässliches, knirschendes Geräusch, und setzte ihm die Stimulatoren ein, damit er nicht an der Luft erstickte. Das klaffende Loch in seiner Brust hatte glänzende Ränder, die Spangen, die man angebracht hatte, damit der Brustkorb sich nicht sofort wieder zusammenbog, waren aus rostfreiem Stahl und der ganze OP-Bereich steril, weiß und keimfrei. Es ist gefährlich, wenn in einen Bereich, in dem sonst nichts Fremdes wie ein Keim oder ein Bakterium hineinkommt, plötzlich ein Haar oder eine Hautschuppe fällt, weil sich dann alles entzündet wie die Haut der Welt bei Nacht. Es dauerte lange. Als er aufwachte, lag er in einem warmen Sauerstoffzelt und redete, wusste aber nicht mehr, was er gesagt hatte, als er später darüber nachdachte. Es tat ihm nichts weh, und er hatte den Eindruck, als könnte er aufstehen und auf der Stelle nach Hause gehen, wenn er nur nicht so verwirrt gewesen wäre und sich fühlen würde, als hätte man ihn in eine Wolke Kautschukflocken geworfen.
»Omka – und wie noch?«, fragte der Einsatzleiter.
Da schloss sie langsam die Augen, sank in sich zusammen, und ihr Oberkörper rutschte nach rechts, bis er auf der Bank lag. An den Innenseiten ihrer Beine waren rote Striemen. Sie begannen an den Knien und lagen wie zwei rote Wollfäden bis zu den Fußknöcheln auf der weißen Haut.
Die Polizei sagte zu den Sanitätern: »Das ist eure Sache.«
Der Einsatzleiter war froh. Er hätte nicht gewusst, was er mit der Frau hätte machen sollen, wenn die Polizei sie hätte mitnehmen müssen. Immerhin wusste man nicht, ob man es hier mit einer geistig Verwirrten, einem Unfallopfer oder dem Opfer eines Gewaltverbrechens zu tun hatte. Es war Wochenende.
Die Sanitäter hoben sie auf und brachten sie ins Krankenhaus. Es hieß Sankt Annenhospital. Die Stationen waren brechend voll, weil gerade eine Grippeepidemie ausgebrochen war. Sie war verwirrt und nicht bei sich, sodass man die Notversorgung vornahm, ohne etwas von ihr zu wissen. Sie kam mit dem Verdacht auf einen Schwimmunfall auf die Intensivstation. Man maß die Sauerstoffsättigung in ihrem Blut mit einem Lasergerät an ihrem Finger und stellte fest, dass kein Wasser in der Lunge sein konnte. Nach einigen Untersuchungen fand man keine Anzeichen dafür, dass die Lunge Schaden genommen hatte oder man mit Spätfolgen eines Schwimmunfalls zu rechnen hätte. Sie wurde daraufhin auf die Gynäkologie verlegt, weil sonst kein Bett frei war und ohnehin niemand wusste, wohin mit ihr. Als sie am Morgen aufwachte, kam eine Krankenschwester und brachte ihr etwas zu essen.
»Sie sind also aufgewacht, meine Liebe«, sagte sie. »Ich bin Schwester Marie. Wir wollten Sie jetzt noch bitten, diesen Zettel auszufüllen – vor allem Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und Adresse – vielleicht auch eine Telefonnummer, damit wir Ihre Angehörigen anrufen können.«
Omka sah sie nur an und dann auf das Blatt. Die Krankenschwester war gegangen.
Als sie wiederkam, um das Geschirr wegzuräumen, war das Papier immer noch leer.
Omka sagte: »Ich weiß nur meinen Vornamen.«
»Das nützt uns nichts – ich sage es dem Oberarzt.«
»Und was soll ich jetzt machen?«, fragte Omka.
»Ach«, sagte die Krankenschwester, »erst mal gar nichts. Gehen Sie doch hinaus, ein bisschen spazieren – oder einen Kaffee trinken. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie bekommen ärztliche Hilfe, in unserem Gesundheitssystem wird im Zweifelsfall jeder behandelt.«
Er wanderte durchs Krankenhaus und versuchte, einen Schritt nach dem anderen zu setzen, war immer noch dumpf, müde, und seine Füße fühlten sich an, als würde er dicke, schafwollene Socken tragen, aber er war barfuß. Alles kam ihm unwirklich vor. Wenn er versehentlich irgendwo anstieß, tat es ihm nicht weh. Er fühlte sich mächtig und verletzlich zugleich. Als würde er schweben.
Das normale, alltägliche Leben war plötzlich weg. Er starrte auf den grauen Plastikfußboden und folgte irgendeiner unsichtbaren Linie, neben sich zog er die Infusionsflasche am Gestell nach. Der Arzt hatte gesagt, er solle sich bewegen und viel trinken, dann würden die Nebenwirkungen der Vollnarkose schneller vergehen. Deshalb wanderte er immer noch halb betäubt durchs Krankenhaus. Die Menschen rollten an ihm vorbei wie Seifenblasen, und er fühlte sich wie in einem warmen Traum.
Als er an der Cafeteria vorbeikam, dachte er kurz daran, sich einen kleinen Schnaps zu kaufen, verwarf den Gedanken aber schnell wieder, obwohl er ihm wie eine Befreiung vorkam, weil der Arzt es ihm verboten hatte. Durch die Scheiben der Cafeteria sah er eine Frau, die bei einer Tasse Kaffee in der Ecke saß und geradeaus sah, auf die Wand. Er blieb stehen und schaute sie an. Ihr langes Haar hatte die Farbe von schmutzigem Weizen, an ihrem Hals war ein Muttermal, das ihn irgendwie rührte, ihr Blick war neugierig, ihre Lippen halb geöffnet.
»Wie neugeboren«, dachte er kurz.
Sie merkte nicht, dass er sie ansah.
Sie lag in ihrem Bett, und ihr fielen Bilder ein, aber sie wusste nicht, woher sie kamen und ob sie aus ihrer Vergangenheit waren oder nicht. Die Gegenwart machte einen kraftvollen, frischen Eindruck auf sie. Alles, was sie sah, interessierte sie, weil sie es nicht kannte. Sie freute sich über das Glas Tee, das auf ihrem Nachttisch stand, über die Wolke am Himmel, die aussah wie ein Flügel, über den hässlichen Plastikfußboden, der nach Desinfektionsmittel roch.
Sie wusste nichts mehr, und das war wie ein dicker Dunstschleier, in dem sie hing, wie in einem Wolltuch eingepackt und ohne Namen, ohne Familie, ohne Geburtsdatum, Adresse, ohne Besitz. Es gab nur die Gegenwart und Omka darin. Sie dachte kaum nach, weil es nichts nützte. Sie hatte kein Gesicht zu verlieren, wusste nicht mehr, welche Rolle sie spielen sollte, und fühlte sich, als wäre sie unter Wasser und dort richtig. Das Meer um sie herum war kühl und trug sie, die Wellen gingen vor und zurück, als würde das Wasser ein- und ausatmen, rings um sie herum schwammen die Seelen der Ungeborenen wie schillernde Himbeeren im Wasser vor und zurück, kicherten und schwatzten, ließen sich sehr kurz auf ihr nieder, um dann blitzschnell wieder zurückzuzucken und mit einer ruckartigen Bewegung zu fliehen. Einen halben Meter von ihr entfernt blieben sie im Wasser stehen und schauten ihr zu.
Der Mann wurde entlassen. Er packte seine Sachen, die Brust tat ihm jetzt sehr weh, weil er aus Übermut und dem Gefühl von Unverwundbarkeit, das er bis vor kurzem noch hatte, keine Schmerztabletten mehr genommen hatte. Die Frau, die er in der Cafeteria gesehen hatte, fiel ihm wieder ein. Seine halbvolle Tasche stand auf dem Bett, das Krankenhausnachthemd hatte er sauber zusammengefaltet.
»Ich habe es ja nicht eilig«, dachte er und beschloss, sich noch eine Tasse Kaffee zu kaufen. Nachdem er seine restlichen Sachen gepackt hatte, nahm er seine Tasche und ging in die Cafeteria. Dort, auf den gelben Plastikstühlen saßen Patienten mit ihren Angehörigen, Schläuche führten in Arme und aus Wunden, er sah einen Rollstuhl und eine Frau mit einem verbundenen Kopf, die Kuchen aß. Er setzte sich. Nachdem er eine Zeitlang gewartet hatte, neigte sich jemand zu ihm und sagte: »Hier kommt niemand – Selbstbedienung.«
Am Buffet fragte er die Kassiererin, ob sie sich an eine Frau erinnern könnte, die gestern hier gewesen war, sie habe dort drüben gesessen, und er beschrieb ihr Aussehen.
»Ach, die Nixe!«, sagte die Kassiererin und lachte. »Die liegt auf der Gyn, sie haben sie aus dem Wasser gefischt, und jetzt stimmt etwas in ihrem Kopf nicht mehr.« Die Frau deutete mit der Hand auf ihre Stirn und bewegte sie leicht hin und her.
»Haben Sie das noch nicht gehört? Das ganze Krankenhaus spricht darüber.«
Der Mann schüttelte nur leicht den Kopf und sagte: »Eine Tasse Kaffee, bitte.«
Auf der Gynäkologie hingen Bilder von Neugeborenen in blauen und rosa Rahmen an den Wänden, und er ging durch die Gänge, fühlte sich wie ein Fremdkörper. Seine Brust tat ihm weh, er wusste nicht einmal, was er sagen sollte, wenn jemand ihn fragen würde, wen er suche und ob er ein Angehöriger sei. Ihm war unbehaglich zumute, und andererseits dachte er sich, dass es ja schließlich niemand etwas anginge, warum er nach einer Patientin suche und was er von ihr wolle. Doch in diesem Moment fiel ihm ein, dass er nicht einmal wusste, wie sie hieß und er wollte sein Vorhaben abbrechen. Um nicht aufzufallen, blieb er an den Bildern der Neugeborenen an der Wand stehen und betrachtete sie einen Moment lang interessiert. Dann kehrte er um und ging den Gang zurück. Im letzten Zimmer ging eine Tür auf, und eine Infusionsflasche am Gestell wurde herausgeschoben, eine Hand zeigte sich, und schließlich kam Omka aus dem Zimmer heraus, blickte lächelnd auf ihre Zehen und schloss die Tür hinter sich. Sie trug nur das Krankenhausnachthemd und keine Schuhe. Er ging auf sie zu und vermied es, ihr ins Gesicht zu schauen, und versuchte, unbeteiligt auszusehen. Sie ging ein paar Schritte neben ihm, sah zweimal zu ihm hinüber und immer wieder auf ihre Zehen und lächelte. Er wusste nicht, was er sagen sollte, es war ihm aber klar, dass er nicht mehr lange Zeit hatte, sie anzusprechen, immerhin konnte er ihr ja nicht ewig nachlaufen, ohne etwas zu sagen. Im Stillen verfluchte er seine Unbeholfenheit und hätte sich ein starkes, sicheres Auftreten gewünscht. Was würde einen daran hindern, einen anderen Menschen zu fragen, ob man ihn zum Tee einladen dürfe, einfach so, weil man sich als Mensch für andere Menschen interessiert, und die ganzen Verrenkungen um Gründe, Wetter, festgefahrene Abläufe und dergleichen fahren zu lassen. Die Schmerzen in seiner Brust rissen ihn aus seinen Gedanken. Sie war immer noch neben ihm, sah ihren Füßen beim Gehen zu.
»Zum Teufel noch mal«, dachte er sich und beschloss, kühn zu sein. »Wie heißen Sie?«, fragte er sie, ohne sie vorher begrüßt zu haben, als sie gerade ein paar Schritte den rechten Gang hinunter war.
Sie drehte sich um, sah ihn ohne Argwohn an und sagte nach einer kurzen Pause: »Ich heiße Omka.«
»So einfach«, dachte er sich. Er fühlte sich, als stünde er in einem blauen Raum mit ihr, wo man ohne große Erklärungen auskam und wo Neugierde nicht falsch verstanden und Interesse am anderen ein zutiefst menschlicher Zug war. »Und Sie?«, fragte sie.
»Josef«, sagte er. Seinen Nachnamen ließ er weg.
»Möchten Sie mitkommen?«, frage sie.
»Wohin denn?«, fragte er und ärgerte sich über diese Frage.
»Ich weiß es noch nicht«, sagte sie.
Sie saßen auf einer Bank im Park des Sankt Annenhospitals und sprachen miteinander. Es war wieder wärmer geworden, und als die Sonne zwischen den Wolken hervorblitzte, bekam man Lust, in die frische, grüne Welt zu laufen.
Josef war leicht zumute, weil sie nichts missverstand, manche Sachen verstand sie gar nicht. Sie fragte nur und wusste nichts. Er fühlte sich mächtig und mit ihr zusammen, als wäre die Welt neu. Sie war unbefangen und machte den Eindruck eines erwachsenen, sehr schönen Kindes.
»Weißt du«, sagte sie (sie waren schnell zum Du übergegangen), »die Ärzte haben gesagt, ich hätte Amnesie. Ich kann mich an nichts erinnern. Sie sagten, das käme von einem Trauma nach einem Schwimmunfall, dabei kann ich gar nicht schwimmen, glaube ich.« Sie lachte.
»Wie frische Luft«, dachte er und hatte ein Gefühl so ähnlich wie das, als er zum letzten Mal verliebt gewesen war.
Als er nach Hause kam, fühlte er sich verlassen, obwohl er keinen Grund dafür fand. Es war alles so, wie er es gewohnt war, sein Zuhause, sein Bett, seine Gedanken. Seine Brust tat weh, und er beschloss, eine Schmerztablette zu nehmen. Er kochte Tee, lag herum, trieb dummes Zeug und langweilte sich. Weil er das Büro für noch fünf Tage geschlossen hatte, wusste er nicht, was er Vernünftiges mit sich anfangen sollte. Obwohl er schon länger alleine lebte, schien ihm das große, helle Haus auf einmal seltsam leer. Damals war es seine erste Arbeit gewesen. Er hatte es von seiner kinderlosen Tante vererbt bekommen, und es stand unter Denkmalschutz, weshalb man es nicht erlaubt hatte, an der Außenfassade etwas zu verändern. Aber drinnen war es modern und geschmackvoll eingerichtet. Es war ihm nie in den Sinn gekommen, umzuziehen, denn aus irgendeinem Grund hatte er immer Mitleid mit seiner Tante gehabt und wollte das Haus nicht verkaufen. Er ging viel spazieren. Omka fiel ihm immer wieder ein und dass er nicht einmal ihre Telefonnummer hatte, denn sie hatte ja kein Telefon. Die Idee, dass er sie einfach anrufen könnte, ohne ihr einen Grund dafür zu sagen, gleich Absichten bekunden zu müssen, und ihr sagen konnte, dass er nur angerufen hatte, weil er sie gerne hören würde, ohne dass sie sich auch nur die kleinste Kleinigkeit dabei dachte und keinen Hintergedanken hatte, freute ihn.
Und was für ein Rätsel sie dabei doch war. Sie hatte wirklich alles vergessen, war wie gerade eben zur Welt gekommen, dabei aber bestimmt schon Mitte dreißig, obwohl sie mit ihren großen, tiefen Augen, dem kurzen Abstand zwischen Nase und Kinn und der hohen Stirn etwas sehr Kindliches hatte. Bestimmt war sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder versichert noch besaß sie eigenes Geld. Wie das wohl alles funktionieren würde, denn immerhin war sie ja im Krankenhaus, und die Behandlung und der Aufenthalt mussten bezahlt werden.
Schließlich fiel ihm ein, dass sie ein Telefon im Krankenzimmer hatte, und er wusste schließlich ihre Zimmernummer, und ihren Nachnamen wusste sie selbst nicht. Er stürzte zum Telefon, wählte die Vermittlung, nannte die Zimmernummer und den Stock und wurde verbunden. Eine Frau nahm ab, sie hatte eine sehr hohe Stimme und hauchte ein »Ja hallo, Hofer« ins Telefon. Da legte er auf. Verwirrt darüber, dass sie offenbar nicht mehr im Krankenhaus war, begann er, nachzudenken.
Omka lag in einem neuen Bett und freute sich. Sie hatte keine Sorgen und sah sich ihre Hände an und lachte leise, weil es sie gab. Nur die Beine taten ihr weh, als ob man mit einer Klinge an der Innenseite ihrer Schenkel auf- und abfahren würde. Man hatte die Infusionsflasche abgenommen. Bei der Visite am Morgen kamen Ärzte und Studenten und standen um ihr Bett.
»Hier haben wir eine Patientin mit retrograder Amnesie wahrscheinlich in Folge einer akuten Belastungsstörung«, sagte einer der Ärzte. »Bisher keine Therapie.« Die Studenten sahen einander an. Einer hob die Hand.
»Wie ist das Procedere?«, fragte er.
»Applikation von Antidepressiva und Analgetika bei Bedarf, ansonsten Gesprächstherapie«, sagte der Arzt bedeutungsvoll.
»Hat sie Schmerzen?«, fragte ein Student.
»Nun ja«, sagte der Oberarzt, »die Patientin klagt über Schmerzen in den Beinen, die aber auf keine organischen Ursachen zurückzuführen sind. Wobei kann es sich hierbei handeln?«, fragte er.
Ein weiterer Student im weißen Mantel hob die Hand. »Somatoforme Dissoziation«, sagte er »meistens nach Traumatisierungen verschiedener Art. Opfer von Vergewaltigungen klagen über anhaltende Schmerzen in den Geschlechtsorganen, die keine physische Entsprechung haben. Das traumatische Geschehen wird somit auf körperlicher Ebene verarbeitet.«
»Was haben wir hier?«, frage der Oberarzt.
»Schwimmunfall«, sagte einer.
»Da haben Sie’s, meine Herren«, sagte der Oberarzt. »Die Dame hatte einen traumatischen Schwimmunfall, das Geschehen wird verdrängt, dafür hat sie Phantomschmerzen in beiden unteren Extremitäten, die natürlich davon kommen, dass sie versucht hat, sich über Wasser zu halten. Sie müssen immer versuchen, klar zu denken und eine wissenschaftliche Erklärung für das Geschehen zu finden, denn sonst haben wir auch keine Handhabe für die Behandlung.«
»Und wenn sich keine Besserung der Amnesie einstellt?«, fragte ein anderer. »Unwahrscheinlich«, sagte der Arzt, »in den meisten Fällen kommt das Gedächtnis wieder.«
»Entschuldigen Sie …«, sagte Omka und sah den Arzt fragend an. Der winkte einen Studenten zu sich und gab ihm das Krankenblatt, und der Rest der Visite ging weiter. Der Student war ein junger, dicker Mann mit Brille, seine Fingernägel waren abgekaut, und er machte einen klugen Eindruck.
»Frau …«, sagte der Student, räusperte sich und sah in das Krankenblatt, wo nur der Vorname stand, und begann noch einmal sehr umständlich: »Verehrte Dame, Sie leiden unter einer temporären Amnesie, das heißt, Sie haben Ihr Gedächtnis verloren. Das bemerken Sie daran, dass Sie nicht wissen, wie Sie mit vollem Namen heißen, ob Sie eine Familie haben oder wo Sie wohnen, um nur einige Punkte zu nennen. Das Gedächtnis kommt in den meisten Fällen wieder.«
»Das heißt, es ist nicht schlimm«, sagte Omka.
»Nun ja«, sagte der Student »das mangelnde Krankheitsbewusstsein und der fehlende Leidensdruck sind auch Symptome der Amnesie. Und es bedeutet auch, dass Sie, solange Sie sich an nichts erinnern können, ein Sozialfall sind, das heißt angewiesen auf Unterstützung. Aber in unserem medizinischen System wird im Zweifelsfall jeder behandelt.«
Omka verstand kein Wort. »Ich fühle mich gut«, sagte sie. »Kann ich nicht gehen?«
»Wohin denn?«, fragte der Student.
Sie sprachen noch länger miteinander.
»Wo ist die Frau hin, die hier war?«, fragte Josef, »ist sie entlassen worden?« Die Ärztin sah kurz in ihre Akte.
»Sind Sie ein Angehöriger?«, fragte sie dann.
»Nein.«
»Dann darf ich Ihnen, so leid es mir tut, keine Auskunft geben.«
Er ging ins Café. Die Kassiererin erkannte ihn nicht wieder.
»Einen Schnaps, bitte«, sagte er. Sie schenkte das kleine Glas voll, und er sagte: »Die Nixe ist weg, was?«
»Ach woher! Psychiatrie. Was glauben Sie denn? Jemand, der glaubt, er sei eine Nixe, wo ist der wohl?«
Die Kassiererin hatte gesagt, dass Omka von sich selber denke, eine Nixe zu sein, was gar nicht stimmte. Der junge Sanitäter, der im Krankenwagen mitgefahren war, hatte irgendjemanden von den roten Striemen an Omkas Beinen erzählt, die man auf ganz einfache Weise erklären konnte. Vielleicht waren Äste eines umgestürzten Baumes im Wasser gelegen und Omka hatte sich an ihnen verletzt, als sie versucht hatte, sich über Wasser zu halten. Dieser Irgendjemand hatte sich in der Cafeteria einen Kaffee mit Sahne geholt und der Kassiererin erzählt, es sei neuerdings eine hysterische Frau in der Klinik, die man nun auf die Psychiatrie verlegt hatte, weil sie über Messerschmerzen an den Beinen jammere, ständig wie ein Fisch nach Luft schnappe und bettelte, dass man sie zurück in den See werfen solle. Später wird eine Krankenschwester erzählen, sie hätte sogar Schwimmhäute zwischen ihren Zehen ausgemacht, und eine andere, dass sie nur rohen Fisch essen würde. Es war alles nicht wahr, aber es hatte sich eben in den Köpfen festgesetzt.
Josef ging ins psychiatrische Krankenhaus und fand Omka dort auch. Sie hatte die Rückenlehne des Bettes hochgestellt, saß also fast aufrecht in ihrem Bett und starrte in den Fernsehapparat.
»Omka«, sagte er und trat auf sie zu, »erinnerst du dich an mich?«
Sie sah ihn an und lächelte. »Ja«, sagte sie.
»Wieso bist du denn hier?«
Ihr Blick bekam einen verwunderten Ausdruck, sie schien etwas verloren zu haben, aber er konnte nicht sagen, was es war.
»Ich kann mich an nichts erinnern«, sagte sie. »Ich weiß nicht, wo ich wohne, was mein Beruf ist, ob ich Kinder habe, meinen Nachnamen habe ich auch vergessen. Sie haben gesagt, das käme von einem Trauma, weil ich fast ertrunken bin.«
»Aber das hast du doch vorher auch gewusst«, sagte er und dann schnell, »es tut mir leid.« Dann wusste er nicht mehr, was er sagen sollte. »Ich wollte …«, sagte er. »Ich … und was geschieht jetzt?«
»Ich weiß es nicht«, sagte sie, »wahrscheinlich muss ich hierbleiben, bis sie wissen, wer ich bin.«
Sie sah traurig aus. Aus den Augenwinkeln sah sie, dass er nachdachte.
»Wie fühlst du dich sonst?«, fragte er, weil er nichts anderes zu fragen wusste. »Ich … ich weiß es nicht. Ich fühle gar nichts mehr. Ich muss dauernd daran denken, was jetzt passiert.«
»Wie meinst du das«, fragte er.
»Ich weiß es nicht. Es ist nur irgendwie … komisch«, sagte sie und stand aus dem Bett auf, um sich die Hände zu waschen.
Er fragte sich, was wohl geschehen war, und sah sie an. Ihre weizenfarbenen Haare waren gewaschen und hingen gerade herunter bis zu ihrer Hüfte. Ihre Augen waren dunkel und wirkten gleichgültig. Ihr Gesicht war bleich, und an ihrem Hals war ein großes Muttermal, das ihn irgendwie rührte.
»Schön«, dachte er. Aber er sagte nichts.
»Wie heißt du eigentlich mit Nachnamen?«, fragte sie ihn.
»Grentshäuser«, sagte er.
Etwas an ihr war anders als vorher. Als hätte jemand einen grauen Schleier über sie geworfen.
Und ärgerte sich, dass man offenbar ihre Leichtigkeit ruiniert hatte.
Die Wände im Stationsarztzimmer waren in einem schmutzigen Türkisgrün gestrichen, und an der Wand hing ein gemaltes Bild von einem Müllcontainer, daneben stand: »Wir ent – Sorgen.«
Er dachte, sie gehöre nicht an diesen hässlichen Ort.
Als er das nächste Mal kam, brachte er ihr Schokoladenmuscheln mit. Sie freute sich, als sie ihn sah. Er gab ihr die Schachtel und sagte verlegen: »Du bist also immer noch hier? Gibt es nichts Neues?«
»Nein«, sagte sie. »Man hat offenbar noch niemanden gefunden, zu dem ich gehöre.«
Sie setzten sich an den kleinen Tisch im Zimmer, am Fußende ihres Krankenbettes stand nur ihr Vorname. Durch das Fenster kam ein dünner Lichtstrahl und zeigte auf Josefs Brust, genau dorthin, wo unter dem Hemd die Narbe von seiner Operation war. Omka sah das Leuchten auf seiner Brust und fragte dann: »Wieso warst du eigentlich hier?«
»Ach«, sagte er, »ich habe etwas, von dem ich den medizinischen Namen vergessen habe, aber irgendwie hängt es mit dem Blut zusammen, das nicht genug Sauerstoff aufnimmt. Deshalb wurde mir oft schwindelig, und als ich einmal ohnmächtig wurde, bekam ich die Diagnose, und man meinte, das müsse schnell operiert werden, weil es sich sonst verschlimmern würde.«
Omka sah ihn an. Er trug ein elegantes Hemd, aber die Krawatte war hässlich. Sein Gesicht war rund und seine Haare dunkel, die Augen ausdrucksvoll und tief, mit dichten Brauen. An seinen Wangen waren einige kleine Schnitte von der Rasierklinge. Die Lederschuhe waren frisch geputzt.
Sie fragte: »Kannst du eigentlich schwimmen?«
Und er sah sie erstaunt an.
»Dass es immer die Guten erwischt«, dachte er sich. »Kaum ist etwas Unschuldiges auf der Welt mit einem neuen, frischen Blick, macht man es kaputt. Das ist unerträglich! Falsch! Gemein!«, dachte er sich.
Er hätte sie gerne an sich gedrückt und geküsst.
Als sie zu ihm ins Haus zog, hatte sie nur eine kleine Tasche mit. Er hatte sie ihr gebracht. Man hatte ihr gesagt, sie könne die Krankenhauskleidung behalten, und sie aber erst gehen lassen, als sie sagte, sie könne sich an Josef erinnern, er sei ein Freund von ihr. Er musste seinen Namen und seine Adresse angeben und eine Unterschrift leisten. Vorher waren Polizisten da gewesen, hatten ein Foto von ihr gemacht und gemeint, es käme in die Zeitung und man versuche, auf diesem Wege ihre Angehörigen zu finden.
Sie hatte sich überschwänglich bei ihm bedankt und ihm die Hände geküsst. Er war verlegen geworden und hatte gemurmelt, es wäre schon gut, es wäre ja nur, damit sie inzwischen etwas hätte. Insgeheim freute er sich, dass sie bei ihm wohnte. Sie würde um ihn sein und er wäre nicht mehr alleine, auch wenn sie ansonsten nichts miteinander zu tun hätten.
Omka war froh, aus dem Krankenhaus herauszukommen. Seit dem Gespräch mit dem Studenten hatte sie das Gefühl eines Mangels an ihr.
In der ersten Nacht war der Himmel erst rosa und dann grau, und als es dunkel wurde, ging er ins Schlafzimmer und legte sich hin und konnte nicht einschlafen, weil er wusste, dass sie nebenan auf dem Gästebett schlief. In der Nacht wachte er einmal auf, als er hörte, wie sie aufstand und sich wusch. Er wachte davon noch dreimal in der Nacht auf.
Sie dachte ständig daran, zu ihm ins Bett zu kommen und dort bei ihm zu schlafen, wagte es aber nicht. Sie stellte sich vor, wie er sie umarmte, und drückte das Kopfkissen an sich.
Morgens stand sie auf und sah sich das Haus an. Sie begann aufzuräumen und kochte Kaffee. Als er aufgestanden war, war es sauber. Sie war in der Küche und mühte sich mit den modernen Geräten ab. Die Platte musste man direkt mit dem Finger drücken, um einzuschalten, obwohl allen Kindern beigebracht wird, dass sie nicht dorthinlangen dürfen. Wenn Omka zu schnell gedrückt hatte, erschienen rote, digitale Zahlen, die wütend blinkten, und es hatte eine Weile gedauert, bis sie begriffen hatte, dass der Kaffee in der italienischen Espressomaschine heiß wurde, obwohl die Platte kalt war, wenn man drauffasste, was sie sich auch erst nach einigen Versuchen getraut hatte.
Er war verlegen und sagte: »Omka … Guten Morgen … ich meine … du musst nicht.«
»Ach, das macht doch nichts«, sagte sie fröhlich »wenn ich schon hier wohne, kann ich auch … es macht mir nichts aus, wirklich nicht.« Und schaute zu Boden. Das Krankenhaus fiel ihm wieder ein und die Kassiererin.
»Weißt du eigentlich, dass die in der Cafeteria gesagt haben, du seist eine Nixe?«
Sie lachte. »So ein Blödsinn«, sagte sie.
So verging einige Zeit. Er konnte immer noch auf leichte Weise mit ihr sprechen, aber das frische Gefühl, der blaue Raum war weg. Das ärgerte ihn, denn er war überzeugt, im Krankenhaus hatte man ihr Angst gemacht und ihr etwas genommen, was sie jetzt verändert erscheinen ließ. Man hatte vermutlich zu ihr gesagt, dass sie kein Konto hätte, keine Versicherung, kein Geld, dass die Krankenhauskosten irgendwie erstattet werden mussten und dass man nicht wusste, wohin mit ihr, wenn sie entlassen würde und man bis dahin keine Angehörigen gefunden hätte.
»Irgendwie schaffen sie es schon, jeden zu überzeugen, dass er ohne Konto und Telefonnummer eigentlich gar kein Mensch ist«, dachte er ärgerlich.
Sie war zwar noch neugierig und lachte viel, aber das Lachen kam ihm nun irgendwie übertrieben vor, und er wunderte sich, dass sie nie weinte.
An einem Sonntagnachmittag gingen sie spazieren, den Fluss entlang. Sie fütterten die Möwen, und eine kam nahe an Omka heran. Sie pickte Omka in die Hand, als sie sie mit Brotkrümeln fütterte, und deren Miene verfinsterte sich. Sie bückte sich schnell und packte die Möwe, die schrie. Er sah, wie die kurzen Federn am Hals des Tieres zwischen ihren Fingern herauslugten, wie der Vogel die Augen weit aufriss und den Schnabel lautlos öffnete, und hörte ein Geräusch, das klang wie das leise Knirschen zerdrückten Strohs. Sie lachte, als sie der Möwe den Hals umdrehte. Deren Augen erloschen, und der Körper entspannte sich. Omka ließ das Tier fallen. Er schaute sie entsetzt an.
»Du hast doch gesehen, was sie gemacht hat!«, sagte sie erregt. »Sie hat mich in die Hand gepickt! Das hat wehgetan!«
»Aber es ist doch ein Lebewesen. Ich meine … wenn man alles umbringt, das einen ärgert, wäre man bald alleine auf der Welt«, sagte er und lachte verlegen. Sie merkte, dass ihm der Vogel wirklich leidtat und dass er es grausam fand, was sie getan hatte. Panik ergriff sie, und irgendwo aus ihrem Inneren kamen die Worte: »Ich bin … es tut mir leid, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber weißt du, es ist … ich weiß selber nicht, was es ist. Ständig träume ich vom Ertrinken. Ich wache in der Nacht oft auf und will mir die Hände waschen. Und als ich diese Möwe gesehen habe, diesen Wasservogel, hat mich das erinnert an den Traum, den ich hatte. Ich war im Wasser und trieb auf dem Rücken dahin, über mir kreiste eine Seemöwe im grauen Himmel, und das Wasser war eiskalt, aber es wurde immer wärmer, je länger ich darin lag. Die Möwe schrie, und ich sah ihre kleinen Augen wie schwarze Perlen ganz in der Nähe, sie flog um mich, und ich wusste: Jetzt ist es aus mit dir. Du sinkst auf den Grund des Wassers und verlöschst wie eine ausgeblasene Kerze und ertrinkst einfach. Und als ich diese Möwe da gesehen habe …«
Ihr war, als ob es gar nicht sie gewesen wäre, die das gesagt hatte. Sie drehte sich um und schluchzte leise. Da hatte er den Eindruck, er habe ihr unrecht getan und müsse sie jetzt trösten.
Er trat einen Schritt auf sie zu und umarmte sie so ungeschickt von hinten, dass sie beinahe das Gleichgewicht verlor. Er war sich sicher, dass er das Richtige tat, wenn er sich entschuldigte und sie tröstete. Aber nachdem sie sich ihm erklärt hatte, zitterten seine Hände bei dem Gedanken, dass sie wirklich vor seinen Augen ohne eine Regung ein Tier getötet hatte, aus einem nichtigen Grund und mit einem kalten, leeren Blick, und er erschauderte.
»Nein, es war wegen mir«, sagte Omka. »Ich habe Angst bekommen, ich weiß auch nicht, was es war.«
»Es ist schon gut«, sagte er.
Und sie gingen nach Hause.
Am nächsten Morgen rief die Polizei an. Die Beamten sagten, es habe sich noch niemand gemeldet wegen Omka und man würde jemanden schicken, der noch ein Foto von ihr machen würde, das dann in die überregionalen Zeitungen käme. Je größer die mediale Präsenz, desto höher die Wahrscheinlichkeit, ihre Angehörigen würden sie wiedererkennen, auch wenn sie von weit her sei. Die überregionalen Zeitungen würden mehr Leute erreichen.
Sie saß in einem Gartensessel und trank Tee auf der Terrasse. Das Haus hatte keinen Garten, weil man die Parzelle, auf der das Haus stand, seinerzeit geteilt hatte, um sie bebauen zu können. Deshalb stand das alte Haus inmitten einer kleinen Siedlung aus neuen Einfamilienhäusern am Stadtrand, die Gegend war ruhig und dementsprechend wohnten hier wohlhabende Leute.
»Ich kann doch nicht ewig hierbleiben«, sagte Omka in ihrem Sessel sitzend, die Teetasse in der Hand. »Was mache ich, wenn mich niemand erkennt?«
Von seiner Schwester bekam er abgetragene Kleidung für Omka, die ihr passte.
»Woher kommt eigentlich dein Name«, fragte er beiläufig. »Er klingt polnisch irgendwie oder slawisch oder etwas in der Art.«
»Ach«, sagte sie, »meine Mutter war, als sie mit mir schwanger war, auf Urlaub in einem Ort, der so hieß, in Russland – Nizhnyaya Omka an der Grenze zu Kasachstan. Es war eine sehr unglückliche Schwangerschaft, und dort hat sie mich zum ersten Mal gespürt, und da beschloss sie, dass alles gut werden würde. Deshalb heiße ich Omka.«
Plötzlich stand sie auf und ließ ihre Teetasse fallen.