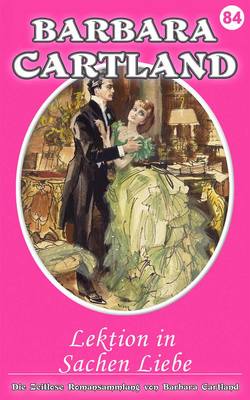Читать книгу Lektion in Sachen Liebe - Barbara Cartland - Страница 2
1. ~ 1890
Оглавление»Nimm es mir nicht übel«, sagte die frischgebackene Gräfin Berrington, »aber ich eigne mich mit meinen fünfunddreißig Jahren nicht zur Anstandsdame eines jungen Mädchens.«
Dabei sah sie ihre angeheiratete Nichte beinahe herausfordernd an; schließlich wußten sie beide, daß die Gräfin auf die Vierzig zuging.
»Mach dir darüber keine Sorgen, Tante Kitty«, beruhigte Marisa sie. »Ich verzichte auf eine offizielle Einführung in die Gesellschaft. Mein erster Versuch hat mir gereicht. Es war die schlimmste Erfahrung meines Lebens.«
»Unsinn!« behauptete Lady Berrington. »Ganz gewiß hast du die Ballsaison in London genossen.«
»Es war grauenhaft!« stieß Marisa hervor. »Cousine Octavia hat es sicher gutgemeint, als sie mich von einem Ball zum anderen schleppte, nach Hurlingham, Henley und Ranelagh. Ich durfte sogar die königliche Tribüne in Ascot besuchen und wurde im Buckingham Palace der Königin vorgestellt.«
Sie zwinkerte belustigt.
»Ihre Majestät machte eine verdrießliche Miene, und mein Hofknicks fiel so ungeschickt aus, daß ich beinahe gestolpert wäre.«
»Du warst damals schließlich erst siebzehn«, erinnerte sie Lady Berrington. »Jetzt würde dir London gefallen. Die Schwierigkeit ist nur, eine geeignete Anstandsdame für dich zu finden.«
»Wie ich schon sagte, steht mir der Sinn nicht nach London«, erklärte Marisa. »Dennoch brauche ich deine Hilfe, Tante Kitty.«
»Meine Hilfe?« Lady Berrington hob erstaunt die Brauen.
Diese Angewohnheit löste immer wieder das Entzücken ihrer zahlreichen jungen Verehrer aus, die aufgrund ihres toleranten Gemahls in ihrem Hause ein und aus gehen konnten.
»Ich brauche deine Hilfe, Tante Kitty«, wiederholte Marisa, »weil ich Gouvernante werden möchte.«
»Gouvernante?«
Die Eröffnung schlug bei Lady Berrington wie eine Bombe ein.
»Aber warum denn, um Himmels willen?«
Ihre Nichte blickte sich um, als wolle sie sich vergewissern, daß niemand sie belauschte.
»Wenn ich dir ein Geheimnis anvertraue, Tante Kitty«, sagte sie, »schwörst du mir, daß du es weder Onkel George noch einem anderen Menschen verraten wirst?«
»Ja, natürlich«, versicherte Lady Berrington, »aber ich kann mir beim besten Willen nicht vor stellen, was für ein Geheimnis das sein soll!«
»Ich schreibe ein Buch«, erklärte Marisa mit verschwörerischer Miene.
»Ein Buch?« Wieder wanderten die geschwungenen dunkle Brauen nach oben. »Du meinst, einen Roman?«
»Nichts dergleichen«, erwiderte Marisa. »Ich schreibe über Gesellschaftsskandale.«
»Das soll wohl ein Scherz sein, Marisa!« rief Lady Berrington schockiert aus. »Und dazu ein ziemlich geschmackloser!«
»Nein, es ist mein Ernst«, entgegnete Marisa. »Ich beabsichtige, eine amüsante, spritzige Klatschchronik zu schreiben, die jedermann lesen wird und die die Gesellschaft in ihrem wahren Licht erscheinen läßt.«
»Und wie soll so etwas aussehen?« fragte Lady Berrington verwirrt.
»Meiner Meinung nach sind Unmoral, Zügellosigkeit und Verantwortungslosigkeit die beherrschenden Faktoren« ,sagte Marisa
Lady Berrington warf den Kopf in den Nacken und lachte herzhaft, aber ihr Gesichtsausdruck verriet Unbehagen.
»Sicher willst du dir einen Scherz mit mir erlauben, Marisa. Ich kann einfach nicht glauben, daß du deinem Onkel George und mir so etwas antun würdest.«
»Es ist mein voller Ernst«, erwiderte Marisa. »Doch ich verspreche dir, Tante Kitty, du und Onkel George, ihr werdet keine Unannehmlichkeiten haben. Ich werde mein Buch natürlich nicht unter meinem Namen veröffentlichen.«
»Das ist immerhin ein Trost«, meinte die Gräfin, »dennoch halte ich das ganze Vorhaben für völlig absurd. Was weißt du schon über die Gesellschaft?«
»Wenn es dich interessiert . . . Bei der Durchsicht der Familiendokumente entdeckte ich die Tagebücher meiner Großtante Augusta.«
»Wer war das?«
Lady Berrington runzelte die glatte weiße Stirn.
»Sie lebte vor hundert Jahren, als der Prinz und spätere George IV. in einen Skandal nach dem anderen verwickelt war. Damals galt es als schick, exzentrisch zu sein, und die Verschwendungssucht der Stutzer und Lebemänner, die im Carlton House verkehrten, stand in krassem Gegensatz zu der bitteren Armut und dem Elend in den Londoner Armenvierteln.«
»Was hatte deine Großtante Augusta damit zu tun?« wollte die Gräfin wissen.
»Sie schrieb ein sehr amüsantes, ausführliches Tagebuch über Geschehnisse in gesellschaftlichen Kreisen«, erklärte Marisa. »Ich habe die Absicht, ihr Tagebuch als Grundlage für meine Enthüllungsgeschichte über königliche Hoheiten zu benutzen, wobei auch die Hofschranzen, die bis heute in diesen Kreisen den Ton angeben, entlarvt werden sollen.«
»Du weißt doch gar nichts über die gegenwärtige Situation«, bemerkte Kitty Berrington scharf.
»Du würdest dich wundem, was man allein den Gesellschaftsnachrichten der Times entnehmen kann«, erwiderte Marisa. »Denk doch mal an die Skandalgeschichten der sechziger Jahre. Da wurde der Neffe und Erbe des Grafen Wicklow in einem Bordell tot aufgefunden, woraufhin seine Witwe ein Adoptivkind als Universalerben unterzuschieben versuchte. Papa kannte auch Lord Willoughby d’Eresby, den zukünftigen Lord-Oberhofmeister, der seine französische Mätresse um Tausende von Pfund erleichterte und dann mit ihrer Zofe durchbrannte.«
»Wo hast du nur diese Geschichten her!« rief Lady Berrington fassungslos aus. »Im Übrigen gehören sie alle der Vergangenheit an.«
»Tatsächlich?« fragte Marisa spöttisch. »Wie ist es mit der Affäre des Prinzen mit Mrs. Lily Langtry? Mit seinen Liebesbriefen an Lady Aylesford, die Lord Randolph Churchill zu veröffentlichen drohte?«
»Sei still! Ich will nichts mehr davon hören!« wehrte Lady Berrington ab, doch Marisa fuhr ungerührt fort: »Keiner weiß besser als du, Tante Kitty, daß alle Welt über die Leidenschaft des Prinzen für die hinreißende Lady Brooke lästert.«
»Ich höre mir das nicht länger an!« schrie Lady Berrington ihre Nichte wütend an. »Ist dir denn nicht bewußt, Marisa, daß George und ich ruiniert wären, wenn auch nur ein einziges Wort unserer Unterhaltung im Carlton House bekannt würde?«
Im Flüsterton fuhr sie fort: »Wir würden zu keiner der Gesellschaften mehr eingeladen, die wir regelmäßig besuchen, und der Prinz würde uns an keiner seiner Dinnerpartys mehr teilnehmen lassen! Was noch schlimmer wäre: Man würde uns in der Öffentlichkeit zur Rechenschaft ziehen und unseren Namen in diesen schrecklich vulgären Zeitungen wiederfinden!«
»Ich verspreche dir, Tante Kitty, ich werde so geschickt schreiben, daß das nicht passieren kann«, versicherte Marisa. »Statt der Namen werden nur Pünktchen oder Abkürzungen erscheinen. So wird es höchst unwahrscheinlich sein, von jemandem zur Rechenschaft gezogen zu werden, zumal die meisten der Personen, auf die ich anspiele, ohnehin ständig in den Klatschspalten erwähnt werden.«
»Du bist wahnsinnig!« rief Lady Berrington aus. »Ich will damit nichts zu tun haben! Daran ist nur dein Vater schuld! George hat schon immer gesagt, daß er ein Revolutionär oder Anarchist geworden wäre, hätte er nicht einen Grafentitel geerbt.«
Marisa lachte melodisch.
»Wir nennen uns Radikale, und Papa war tatsächlich ein Revolutionär und haßte die Standesgesellschaft.«
»Aus verständlichem Grund«, warf Lady Berrington in verächtlichem Ton ein.
»Wenn du auf Mama anspielst«, erwiderte Marisa, »so war Papa natürlich eifersüchtig und betroffen, als sie mit Lord Geltsdale durchbrannte, aber da er nicht in eine Scheidung einwilligte, kam die Geschichte nicht in die Schlagzeilen der Skandalpresse.«
»Aber alle wußten Bescheid«, sagte Lady Berrington, »und du bist drauf und dran, Marisa, es deiner Mutter gleichzutun.«
»Eines kann ich dir versprechen«, entgegnete Marisa, »ich werde mit niemandem davonlaufen, und da ich auch nicht die Absicht habe, jemals zu heiraten, bleibt dir ganz bestimmt die Schande erspart, daß ich vor dem Scheidungsrichter landen könnte.«
»Was soll das heißen, du wirst niemals heiraten?« fragte Lady Berrington unwillig. »Es wäre das Beste, was dir passieren könnte! Vermähle dich mit dem ersten Mann, der um deine Hand anhält, Marisa, und schlag dir den Unsinn aus dem Kopf, irgendwelche Bücher zu schreiben, die uns nur kompromittieren würden.«
»Du fürchtest ja nur, um deine Vergnügungen gebracht zu werden«, stellte Marisa kühl fest. »Nun, wenn du bereit bist, mir zu helfen, Tante Kitty, verspreche ich dir, sorgfältig darauf zu achten, daß weder du noch Onkel George irgendwie hineingezogen werden.«
»Was verlangst du von mir?« fragte Lady Berrington besorgt.
»Du sollst mir eine Anstellung als Gouvernante in einem sehr angesehenen Haus besorgen, damit ich mir einen Einblick verschaffen kann, wie diese Leute sich benehmen. Ich möchte mich selbst davon überzeugen, daß die Geschichten, die ich über diese Kreise gehört habe, der Wahrheit entsprechen und Papa nicht übertrieben hat. Du weißt ja, wie er die Adelsgesellschaft haßte, die Lord Geltsdale für ihn verkörperte.«
»Dein Vater war in dieser Hinsicht ein Fanatiker«, behauptete Lady Berrington.
»Papa sagte immer, Guy Fawkes habe einen großen Fehler begangen«, erinnerte sich Marisa. »Er hätte nicht versuchen sollen, das Unterhaus in die Luft zu jagen, sondern sich besser das Oberhaus vorgenommen.«
»Bitte, Marisa, gib deinen lächerlichen Plan auf«, bat die Gräfin. »Wirf Großtante Augustas Tagebücher weg und führe ein Leben, wie es sich für Mädchen deines Alters geziemt. Du bist schließlich erst einundzwanzig. In diesem Alter haben wir wohl alle mal Flausen im Kopf gehabt.«
»Aber mir macht es Spaß, schriftstellerisch tätig zu sein«, beharrte Marisa. »Tut mir leid, wenn es dir mißfällt, Tante Kitty. Vielleicht hätte ich es dir besser nicht erzählen sollen, doch ich brauche deine Unterstützung, um eine Stellung in einem bedeutenden Haus zu finden, die mir weiterhilft.«
»Die dir weiterhilft?« rief Lady Berrington mit erstickter Stimme. »Mir ist ganz übel vor Angst und Abscheu. Wie soll ich dich irgendwelchen hochgestellten Freunden als Erzieherin empfehlen, ohne daß sie in Erfahrung bringen, was du im Schilde führst?«
»Wie sollten sie das denn herausfinden? Natürlich bin ich nicht so beschränkt, die Gouvernanten Stelle unter meinem Namen anzutreten. Ich habe beschlossen, mich Mitton zu nennen.«
»Warum denn gerade Mitton?« fragte Lady Berrington kopfschüttelnd.
»Ich finde, Marisa Mitton klingt passend für eine unscheinbare, tüchtige Gouvernante«, erklärte Marisa. »Schließlich würde niemand eine Lady Marisa Berrington-Crecy einstellen. Man würde das als peinlich empfinden.«
»Man würde es in jedem Fall als peinlich empfinden, dich einzustellen«, bemerkte Lady Berrington unwillig.
Sie sprang von ihrem Stuhl auf und ging in ihrem Wohnzimmer auf und ab, das mit viel Nippes und Stilmöbeln ausgestattet war. Auf dem abgedeckten Piano standen Familienfotografien in Silberrahmen, und die schweren Damastvorhänge waren an den Seiten mit Kordeln zusammengerafft.
Kitty Berrington sah sehr hübsch aus in ihrem schwarzen Kleid mit den Seidenschleifen am Saum. Ihr helles Haar war nach der von Prinzessin Alexandra kreierten Mode frisiert, und sie trug ein schwarzes Hütchen mit wallendem schwarzem Schleier.
Die Gräfin war gerade von einer Ausfahrt zurückgekehrt, als man ihr den Besuch ihrer Nichte gemeldet hatte. Jetzt streifte sie nervös die langen schwarzen Glacéhandschuhe von den Fingern und strich sie glatt.
»Ich kann immer noch nicht glauben, was du mir da eben erzählt hast, Marisa. Du verlangst Unmögliches von mir. Außerdem, mein liebes Kind, wer würde dich als Gouvernante einstellen? Schau doch mal in den Spiegel.«
Sie drehte sich um und starrte ihre Nichte an, deren üppige tizianrote Locken das zarte Gesicht mit dem unglaublich hellen Teint umschmeichelten. Nicht ohne Neid betrachtete sie die großen grünen Augen, die von langen dunklen Wimpern gesäumt waren, und den roten Mund, der keiner Schminke bedurfte.
»Du siehst aus wie deine Mutter«, stellte sie fest. »Sie hatte das gleiche Haar wie du und ein Aussehen, das jede Lady davon abgehalten hätte, sie als Erzieherin in ihrem Haus zu beschäftigen.«
»Trotzdem möchte ich Gouvernante werden«, beharrte Marisa. »Kannst du denn nicht begreifen, Tante Kitty, daß es für eine Lady nur zwei Arten von Beschäftigung gibt: entweder als Gouvernante oder als Gesellschafterin. Doch wenn ich bei irgendeiner alten Dame in einem abgelegenen Winkel des Landes als Gesellschafterin unterkomme, werde ich nichts in Erfahrung bringen, was meinem Buch zugutekommt.«
Mit einem mißbilligenden Seitenblick auf ihre Tante fügte sie hinzu: »Natürlich bestünde noch die Möglichkeit, daß du mich zumindest eine Saison lang als Anstandsdame begleitest und ich die Bekanntschaft all deiner eleganten Freunde mache.«
Sie bemerkte den entsetzten Gesichtsausdruck ihrer Tante und fügte hinzu: »Onkel George wäre bestimmt einverstanden.«
»Ich werde auf keinen Fall deine Anstandsdame, ganz gleich, was George meint«, wehrte Lady Berrington ab. »Ich bin zu jung, um mit den alten Matronen auf der Galerie zu sitzen. Außerdem bist du viel zu hübsch, als daß ich dich neben mir dulden würde.«
»Ich bin froh, daß ich meiner Mutter ähnlich sehe«, sagte Marisa. »Offenbar galt sie allgemein als sehr schön, obwohl Mrs. Featherstonehaugh behauptete, Mama sei eine femme fatale gewesen, seit sie das Schulzimmer verlassen habe.«
»Mrs. Featherstonehaugh!« rief Lady Berrington in abfälligem Ton aus. »Sie war das böseste alte Klatschmaul, das ich je kennengelernt habe. Mich hat sie immer gehaßt und übel verleumdet. Wenn deine Informationen über die Gesellschaft von ihr stammen, Marisa, so versichere ich dir, daß alles maßlos übertrieben ist.«
»Mrs. Featherstonehaugh war immer sehr amüsant«, entgegnete Marisa lächelnd. »Was sie an Klatschgeschichten in Erfahrung brachte, pflegte sie Papa brühwarm zu erzählen. Ich glaube, sie war die einzige Frau außer Mama, an der er jemals interessiert war, denn sie war eine nie versiegende Informationsquelle.«
»Dein Vater hat die Gesellschaft nur deshalb so abgrundtief verachtet, Marisa, weil deine Mutter ihm das angetan hatte«, erklärte Lady Berrington energisch. »Sein Haß war krankhaft. Du aber bist ein intelligentes Mädchen und solltest nach dem Tode deines Vaters seinen fanatischen Haß vergessen.«
»Als Mama uns verließ, war ich erst fünf Jahre alt«, sagte Marisa, »und seitdem stand ich unter dem Einfluß von Papa. Schließlich hat sich bis jetzt kaum jemand ernsthaft um mich gekümmert, Tante Kitty.«
»Ich dachte immer, du wärst in Berrington Park glücklich gewesen«, erwiderte Lady Berrington unbehaglich.
»Das hast du dir eingeredet, weil es so am bequemsten für dich war«, gab Marisa ruhig zurück. »Jetzt brauche ich aber deine Hilfe. Wenn ich deinen Freundeskreis schonen und dir deinen Seelenfrieden erhalten soll, dann darfst du mir meine Bitte nicht abschlagen.«
»Das ist glatte Erpressung, Marisa!«
»Die meisten Leute, die ihren Willen durchsetzen wollen, bedienen sich solcher Mittel.«
»Es ist unmöglich! Du bist viel zu jung für einen solchen Posten!«
»Ich behaupte einfach, ich sei vierundzwanzig«, erklärte Marisa. »Und wenn ich mein Haar glatt zurückkämme, wirke ich bestimmt sehr seriös.«
Nach kurzem Überlegen fügte sie hinzu: »Ich könnte es auch färben.«
»Sei nicht albern!« wies Lady Berrington sie zurecht. »Gefärbtes Haar erkennt man immer, und es würde nur noch mehr Mißtrauen hervorrufen. Nein, mir fällt niemand ein, der . . .«
Sie unterbrach sich plötzlich.
»Da kommt mir ein Gedanke«, fuhr sie fort, »aber nein, das ist unmöglich!«
»Warum?« wollte Marisa wissen.
»Weil du dich schon gar nicht für Valerius’ Tochter, die nicht ganz richtig im Kopf sein soll, als Erzieherin eignen würdest.«
»Valerius!« wiederholte Marisa mit belegter Stimme. »Meinst du den Herzog von Milverley?«
»Ja, natürlich«, erwiderte Lady Berrington. »Wir waren vor zwei Wochen auf Schloß Vox, und irgendjemand erzählte mir, niemand würde mit dem Kind zurechtkommen. Das Mädchen ist erst neun oder zehn Jahre alt und hat schon Dutzende von Gouvernanten vergrault. Keine hielt es bei dem Kind aus.«
»Was geschah mit der Herzogin?«
»Sie ist tot«, erwiderte die Gräfin. »Eine neurotische Person war das. Sie starb nach der Geburt des Kindes. Valerius und sie paßten überhaupt nicht zusammen.«
»Warum haben sie dann geheiratet?« fragte Marisa.
»Das ist eine lange Geschichte«, entgegnete die Gräfin. »Als junger Mann war der Herzog unsterblich in die schöne, herrschsüchtige Gräfin de Grey verliebt. Sie war grausam zu ihm, weil sie damals einen viel älteren Mann liebte.«
»Der natürlich nicht ihr Gatte war«, bemerkte Marisa spöttisch.
»Natürlich nicht. Dann wurde der Herzog schließlich dazu überredet, um die Hand der Tochter des Marquis von Dorset anzuhalten, einer hysterischen Person, die ihn wohl ebenso ablehnte wie er sie.«
Mit gedämpfter Stimme fuhr die Gräfin fort: »Man erzählte sich die tollsten Geschichten von ihren Streitereien und Auseinandersetzungen. Sie pflegte mitten in einer Party aufzustehen und davonzulaufen, wenn er irgendetwas gesagt hatte, was ihr nicht paßte. Jedenfalls war ihr Tod eine große Erleichterung für alle, aber offenbar gerät das Kind nach ihr.«
»Hast du das Mädchen nicht gesehen, als du auf dem Schloß warst?« fragte Marisa.
»Valerius hat sie in meiner Gegenwart nicht ein einziges Mal erwähnt«, erwiderte die Gräfin, »und ich habe auf einem solchen Fest weiß Gott Besseres zu tun, als mich in Kinderzimmern herumzudrücken.«
»Wie wär’s, wenn du mich dem Herzog als Erzieherin empfehlen würdest?«
»Ich würde mich nicht an ihn direkt wenden«, erklärte Lady Berrington.
»Alle Regelungen im Haushalt werden von Miss Whitcham, der langjährigen Sekretärin des Herzogs, getroffen, die schon seiner Mutter gedient hat.«
»Dann schreib ihr«, drängte Marisa. »Schließlich hast du nichts zu verlieren. Wenn sie solche Schwierigkeiten mit den bisherigen Erzieherinnen hatten, sind sie vielleicht froh, zur Abwechslung mal eine vernünftige Person zu finden!«
»Vernünftig!« rief Lady Berrington aus. »Wenn du dich für vernünftig hältst, Marisa, dann mußt du blind und taub sein. Doch wenn man dich tatsächlich einstellt, wirst du bald merken, was für ein stumpfsinniges Leben das ist, sich mit dem ungezogenen Kind anderer Leute herumzuplagen.«
»Du schreibst also und empfiehlst mich?« fragte Marisa,
»Du wirst schon sehen, was du davon hast«, erwiderte Lady Berrington scharf.
»Dann tu’s gleich«, drängte Marisa. »Schreib den Empfehlungsbrief, Tante Kitty, dann bist du mich los. Onkel George kannst du ja erzählen, ich wäre zu einer Freundin nach Nordengland gereist, falls ihm meine Abwesenheit überhaupt auffällt.«
»Dein Onkel George hat dich immer sehr gern gehabt«, sagte Lady Berrington, aber es klang nicht sehr überzeugend. Sie setzte sich an ihr Schreibpult und legte sich Feder und Briefbogen zurecht.
»Welche besonderen Fähigkeiten soll ich anführen?« fragte sie.
»Ich spreche Französisch und Italienisch«, erwiderte Marisa» »kann Latein lesen und Klavier spielen.«
»Vermutlich genügt das für ein neunjähriges Kind. Ich war schon immer der Meinung, daß es ein Fehler ist, Mädchen zu viel Wissen beizubringen«, erklärte Lady Berrington verächtlich. »Meine werden jedenfalls nur das Nötigste lernen. Wenn es etwas gibt, das einen Mann abschreckt, so sind es kluge Frauen.«
»Das kann mir nur recht sein«, warf Marisa ein.
Ihre Tante betrachtete sie nachdenklich, wie sie am Fenster stand. Ihr leuchtendrotes Haar glänzte in der Sonne. Ihre Haut war hell, und ihre Augen wirkten übergroß in dem zarten Gesicht. Doch der Hut, den sie trug, war altmodisch, ebenso das Kleid aus billigem Serge, dessen Schnitt sehr unvorteilhaft schien.
»Du brauchst neue Garderobe, wenn du nach Vox gehst«, bemerkte sie in einem Anflug von schlechtem Gewissen. »Als Gouvernante mußt du das Kind gelegentlich in den Festsaal begleiten. Auf keinen Fall solltest du schwarze Kleidung tragen. Bei deiner Haarfarbe und deiner Haut wäre das viel zu auffallend. Ich hingegen werde noch mindestens neun Monate Schwarz tragen müssen. George besteht darauf. Das bedeutet, daß all die hübschen Sachen, die ich mir vor dem Todesfall gekauft habe, aus der Mode sein werden, wenn ich sie tragen kann. Ich schenke sie dir, Marisa. Wir haben ungefähr die gleiche Größe.«
Ein Lächeln erhellte Marisas Gesicht.
»Ist das dein Ernst, Tante Kitty? Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Abgesehen davon, daß mir die Mittel fehlen, hasse ich es, stundenlang anprobieren zu müssen und mich mit Stecknadeln pieken zu lassen.«
»Dein Fehler ist, Marisa, daß du keine weiblichen Eigenschaften besitzt«, tadelte ihre Tante. »Frauen sollten schöne Kleider mögen, gern auf Bälle gehen und sich nach dem Mann fürs Leben sehnen, statt Bücher zu schreiben.«
»Wer kann schon über seinen Schatten springen?« entgegnete Marisa lachend. »Papa hat mich geprägt, und wenn das der Verwandtschaft nicht paßt, so hat sie sich das selbst zuzuschreiben. Als Papa vor zwei Monaten starb, war es nach zwei Jahren das erste Mal, daß sich die Verwandtschaft bei uns blicken ließ.«
»Wessen Schuld war das denn?« fragte Lady Berrington aufgebracht. »Wenn wir deinem Vater einen Brief schrieben, bekamen wir entweder überhaupt keine Antwort oder eine rüde Absage.«
»Trotzdem war er oft sehr einsam!« sagte Marisa nachdenklich. »Er hätte seinen Bruder gern wiedergesehen und gespürt, daß er auch anderen Menschen außer mir etwas bedeutete.«
»Nun, daran können wir jetzt nichts mehr ändern«, meinte Lady Berrington achselzuckend. »Hier ist das Schreiben, Marisa, und gnade uns Gott, wenn du mich blamierst.«
»Das werde ich bestimmt nicht«, versprach Marisa. »Vielmehr könnte ich mir vorstellen, daß ich eine ziemlich gute Erzieherin abgebe und vielleicht diesem bedauernswerten Geschöpf, das niemand zu mögen scheint, einiges beibringen kann.«
»Das habe ich nicht behauptet!« wehrte Lady Berrington ab. »Ich habe nur gesagt, daß der Herzog seine Tochter nicht erwähnt hat. Trotzdem kann er sie doch gern haben. Er ist viel mit dem Prinzen zusammen, und Seine Königliche Hoheit ist Kindern sehr zugetan. Wie du weißt, ist er der Pate unserer kleinen Emily.«
Lady Berrington nahm eine der Fotografien vom Piano und zeigte sie Marisa.
»Das ist Emily«, sagte sie. »Ist sie nicht groß geworden?«
Marisa betrachtete die übliche steife Aufnahme eines kleinen Mädchens, das sonntäglich gekleidet starr in die Kamera schaute. Sie fragte sich, ob diese leicht hervorstehenden Augen und die etwas aufgeworfenen Lippen nicht auf eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Thronfolger hinwiesen. Die abfälligen Bemerkungen ihres Vaters, die er über das auffallende Interesse des Prinzen an seiner attraktiven Schwägerin gemacht hatte, waren ihr noch gut im Gedächtnis.
Es war unglaublich, wie gut ihr Vater, der stets zurückgezogen in Berrington Park gelebt hatte, über alles Bescheid wußte, was in den Kreisen des Prinzen und seiner bezaubernden dänischen Gemahlin vor sich ging. Der Klatsch kannte keine Grenzen, und so drangen die Gerüchte über die neuen Liebschaften des Prinzen und über die Empörung der Königin wegen des unschicklichen Benehmens der sogenannten Marlborough House Clique auch bis in die Provinz vor.
Lady Berrington versiegelte und frankierte nun den Brief und übergab ihn Marisa.
»Bring ihn selbst auf die Post, dann kannst du ganz sicher sein, daß ich Wort gehalten habe.«
Marisa betrachtete den großen weißen Umschlag, der an ‚Miss Whitcham bei Seiner Gnaden, dem Herzog von Milverley, Schloß Vox, Kent‘ adressiert war.
»Gibst du mir sofort Bescheid, wenn eine Antwort eintrifft?« fragte sie.
»Fährst du denn nach Berrington zurück?« erkundigte sich die Gräfin.
»Ich mag nicht in London bleiben«, erwiderte Marisa. »Sobald ich von dir höre, komme ich wieder und hole mir die Kleider, die du mir versprochen hast.«
Ihre Tante maß sie mit nachdenklichem Blick.
»Weißt du, Marisa«, begann sie, »wenn du dich ein wenig bemühen würdest, könntest du die größten Triumphe feiern. Daß ich nicht als deine Anstandsdame fungieren will, ist im Grunde so etwas wie Selbsterhaltungstrieb. Du bist viel zu hübsch! Obwohl du keine Mitgift hast, würdest du bestimmt bald einen wohlhabenden, vielleicht sogar hochgestellten Gemahl finden.«
Marisa lächelte.
»Du meinst es gut, Tante Kitty, aber meine Antwort ist nein. Meine Pläne stehen fest, und Schloß Vox ist für meine Zwecke bestens geeignet.«
»Warum denn ausgerechnet Vox?« fragte Lady Berrington verwundert.
»Eines Tages wirst du es vielleicht erfahren«, erwiderte Marisa ausweichend.
Genau fünf Tage später war es soweit. Marisa hielt sich gerade im Arbeitszimmer ihres Vaters auf, als das Telegramm eintraf.
‚Du sollst Dich sofort nach Vox begeben. Hol Dir Deine Sachen vorher in London ab, Kitty Berrington.‘
Marisa konnte es nicht fassen. Sie las das Telegramm ein zweites Mal, dann stieß sie einen Freudenschrei aus. Sie hatte es geschafft! Was sie kaum für möglich gehalten hatte, war geglückt: Sie würde Schloß Vox und seine Bewohner kennenlernen.
Sie trat ans Fenster und blickte hinaus auf den verwilderten Rasen; so lange sie zurückdenken konnte, war er von keinem Gärtner mehr gepflegt worden.
Das Interesse ihres Vaters hatte sich nur auf Bücher und seinen Rachefeldzug gegen adlige Kreise konzentriert. Seinen Besitz hatte er darüber völlig vernachlässigt. Er hatte sogar vergessen, den Pachtzins von seinen Pächtern zu kassieren oder einen Verwalter zu ernennen, der die Gelder für ihn eintrieb.
Seine Ländereien waren ebenfalls verkommen, und er war von seinen Untergebenen schamlos bestohlen und betrogen worden. Auch das Gutshaus befand sich in einem desolaten Zustand. Marisa war sich bewußt, daß den neuen Grafen, den jüngeren Bruder ihres Vaters, eine schwierige und kostspielige Aufgabe erwartete, wenn er hier wieder Ordnung schaffen wollte. Nicht zuletzt aus diesem Grund hatte sie beschlossen, ihrem Onkel nicht auch noch auf der Tasche zu liegen, ganz abgesehen davon, daß sie entschlossen war, den Kampf ihres Vaters gegen die verlogene Gesellschaft fortzusetzen. Es waren nicht nur seine radikalen Ansichten und revolutionären Ideen, die sie begeisterten, sondern vor allem die Gelegenheit, wie er einen persönlichen Rachefeldzug zu führen, der auf einem für sie sehr schmerzlichen Erlebnis beruhte.
Ihr Vater hatte es gut gemeint, als er sie mit siebzehn Jahren nach London geschickt hatte, um sie von einer Cousine als Debütantin bei Hofe einführen zu lassen. Marisa, die weder über die angemessene Garderobe verfügte noch sich in höfischen Sitten und Gebräuchen auskannte, hatte Höllenqualen gelitten. Während man sich über ihre unkonventionelle Kleidung und ihre ungekünstelten Manieren amüsierte, fühlte sie sich zutiefst gedemütigt und sehnte sich mit allen Fasern ihres Herzens nach dem ungezwungenen Leben in Berrington Park zurück, nach ihren Hunden und Pferden und den lebhaften Diskussionen mit ihrem Vater.
Mit den Tischherren, die ihr ihre Tante zugewiesen hatte, wenn irgendein Essen stattfand, kam kein Gespräch zustande, und Marisa langweilte sich entsetzlich.
Mrs. Featherstonehaugh hatte ihr später beigebracht, daß es zu den guten Manieren einer jungen Dame gehörte, Konversation zu machen und als Gastgeberin charmant, höflich und liebenswürdig zu sein. Außerdem hatte Marisa von der erfahrenen Dame gelernt, daß eine Frau immer gepflegt aussehen und in ihrem Heim für eine gemütliche Atmosphäre sorgen müsse, und sei es durch ein hübsches Blumenarrangement.
Später, als sie erwachsen und sich ihrer eigenen Schönheit bewußt war, wurde Marisa zunehmend selbstsicherer und gewandter, doch die schrecklichen Erlebnisse in London hatten in ihrer Seele Narben hinterlassen. Besonders eine Begebenheit anläßlich eines Balles, den ihre Tante für ihre illustren Freunde gegeben hatte, würde Marisa nie vergessen. Sie mußte mit ihrer Cousine Florence die ankommenden Gäste begrüßen. Marisa erinnerte sich, daß die Damen sich gegenseitig übertroffen hatten. Sie war vom Glanz der Juwelen und Diademe, von der atemberaubenden Schönheit und Raffinesse ihrer Roben wie geblendet gewesen.
Irgendein fader Jüngling, der sich nur über Pferderennen unterhalten konnte, war ihr als Tischherr zugeteilt worden. Nach dem Dinner hatte sie sich auf die Suche nach ihrer Tante begeben, um sich bei ihr aufzuhalten und nicht so verloren herumzustehen.
Im Empfangssalon hatte sie im Vorübergehen ein Paar auf dem Polstersofa sitzen sehen, das ihr den Rücken zukehrte.
Sie wollte im Schutz einer Säule vorbeihuschen, als sie die juwelengeschmückte Dame sagen hörte: »Sei vorsichtig, Valerius, du weißt, wie schnell der Klatsch blüht.«
»Was kümmert’s mich«, hatte ihr Kavalier mit tiefer, wohlklingender Stimme erwidert. Unwillkürlich war Marisa hinter der Säule stehengeblieben. »Du weißt genau, wie verführerisch du bist, Dolly.«
»Ich sollte dich an deine Pflichten erinnern, statt deinen Komplimenten zu lauschen«, meinte die Lady lachend. »Du solltest mit den Mädchen tanzen, für die dieser Ball stattfindet, schließlich bist du eine begehrte Partie, Valerius.«
»Glaubst du im Ernst, ich würde meine Zeit an dieses mondgesichtige Wesen mit den Kuhaugen verschwenden?« entgegnete der Kavalier spöttisch. »Oder an diesen Rotschopf, der aussieht wie eine Karotte, die man zu früh aus der Erde gezogen hat?«
Marisa hatte sich davongeschlichen. Irgendwie hatte diese bösartige Bemerkung des Unbekannten bei ihr das Faß zum Überlaufen gebracht und den Demütigungen und Beleidigungen, die ihr in den letzten Wochen widerfahren waren, die Krone aufgesetzt.
Unter dem Vorwand, ihr Vater sei erkrankt und benötige ihre Pflege, war sie am folgenden Tage fluchtartig abgereist. Vergebens hatte ihre Tante versucht, sie umzustimmen.
Es war nicht schwierig gewesen, festzustellen, wer der Gentleman war, der so abfällig über ihre Cousine und sie gesprochen hatte. Es gab nur einen Mann mit diesem seltenen Vornamen in höfischen Kreisen.
Der Herzog von Milverley und Schloß Vox wurden oft in den Zeitungen erwähnt und abgebildet, und Marisa prägte sich die Gesichtszüge des Duke ein, so daß sie ihn und seine Stimme auf Anhieb erkannt hätte, wäre ihr dieser imposante Gentleman mit dem strengen, fast brutal wirkenden Mund, der aristokratischen Nase und dem ausgeprägten Kinn, den zynisch blickenden Augen und den scharfen Falten von der Nase zu den Mundwinkeln irgendwo begegnet.
Ich hasse ihn, hatte Marisa an jenem Abend gedacht, als sie in den Ankleideraum der Damen geflüchtet war.
»Ich hasse ihn«, sagte sie laut vor sich hin, als die nach Berrington zurückfuhr.
Dieses Haßgefühl verstärkte auch ihre Verachtung gegenüber der herrschenden Klasse. Ihr Vater hatte ebenso empfunden.
Jedes Mal, wenn der Graf dem House of Lords einen Besuch abstattete, bestürmte Marisa ihn hinterher mit Fragen, wen er getroffen und mit wem er sich gestritten habe. Trotzdem konnte sie sich aus ihr selbst unerfindlichen Gründen nicht überwinden, ihn direkt nach dem Herzog zu fragen. Sie hoffte nur immer, daß ihr Vater seinen Namen von sich aus erwähnen würde. Da das nie geschah, schloß sie daraus, daß der Herzog zu den gleichgültigen Zeitgenossen gehörte, die sich nicht um das Wohl ihres Landes, die sozialen Mißstände und die dringend erforderlichen Reformen kümmerten.
Die durch Abwesenheit glänzenden Peers sind verabscheuungswürdig, fand sie, und der Herzog mit all seinem Reichtum und Einfluß ist der Übelste von allen.
Doch nun würde sie sich nach Vox begeben und mit ihm unter einem Dach wohnen. Sie hatte das eigenartige Gefühl, das Schicksal wollte sie mit diesem Mann, den sie abgrundtief verachtete, weil er sie so sehr gekränkt hatte, zusammenführen, damit sie ihn ihren ganzen, in langen Jahren aufgestauten Haß spüren lassen konnte.
Marisa zog die obere Schublade ihres Schreibtisches auf, um die Papiere zu ordnen. Dabei gerieten ihr zwei Briefe in die Hände, die an sie adressiert und völlig zerknittert waren, als wären sie oft gelesen worden.
Marisa blickte einen Augenblick darauf. Dann nahm sie die Briefe aus den Umschlägen, zerriß sie in kleine Schnipsel und warf diese mit energischer Handbewegung in den Papierkorb.
Damit hatte sie ein Kapitel ihres Lebens abgeschlossen, das sie bisher wie einen Schatz gehütet hatte: die zärtliche Zuneigung zu einem gutaussehenden Nachbarssohn, dem sie nichts bedeutet hatte.
Er hatte ihren Vater aufgesucht, um ein Fohlen von ihm zu kaufen. Er war hochgewachsen und war ihr wie ein junger griechischer Gott erschienen.
»Sehr erfreut, Sie kennenzulernen«, hatte er gesagt. »Ich bin Harry Huntingdon. Man sagte mir, Lord Berrington habe ein Fohlen zu verkaufen. Ich bin im Begriff, ein Gestüt aufzubauen, und habe zehn Meilen von hier ein Grundstück gekauft.«
»Wollen Sie bitte im Herrenzimmer auf meinen Vater warten, Mr. Huntingdon?« hatte Marisa schüchtern gebeten.
»In Wirklichkeit«, hatte er lächelnd bemerkt, »bin ich Sir Harold Huntingdon, falls Sie Wert auf Formalitäten legen.«
»Oh, Verzeihung.«
Sie war rot geworden.
»Keine Ursache. Sie dürfen mich nennen, wie es Ihnen gerade in den Sinn kommt. Wenn das Fohlen so hübsch ist wie Sie, werde ich jeden Preis dafür zahlen.«
Sein Blick hatte ihr Herz stürmisch klopfen lassen.
»Zeigen Sie mir das Tier, bevor ich mit Ihrem Vater verhandle«, schlug Harry Huntingdon vor, und sie hatte ihm seinen Wunsch gern erfüllt.
Dies war der Auftakt zu zahlreichen weiteren Besuchen gewesen. Er hatte ihr Komplimente gemacht und ihr das Gefühl gegeben, die wichtigste Frau in seinem Leben zu sein.
Schließlich hatte Marisa sich eingebildet, in ihn verliebt zu sein. Er hatte sie zu einem Ausritt eingeladen, und sie waren frühmorgens über die Wiesen galoppiert. Ihr war nicht bewußt, daß er sie wie ein nettes, hübsches Kind behandelte, das ihn amüsierte, das er als Gentleman jedoch niemals angerührt hätte.
Nach drei für sie wundervollen Wochen erfuhr sie, daß er verheiratet war. Seine Frau war vorübergehend verreist gewesen und sollte am nächsten Tag zurückkommen. Harry Huntingdon gab ihr zu verstehen, daß sie nicht mehr zusammen ausreiten könnten, da seine Frau sonst eifersüchtig werde. Seine Eröffnung bohrte sich wie ein Messer in ihr Herz.
Drei Tage hatte sie sich sterbenselend gefühlt, dann hatte sie ihn energisch aus ihrem Herzen verbannt. Doch sie hatte es nie über sich bringen können, die beiden Briefe, die er ihr geschrieben hatte, zu vernichten.
Rückblickend fand sie es geradezu lachhaft, Harry für ihre veränderte Einstellung Männern gegenüber verantwortlich zu machen. Sie mußte zugeben, daß das Verhalten ihrer Mutter größtenteils daran schuld war. Niemals wollte sie Ähnliches erleben müssen wie sie und ein ungeliebtes Kind im Stich lassen.
Nächtelang hatte sie in ihre Kissen geweint, weil sie sich einsam und verlassen fühlte. Mit jeder Faser ihres Herzens hatte sie sich nach einer liebevollen Umarmung und einem Menschen gesehnt, der immer für sie da war.
Trotzdem richtete sich ihr Haß nicht gegen ihre Mutter, die sie verlassen hatte, sondern gegen den Mann, der sie dazu gebracht hatte, mit ihm wegzulaufen.
Wie oft hatte man Lord Geltsdale als Ladykiller geschildert, dem keine Frau widerstehen konnte! Männer! Sie waren wie Feinde, wie eine Gefahr, der sie ein Leben lang aus dem Wege gehen würde!
Marisa sprang auf und trat wieder ans Fenster. Morgen würde sie nach Vox Castle reisen. Sie hatte hart darum gekämpft, ihren Willen durchzusetzen, doch jetzt empfand sie ein merkwürdiges Unbehagen angesichts des Abenteuers, in das sie sich selbst manövriert hatte.
Aber plötzlich erschien wieder das zynische Gesicht des Herzogs vor ihrem geistigen Auge und bestärkte sie in ihrem Entschluß.
Ich werde ihn bloßstellen, beschloß sie. Ich werde ihn in meinem Buch entlarven, ihn so treffend charakterisieren, daß jedermann ihn durchschaut! Ich werde ihn der Lächerlichkeit preisgeben. Selbst seine Freunde und Anhänger sollten sich mit Grausen von ihm abwenden!
Sie lachte leise vor sich hin. Das würde ihre Rache sein. Ihr Buch würde wie eine Bombe in der feinen Gesellschaft einschlagen!
Der Gedanke an ihren baldigen Triumph vermittelte ihr ein Gefühl der Stärke und nahm ihr die Angst vor der ungewissen Zukunft.