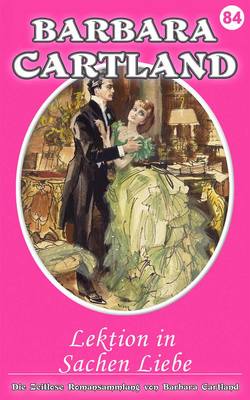Читать книгу Lektion in Sachen Liebe - Barbara Cartland - Страница 3
2.
ОглавлениеAuf der Reise nach Vox Castle malte Marisa sich in den schillerndsten Farben aus, wie sie ihr Vorhaben verwirklichen würde.
Sie hatte sich den Luxus geleistet, Erster Klasse zu fahren, um nicht in einem überfüllten Abteil sitzen zu müssen. So konnte sie ungestört ihren Gedanken nachhängen. Der Zug würde am frühen Nachmittag in Vox eintreffen.
Am frühen Morgen war sie bei ihrer Tante in London angekommen und hatte fast eine Stunde warten müssen, bis die Gräfin sie empfangen hatte.
In ihrem luxuriös ausgestatteten Boudoir hatte Lady Berrington vor dem Frisierspiegel gesessen und sich von ihrer Zofe das Haar frisieren lassen.
»Das genügt, Rose«, sagte sie, als ihre Nichte eintrat. »Ich möchte mit Lady Marisa allein sein.«
Die Zofe zog sich knicksend zurück. Die Gräfin wandte sich um und sah Marisa forschend an.
»Besteht keine Möglichkeit, daß du deine Meinung änderst?« fragte sie.
»Nein, natürlich nicht, Tante Kitty«, erwiderte Marisa. »Ich wünsche dir einen guten Morgen und danke dir für das Telegramm.«
»Offenbar ist gerade wieder eine Gouvernante gegangen«, berichtete Lady Berrington. »Aber, Marisa, ich habe nächtelang kein Auge zugetan, weil ich immer an das schreckliche Buch denken mußte, das du schreiben willst und das uns alle ins Unglück stürzen kann.«
»Ich habe dir versprochen, weder dich noch Onkel George auf irgendeine Weise zu belasten«, erklärte Marisa. »Niemand wird jemals erfahren, wer der Autor ist.«
»Gib diesen Wahnsinnsplan auf, ich flehe dich an!« Lady Berrington war ehrlich besorgt. »Ich habe schreckliche Angst, daß irgendjemand die Wahrheit herausfindet. Das würde man uns nie verzeihen! Niemals!«
»Ich verspreche dir, das wird nicht geschehen, Tante Kitty«, beruhigte sie Marisa. »Erzähl mir jetzt, was du von Vox gehört hast.«
»Als Antwort auf meinen Brief bekam ich ein Telegramm«, begann Lady Berrington, »Miss Whitcham bat mich darin, dich sofort zu ihr zu schicken. Ich telegraphierte ihr, daß du noch heute die Reise antreten wirst. Hast du genügend Fahrgeld? Man wird es dir natürlich zurückerstatten.«
»Ich habe genügend Geld, danke«, erwiderte Marisa. »Ich bin dir von Herzen dankbar, Tante Kitty, und ich werde dich nie wieder mit einem Anliegen belästigen, nachdem du mir einen so großen Gefallen getan hast.«
»Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann fahr’ nicht«, bat Lady Berrington seufzend. »Ich bin so schrecklich nervös, Marisa. Lieber würde ich dich sogar als Anstandsdame nach London begleiten, als dir zu erlauben, dieses Buch zu schreiben.«
»Ich würde es in jedem Falle schreiben«, erklärte Marisa.
»Die Kleider sind schon gepackt. Wie schön wäre es, wenn du sie als deine Aussteuer betrachten und dich mit einem netten Mann vermählen würdest, statt diese unsinnige Stellung auf Vox Castle anzutreten, die dir und uns nur schaden kann, wenn man dahinterkommt.«
Sie hielt erschöpft inne und fuhr nach einer Weile fort: »Kannst du dir vorstellen, was die Leute sagen würden, wenn herauskäme, daß Georges Nichte als gewöhnliche Gouvernante tätig ist?«
»Es könnte seinem Ansehen in seinen Clubs ein wenig schaden«, spöttelte Marisa.
»Laß diese Scherze!« sagte die Gräfin unwillig. »Geh jetzt nach oben und zieh das blaue Reisekostüm an, das Rose für dich zurechtgelegt hat! Ich weiß nicht, warum, aber in Schwarz siehst du mit deinem feuerroten Haar wie eine Dirne aus.«
»Ich hätte es vielleicht doch färben sollen«, meinte Marisa.
»Verschwinde, bevor ich die Fassung verliere!«
Marisa zog sich um. Das saphirblaue Reisekostüm mit passendem Cape und der kleine Hut verliehen ihr trotz des strengen Knotens, zu dem sie ihr rotes Haar bändigte, keineswegs das Aussehen einer gewöhnlichen Gouvernante, wie Lady Berrington sich ausdrückte.
Ihre Tante musterte sie mißbilligend, als sie sich von ihr verabschiedete.
»Dein Glück, daß es auf Vox Castle keine Herrin gibt«, bemerkte sie. »Sie würde sich weigern, dich als Erzieherin ihres Kindes in ihrem Haus zu dulden.«
»Vielleicht fällt dem Herzog gar nicht auf, daß eine Neue da ist«, meinte Marisa leichthin.
»Vermutlich wird er gar nicht anwesend sein«, entgegnete Lady Berrington. »Im Augenblick ist er vollauf damit beschäftigt, Lady Wantage den Hof zu machen, obwohl ich nicht begreifen kann, was er an dieser dummen, ständig kichernden Person findet.«
»Lady Wantage«, wiederholte Marisa nachdenklich. »Ist sie nicht eine dieser professionellen Schönheiten«, welche die Titelblätter der Magazine schmücken?«
»Ich habe für solche Frauen nichts übrig, und für Hetty Wantage schon gar nicht«, erklärte ihre Tante verächtlich.
»Nun, wenn der Herzog gefühlsmäßig gebunden ist, brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen, daß er mir nachstellen könnte.«
Lady Berrington lachte.
»Du glaubst doch nicht im Ernst, daß Valerius sich dazu herablassen würde, einer Gouvernante nachzustellen? Falls du dir Vox Castle nur ausgesucht hast, um den reichsten, bedeutendsten und begehrtesten Junggesellen einzufangen, den die Gesellschaft vorzuweisen hat, Marisa, dann wirst du bitter enttäuscht werden.«
»Ich habe keineswegs die Absicht, den Duke einzufangen, wie du es nennst«, erwiderte Marisa. »Du scheinst mir einfach nicht glauben zu wollen, Tante Kitty, daß Männer mich nicht im geringsten interessieren. Ich habe nicht die Absicht, jemals zu heiraten.«
»Du würdest deine Meinung rasch ändern, wenn du verliebt wärst«, sagte Kitty Berrington weise. »Doch mit deinen radikalen Ansichten wirst du wohl niemals einen anständigen Mann finden, der sich in dich verliebt.«
»Dann bin ich ja vor ihnen sicher«, stellte Marisa lächelnd fest. »Die Liebe hat in meinen Zukunftsplänen nämlich keinen Platz. Falls ich ein Herz habe, dann ist es zu einem Eisberg erstarrt, und es müßte schon ein Vulkan ausbrechen, um es zum Schmelzen zu bringen. Doch dazu wäre wohl kein Mann fähig.«
»Dann gleichst du in dieser Hinsicht jedenfalls nicht deiner Mutter«, bemerkte Lady Berrington.
»In dieser Hinsicht sicher nicht«, pflichtete Marisa ihr bei.
Während sie sich dieses Gespräch ins Gedächtnis zurückrief und draußen die Landschaft vor den Fenstern des Zuges vorbeiflog, stellte sie fest, wie typisch es für ihre Tante und deren Freundinnen war, sich mit nichts anderem zu beschäftigen als mit der Liebe und damit, Männern nachzustellen. Etwas anderes hatten sie nicht im Sinn.
Marisa hatte von Mrs. Featherstonehaugh erfahren, daß diese Leute die Liebe wie ein Spiel betrieben, das nach bestimmten Regeln ablief.
Der Prinz und seine Anhänger hätten zum Beispiel niemals einer jungverheirateten Frau den Hof gemacht. Das galt als ausgesprochen geschmacklos und hätte Aufsehen erregt und Ablehnung geweckt. Die jungen Ehefrauen der »Marlborough House Clique« hatten sich entsprechend zu verhalten und ihren Gatten Kinder zu gebären, die sie zumindest die ersten zehn Jahre ihrer Ehe beschäftigten. Danach pflegten sich die Damen in diskrete Liebesaffären einzulassen, welche die Ehegatten oft sogar tolerierten.
Der Herzog würde sich gewiß an diese ungeschriebenen Regeln halten. Marisa wußte nicht genau, wie alt Lady Wantage war, vermutlich war sie Mitte Dreißig. Die Abbildungen, die von ihr im Umlauf waren, zeigten ein hübsches, aber etwas fades Puppengesicht, wie Marisa sich erinnerte. Sie war entschlossen, alle Einzelheiten der Affären des Herzogs in Erfahrung zu bringen,, um ihn in ihrem Buch gründlich bloßstellen zu können.
Obgleich Diskretion in diesen Kreisen oberstes Gebot war, gab es immer jemanden, der bereit war, seine intimen Kenntnisse über das Liebesleben prominenter Persönlichkeiten auszuplaudern.
Marisa mußte unwillkürlich lächeln, als sie an den Stapel beschriebener Bögen dachte, der sich ganz unten in ihrer großen ledernen Reisetasche befand. Sie war verschlossen und würde nicht wie die Koffer, die ihre Tante ihr überlassen hatte, von irgendwelchen Dienstboten ausgepackt werden.
Der Zug hatte die private Haltestelle von Vox Castle beinahe erreicht, als sie zum ersten Mal an das Kind dachte, das sie unterrichten sollte. Der ständige Wechsel der Gouvernanten hatte sich sicher nicht gerade vorteilhaft auf den Wissensstand des kleinen Mädchens ausgewirkt, überlegte Marisa. Sie würde dafür sorgen, daß man ihr die besten Lehrbücher besorgte, die zu bekommen waren.
Eine geschlossene Kutsche, die von einem prachtvollen Gespann gezogen wurde, erwartete sie an der kleinen Haltestation mit dem winzigen, aber komfortablen Warteraum. Außer dem Kutscher befand sich ein Lakai auf dem Kutschbock. Marisa ließ sich aufatmend in die weichen Polster des Gefährts sinken und stellte mit Genugtuung fest, daß sich zumindest der Einzug der Gouvernante auf Schloß Vox stilgerecht vollziehen würde.
Gleichzeitig aber war ihr klargeworden, daß sie in der gewiß sehr zahlreichen Dienerschaft nur eine unbedeutende Position einnehmen würde.
Der Anblick von Vox Castle war atemberaubend. Neben einem riesigen normannischen Turm ragten unzählige Dächer, Kamine und Türmchen in den wolkenlosen Himmel und ließen das Schloß wie ein kostbares Juwel erscheinen.
Steinterrassen und gepflegte Rasenflächen führten zu einem See, der von einem mit zahlreichen Brücken überspannten Fluß gespeist wurde.
Hunderte von Fensterscheiben glänzten in der Sonne, das Ganze war so schön und majestätisch, daß Marisa den Anblick wie gebannt auf sich wirken ließ.
Der Gedanke, daß dieses zauberhafte Schloß dem Mann gehörte, den sie haßte, erfüllte sie mit Bedauern, denn er würde ganz gewiß die Schönheit seines Besitzes nicht zu schätzen wissen.
Oben an der Freitreppe, die zu einem mit Säulen gesäumten Portal führte, wurde sie von einem ältlichen Butler begrüßt, der einen der Lakaien anwies, Marisa zu begleiten.
»Miss Whitcham erwartet Sie, Miss Mitton«, teilte der Butler ihr in väterlichem Ton mit, den er gewiß nicht angeschlagen hätte, wäre sie unter ihrem richtigen Namen in Vox Castle erschienen.
Sie lächelte bei dem Gedanken vor sich hin und folgte dem Diener.
»Hatten Sie eine gute Reise, Miss?« erkundigte sich der Lakai freundlich. »Vermutlich sind Sie Erster Klasse gereist, wie? Wer sich’s leisten kann, gut und schön. Ich für meine Person finde keinen Gefallen an den harten Sitzen und dem Schmutz, der durch alle Ritzen dringt, so daß man am Ende der Reise wie ein Schornsteinfeger aussieht.«
»Man spricht davon, daß Verbesserungen geplant sind«, erwiderte Marisa.
»Bis dahin ziehe ich jedenfalls die Reisekutsche vor«, erklärte der Lakai. »Passiert sowieso selten, daß ich nach London fahre, viel zu teuer für unsereins, es sei denn, Seine Gnaden bezahlt‘s.«
Er lachte, als hätte er einen Scherz gemacht, öffnete dann eine Tür und meldete in respektvollem Ton: »Die neue Gouvernante, Miss.«
Marisa betrat einen gemütlich eingerichteten Raum und erblickte eine Frau mittleren Alters hinter einem Schreibtisch. Miss Whitcham war korpulent, hatte graues Haar und trug ein schlichtes Tweedkostüm mit einer gestärkten Rüschenbluse.
Sie nahm den Kneifer ab und ließ ihn in einem kleinen blauen Emaille Etui verschwinden, das sie in die Brusttasche ihres Kostüms steckte.
»Willkommen, Miss Mitton. Ich bin Ihnen sehr verbunden, daß Sie so rasch gekommen sind.«
»Glücklicherweise war ich in der Lage, Ihrem Wunsch unverzüglich nachkommen zu können«, erwiderte Marisa und hoffte, den angemessenen Ton gefunden zu haben.
»Bitte, nehmen Sie doch Platz.«
Miss Whitcham wies auf einen Stuhl und setzte sich ihr gegenüber.
»Lady Berrington hat Sie sehr gelobt«, begann sie dann, »und da sie und der junge Graf enge Freunde Seiner Gnaden sind, war das für mich die beste Empfehlung. Der Herzog hält sich im Augenblick in Schottland auf, so daß ich Sie in seinem Namen auf dem Schloß willkommen heißen darf.«
Marisa nickte lächelnd, und Miss Whitcham fuhr nach einer Weile fort: »Sie sehen sehr jung aus. Sind Sie tatsächlich schon vierundzwanzig, wie Lady Berrington in ihrem Empfehlungsschreiben erwähnte?«
»Ich kenne Lady Berrington schon seit vielen Jahren«, wich Marisa geschickt aus.
Miss Whitcham schien nicht recht zu wissen, wie sie das, was sie nun zu sagen hatte, in Worte fassen sollte: »Ich sollte Ihnen wohl erklären, Miss Mitton, daß Lady Aline Verley ein recht schwieriges Kind ist.«
»Wie Lady Berrington mir mitteilte, hatten Sie schon mehrere Gouvernanten.«
»Wie wahr, wie wahr«, sagte Miss Whitcham seufzend. »Miss Graves, Ihre Vorgängerin, verließ das Schloß Hals über Kopf.«
»Wegen Lady Aline?« fragte Marisa.
»Leider«, gab Miss Whitcham zu. »Sie ist unberechenbar, und man weiß nie, was sie als nächstes anstellen wird.«
»Was hat sie Miss Graves angetan?« erkundigte sich Marisa.
»Sie hat ihr eine Schlange ins Bett gelegt!« erwiderte Miss Whitcham tonlos.
»Wie, um Himmels willen, ist das Kind zu einer Schlange gekommen?«
»Es war eine völlig harmlose Blindschleiche. Was Miss Graves natürlich nicht wußte. Sie ekelte sich vor Schlangen und wollte keine Stunde länger im Schloß bleiben, und wenn man ihr einhundert Pfund geboten hätte.«
Marisa unterdrückte ein belustigtes Lächeln.
»Vermutlich kannte Aline Miss Graves Angst vor Schlangen?«
»Das würde mich nicht überraschen«, entgegnete Miss Whitcham. »Um ganz ehrlich zu sein, Miss Mitton: Ich muß gestehen, daß ich Aline gegenüber machtlos bin. Ich habe versucht, wie eine Mutter mit ihr zu reden, aber sie ist einfach ungezogen und widerspenstig. Ich kann nur von Herzen hoffen, daß Ihnen gelingen wird, woran die anderen gescheitert sind.«
»Ich werde mein Bestes tun«, versprach Marisa. Einen Vorteil hatte sie zumindest gegenüber den vorherigen Gouvernanten, die auf Vox Castle gekommen waren: Sie hatte nicht die Absicht, lange hierzubleiben. In zwei, drei Monaten würde sie ihr Buch beendet haben. Mit etwas Glück würde es genügend einbringen, ihr zu ermöglichen, mit Erlaubnis ihres Onkels zu ihrer alten, im Ruhestand lebenden Gouvernante ins Auszugshaus zu ziehen, das zum Berrington-Besitz gehörte.
Sie würden sich sehr gut verstehen, und Miss Gillingham würde sich mit Freuden um sie kümmern. Sie würde andere Bücher schreiben und vom Honorar auf Reisen gehen und neue Eindrücke sammeln können.
Vox Castle war für sie die erste Stufe ihrer ehrgeizigen Pläne, und deshalb würde sie Lady Alines Ungezogenheiten, wie immer sie geartet sein mochten, vor allem dazu benutzen, das schlechte Benehmen der jüngeren Generation der Gesellschaft anzuprangern, ohne sich selbst darüber aufzuregen.
»Irgendwie ist das Kind schon zu bedauern«, hörte sie Miss Whitcham sagen. »Es hat keine Mutter, und der Vater . . .«
Sie sprach nicht weiter.
»Liebt der Herzog seine Tochter?« fragte Marisa.
Wieder trat eine Pause ein, dann gab Miss Whitcham zögernd zu: »Seine Gnaden sind nicht sonderlich interessiert an dem Kind.«
Marisa spürte, daß sie dazu noch eine Menge zu sagen gewußt hätte, wäre sie darum gebeten worden. Sicherlich klatschte Miss Whitcham gern. Früher oder später würde sie von ihr alles über den Herzog und das Verhältnis zu seiner Tochter erfahren, was sie wissen wollte.
Doch dazu war jetzt nicht der richtige Augenblick. Miss Whitcham erhob sich.
»Wir sollten nach oben gehen und Sie mit Aline bekannt machen. Sie wird natürlich nur tagsüber in Ihrer Obhut sein. Sie hat noch ihre alte Nanny, ihr Kindermädchen, das sich um sie kümmert, außerdem sind noch ein Hausmädchen und ein Lakai da.«
»Das hört sich gut an«, bemerkte Marisa lächelnd. »Erzählen Sie mir etwas über die Nanny.«
»Sie ist schon sehr alt und etwas schrullig«, erklärte Miss Whitcham mit gedämpfter Stimme, als sie sich der Tür näherten. »Sie begleitete die alte Herzogin aufs Schloß und gehört nicht zum angestammten Dienstpersonal. Deshalb wurde sie von den anderen Bediensteten wohl immer als Fremde betrachtet und kam, nicht gut mit ihnen aus.«
Im zweiten Stock zeigte sie Marisa ihr Wohnzimmer.
»Ich hoffe, wir zwei werden uns hier ab und zu zusammensetzen können«, sagte sie.
»Gern, vielen Dank«, erwiderte Marisa.
Die Kinderzimmer befanden sich im dritten Stock. Miss Whitcham öffnete die Tür zu einem großen Raum mit zwei riesigen Fenstern, durch die helles Sonnenlicht flutete. Eine alte Frau saß mit einer Stopfarbeit vor einem prasselnden Kaminfeuer.
Sie erhob sich, als Miss Whitcham ihr mit lauter Stimme zurief: »Guten Tag, Nanny! Ich bringe Ihnen Miss Mitton. Sie möchte Aline kennenlernen.«
Marisa sah sich im Zimmer um. Eine Wand wurde von einem Pianino eingenommen, während in einer anderen Ecke teures Spielzeug aufgetürmt war. Das Puppenhaus, das Schaukelpferd und zahlreiche Puppen und Baukästen waren so ordentlich nebeneinander aufgestellt, daß zumindest an diesem Tag niemand damit gespielt haben konnte. Auf einem kleinen Tisch neben dem Spielzeug stand ein großer Pappkarton.
Das Kinderzimmer enthielt die traditionelle Wandtafel, die mit Abziehbildern und Weihnachtskarten verziert war. Die Messingstangen des Schutzgitters vor dem Kaminfeuer glänzten im Licht der Flammen.
Auf dem Tisch in der Mitte des Zimmers lagen einige Schulbücher, daneben standen ein Tintenfaß und ein Federkasten.
»Ich habe Aline gesagt, daß Sie kommen«, wandte sich die Kinderfrau an Marisa, »und ihre Schulhefte habe ich auch bereitgelegt. Schlimm sehen sie aus.«
»Wo ist Aline?« fragte Miss Whitcham in scharfem Ton.
»Vermutlich in ihrem Schlafzimmer«, erwiderte Nanny. »Sie sagt, sie hätte genug von Gouvernanten.«
Die alte Frau ging durchs Zimmer, öffnete eine Tür und redete dem Kind gut zu.
»Nun komm schon heraus, Kleines. Die junge Dame ist den ganzen weiten Weg von London hierhergekommen, um dich zu unterrichten. Was soll sie von dir denken, wenn du sie nicht begrüßt? Daß du ein Bauerntrampel bist?«
Sie bekam keine Antwort.
»Das reicht, Nanny«, erklärte Miss Whitcham unwillig, »Überlassen Sie es mir, mit Aline zu reden.«
»Sie haben Glück, wenn sie Ihnen überhaupt zuhört«, hörte Marisa die Nanny sagen, während sie auf die Tür zuging. Dort drehte sie sich noch einmal um, und Marisa glaubte ein leichtes Lächeln in ihrem Gesicht entdecken zu können, als freue es sie, daß das Mädchen so schwierig war.
Vermutlich hetzt sie das Kind gegen alle Gouvernanten auf, dachte Marisa. Das ist verständlich, weil sie Aline als ihren Schützling betrachtet und niemand anderes Einfluß auf sie haben soll.
Miss Whitcham blieb an der Schlafzimmertür stehen.
»Komm her, Aline!« befahl sie streng. »Wenn du deine neue Gouvernante nicht sofort begrüßt, sage ich deinem Vater, wie ungezogen du warst, und du weißt, wie sehr er schlechte Manieren haßt.«
Das schien das Zauberwort gewesen zu sein, denn das Mädchen erschien augenblicklich auf der Schwelle. Sie trug ein Rüschenkleid aus Musselin mit einer blauen Taftschärpe, das für ihr Alter zu kindlich war. Sie war groß gewachsen und hätte hübsch ausgesehen, wenn sie nicht so finster dreingeblickt hätte, daß ihre Brauen sich über der Nasenwurzel fast berührten.
Sie hatte dunkles, schulterlanges Haar und dunkle Augen, die Marisa weniger feindselig als vielmehr herausfordernd musterten.
»Nun, Aline«, sagte Miss Whitcham in jenem gezwungen freundlichen Ton, den Erwachsene oft Kindern gegenüber anschlagen, »das ist Miss Mitton. Ich möchte, daß du sie willkommen heißt.«
Aline gab keine Antwort, und Miss Whitcham fuhr hastig fort: »Du mußt ihr all deine Spielsachen zeigen, besonders die hübsche Puppe, die Lady Wantage dir letzte Woche geschenkt hat. Meine Güte, ich wünschte, ich wäre noch mal so klein und bekäme auch eine so hübsche Puppe geschenkt!«
Aline rührte sich nicht von der Stelle, sondern beobachtete Miss Whitcham mit düsterem Blick, als Sie sich dem großen Pappkarton näherte.
»Heutzutage gibt es zauberhafte Puppen«, wandte diese sich an Marisa. »Diese hier trägt handgenähte Kleider aus echter Spitze. Lady Wantage erzählte mir, daß die Puppe aus Paris stammt. Stell dir vor, Aline, von so weit her!«
Dabei öffnete sie den Deckel des Kartons. Sie erstarrte mitten in der Bewegung und stieß einen unterdrückten Schrei aus.
Marisa, die neben sie getreten war, blickte in die Schachtel. Zweifellos mußte die Puppe einmal sehr hübsch gewesen sein, aber jetzt war ihr Gesicht zertrümmert, als hätte es jemand mit einem Hammer bearbeitet. Das hellrosa und mit echter Spitze besetzte Kleid war in tausend Stücke zerrissen.
»Wie konntest du nur so ungezogen sein?« rief Miss Whitcham empört. »Was wird dein Vater sagen? Lady Wantage war so nett und hat dir ein so hübsches, kostbares Geschenk mitgebracht, und du machst es kaputt!«
»Ich hasse sie!« schrie Aline plötzlich hysterisch. »Ich hasse sie und die alberne Puppe, die genauso aussieht wie sie.«
»Na, weißt du . . .«, stammelte Miss Whitcham hilflos.
Marisa nahm ihr den Kartondeckel aus der Hand und legte ihn zurück.
»Am besten lassen Sie Aline und mich jetzt allein, damit wir uns besser kennenlernen können«, schlug sie vor.
»Ja, natürlich, wenn Sie es wünschen«, erwiderte Miss Whitcham sichtlich erleichtert. »Ich kann nur sagen, daß ich dein Benehmen abscheulich finde, Aline, ganz abscheulich!«
Sie wandte sich um und verließ das Kinderzimmer. Marisa nahm ihr Reisecape ab und legte es ordentlich über eine Stuhllehne, dann trat sie vor das Kaminfeuer. Obwohl draußen die Sonne schien und es wie meist Anfang September gegen Mittag angenehm warm geworden war, hatte doch ein kühler Wind geweht, als sie auf dem Bahnsteig der kleinen Station gestanden hatte.
Sie zog ihre langen Handschuhe aus, nahm den Hut ab und legte beides auf das Cape. Ohne Aline zu beobachten, hatte sie gemerkt, wie das Kind zu einem der Fenster gegangen war.
»Ich will überhaupt keinen Unterricht mehr haben«, behauptete Aline jetzt trotzig.
»Fein!« erwiderte Marisa. »Dann habe ich viel Zeit, all die Dinge kennenzulernen, die mich interessieren.«
Eine Weile war es still, dann sagte Aline mit unverkennbarer Neugier in der Stimme: »Aber Sie sind doch erwachsen, was wollen Sie da noch lernen?«
»Viele Dinge möchte ich in Erfahrung bringen«, erwiderte Marisa. »Vor allem all die aufregenden Geschichten, die sich um dieses Schloß ranken. Ich möchte alles wissen, was Vox Castle betrifft. Warum einst ein römischer Senator ausgerechnet an diesem Ort ein Schloß errichtete und weshalb er es Vox Castle nannte.«
»Die alberne alte Geschichte kennt doch jeder«, sagte Aline verächtlich. »Sie fragten ihn, wie er zum englischen Volk sprechen wolle von einer Festung aus, und er antwortete: ,Das soll meine Stimme sein!‘«
»Gewiß, doch worüber wollte er mit ihnen sprechen?« fragte Marisa. »Das möchte ich gern wissen. Irgendwo habe ich gelesen, daß er ein Weiser war und zaubern konnte.«
»Das hab’ ich noch nie gehört«, entgegnete Aline, weiterhin um einen mürrischen Ton bemüht.
»Nun, das sind alles Dinge, die ich herausfinden möchte«, sagte Marisa, »und natürlich interessieren mich auch die Normannen, die an der gleichen Stelle ein gewaltiges Schloß bauten.«
Sie trat neben Aline ans Fenster und blickte auf den Park und die dahinterliegenden Wälder.
»Sobald ich dieses herrliche Schloß mit all seinen Schätzen erforscht habe«, fuhr sie fort, »möchte ich die Wälder durchstreifen.«
Sie schwieg einen Augenblick und rezitierte dann mit leiser Stimme: »Ein Zauber dem Walde innewohnt, wo Elfen tanzen und der Drache thront.«
»Sagten Sie - Elfen?« fragte Aline. »Nanny sagt, die gibt es gar nicht.«
»Das muß jeder selbst für sich herausfinden«, erwiderte Marisa. »Ich erinnere mich, als Kind dunkelgrüne Flecken auf dem Rasen entdeckt zu haben, und ich war fest davon überzeugt, daß sie von winzig kleinen Füßen stammten, die dort des Nachts getanzt hatten. Ich sah unter riesigen Tannen Pilze dicht beieinander stehen, die aussahen wie Ruhebänke. Und wenn ich das Ohr dicht an einen Eichenstamm preßte und angespannt lauschte, glaubte ich den Gesang der Elfen zu hören.«
Eine Weile war es still, dann fragte das Kind mit dünner Stimme: »Wollen Sie all diese Dinge ganz allem erforschen?«
»Du kannst mich begleiten wenn du magst«, antwortete Marisa gleichmütig. »Doch wenn du etwas anderes vorhast . . .«
Sie wandte sich vom Fenster ab.
»Jetzt würde ich gern erfahren, wo ich schlafen werde und ob mein Gepäck bereits gebracht worden ist.«
»Ich zeige es Ihnen«, erbot sich Aline eifrig. »Das Zimmer liegt meinem genau gegenüber. Es ist ganz hübsch, aber Miss Graves mochte es nicht, weil es nach vorn liegt und die Kutschen der Gäste zu viel Lärm machten, wenn Papa ein Fest gab.«
»Es macht doch bestimmt Spaß, sie zu beobachten«, sagte Marisa. »Findest du nicht, daß manche Leute Kutschen haben, die genau zu ihnen passen? Einige sind prunkvoll und kostbar, weichgepolstert und elegant, andere wiederum sind klapprige alte Karren mit einem müden Gaul davor, die alten, rotgesichtigen Männern mit zerbeulten Hüten und einer Tonpfeife im Mund gehören.«
Aline kicherte belustigt,
»Es gibt Leute«, prustete sie los, »die sehen aus wie ihre Pferde!«
»Der Gedanke ist mir auch schon gekommen«, gab Marisa zu.
Zwei Koffer standen bereits in dem Zimmer, das Aline ihr zeigte. Zwei weitere sollten nachkommen. Tante Kitty hatte ihre Nichte großzügig ausgestattet. Ein Hausmädchen mit rosigem rundem Gesicht war bereits damit beschäftigt, die Sachen auszupacken.
»Soll ich die Kleider in den Schrank hängen, Miss?« fragte das Mädchen.
»Das wäre nett, vielen Dank.«
Marisa legte Cape, Hut und Handschuhe aufs Bett und wandte sich dann Aline zu.
»Bis zur Teestunde könnten wir noch eine kleine Entdeckungsreise machen, finde ich. Würdest du mir die unteren Räumlichkeiten zeigen?«
Eine Stunde später kehrten sie ins Kinderzimmer zurück. Marisa hatte die Gemäldegalerie besichtigt, die eine wertvolle Sammlung von van Dycks enthielt, Salons mit herrlichen Stilmöbeln und die Bibliothek, die ihr einen Entzückensschrei entlockte.
»Sind doch nur alte Bücher«, meinte Aline, die immer noch versuchte, sich nicht für das zu begeistern, was Marisa gefiel.
»Bücher sind voller Spannung und Geheimnisse«, erklärte Marisa dem Kind. »Es gibt auch welche über Feen und Elfen, und wenn wir uns große Mühe geben, finden wir vielleicht sogar Abbildungen davon.«
»Wirklich?« fragte Aline mit großen Augen. »Das hat mir noch niemand erzählt.«
»Vielleicht solltest du’s nicht wissen«, entgegnete Marisa achselzuckend und erreichte damit genau das, was sie erreichen wollte: Aline war entschlossen, sich nichts mehr vorenthalten zu lassen, was sie interessierte.
»Sollen wir gleich nachsehen?« schlug das Kind vor.
Marisa hatte auf dem Mitteltisch der Bibliothek einen roten Lederband entdeckt und schlug ihn auf. Ihre Vermutung bestätigte sich; es handelte sich um einen Katalog.
»Damit können wir uns behelfen«, sagte sie. »Erinnerst du dich, Aline, als ich dir im Salon die Geschichte des wunderhübschen kleinen Tisches erzählte, der Königin Marie Antoinette gehörte? Oder von den Damen bei Hofe, die so alberne, hohe Perücken trugen, bis eine der Damen eines Tages feststellte, daß sich Mäuse in ihrer Haarpracht eingenistet hatten.«
Aline kicherte vergnügt.
»Sie muß sehr dumm gewesen sein! Sie hätte sie doch piepsen hören müssen!«
»Wollen wir nachschauen, ob wir in einem der Bücher hier vielleicht eine Abbildung einer solchen Perücke finden?« schlug Marisa vor.
»Wo fangen wir an?« Aline war Feuer und Flamme.
Sie stiegen die zierliche Wendeltreppe hoch, die zu einer kleinen Galerie führte, die unter anderem die französische Abteilung beherbergte. Zu Alines Entzücken entdeckte Marisa einen Bildband über Kostüme und Frisuren aus der Zeit Ludwigs XV.
Sie amüsierten sich über die turmhohen Perücken und die weiten Reifröcke, dann stellte Marisa das Buch ins Regal zurück.
»Wir müssen es genau an seinen Platz zurückstellen«, belehrte sie Aline, »sonst verbietet man uns womöglich, die Bibliothek zu benutzen, weil wir alles durcheinandergebracht haben.«
»Das kann man uns nicht verbieten«, erklärte Aline heftig.
»Sicher nicht, wenn wir sehr sorgfältig mit den Büchern umgehen«, erwiderte Marisa. »Doch jetzt sollten wir schleunigst nach oben gehen, um unseren Tee zu trinken.«
»Ich mag keinen Tee«, murrte Aline.
»Aber ich«, erklärte Marisa. »Wenn ich keinen Tee und etwas Gebäck bekomme, werde ich bestimmt zu schwach sein, dir weitere Geschichten zu erzählen.«
»Kennen Sie noch mehr solche spannende Geschichten?« fragte Aline interessiert.
»Unzählige«, erwiderte Marisa. »Und wenn ich keine mehr weiß, suchen wir in eurer herrlichen Bibliothek neue heraus und lesen sie gemeinsam.«
»Stehen in den Büchern wirklich so spannende Geschichten drin?« fragte Aline mißtrauisch. »Nanny sagt, sie wären nichts als alte Staubfänger.«
Es war offensichtlich, daß Nanny viel Schuld an Alines mangelndem Lerneifer und ihrem störrischen Benehmen hatte.
Im Kinderzimmer war der Teetisch bereits gedeckt, und Marisa schlug vor, die Hände zu waschen, bevor sie sich an den Tisch setzten.
»Ich mag meine Hände nicht waschen«, sagte Aline trotzig.
»Aber ich«, erwiderte Marisa. »Im Zug wird man immer scheußlich schmutzig, und ich mag keinen Staub und Ruß essen.«
Sie begab sich in ihr Zimmer. Als sie zurückkehrte, sah sie, daß Aline sich ebenfalls die Hände gewaschen hatte, ging aber mit keinem Wort darauf ein.
Bei Tisch meinte Marisa im Plauderton: »Wir sollten in diesem Zimmer einiges verändern.«
»Eine meiner Gouvernanten hat mal die Möbel umgestellt, aber Nanny hat dann alles wieder an den alten Platz gerückt, weil sie keine Veränderungen mag.«
»Ich finde, es macht Spaß«, beharrte Marisa. »Als erstes sollten wir dieses Zimmer nicht mehr Kinderstube nennen, sondern Unterrichtsraum. In deinem Alter braucht man kein Kinderzimmer mehr.«
»Wirklich?« fragte Aline.
»Allerdings«, erwiderte Marisa. »Das gilt auch für die Spielsachen.«
Alines Blick wanderte zu den Sachen in der Ecke.
»Sie meinen, wir sollten sie einfach wegräumen?«
»Warum nicht? Wir räumen sie beiseite und schenken sie irgendwann einmal einem armen kleinen Mädchen, das sich darüber bestimmt sehr freuen wird. Du könntest die Sachen dann selbst hinbringen.«