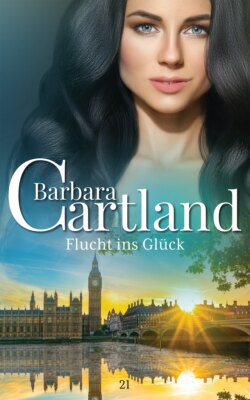Читать книгу Flucht ins Glück - Barbara Cartland - Страница 2
1
ОглавлениеDie Tür flog auf.
„Ist mein Kleid denn immer noch nicht fertig?“ fragte Charlotte unfreundlich.
Ihre Kusine Melinda saß am Fenster. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne fielen auf das zarte Muster, das sie auf das Ballkleid aus rosa Taft stickte.
„Ich brauche nicht mehr lange, Charlotte“, sagte sie. Ihre Stimme war angenehm weich. „Ich habe erst spät damit anfangen können.“
„Weil du wieder im Stall bei deinem Pferd gewesen bist. Wenn du so weitermachst, bitte ich Papa, daß er dir das Ausreiten verbietet. Du wirst schon sehen, daß du dann mehr Zeit für deine Pflichten im Haushalt hast.“
„Bitte nicht!“ flehte Melinda. „So grausam kannst du doch nicht sein.“
„Grausam?“ wiederholte Charlotte. „Du wirst doch wohl nicht behaupten wollen, daß wir grausam zu dir sind. Sarah Ovington hat mir erst diese Woche erzählt, daß die arme Verwandte, die bei ihnen wohnt, beim Ausfahren immer mit dem Rücken zu den Pferden sitzen muß. Du weißt ganz genau, Melinda, daß ich dich immer neben mir sitzen lasse.“
„Das ist auch sehr lieb von dir, Charlotte“, sagte Melinda. „Es tut mir leid, daß ich so spät mit deinem Kleid angefangen habe, aber Ned hat mir ausrichten lassen, daß Flash nicht frißt. Ich war kaum im Stall, da hat er sich auf die Futterkrippe gestürzt.“
„Dein Pferd ist genauso hysterisch wie du. Ich verstehe Papa einfach nicht. Wie kann er dir eine Box überlassen, wenn für unsere eigenen Pferde kaum Platz ist.“
„Bitte, Charlotte, sag nichts zu Onkel Hector“, bettelte Melinda. „Ich tu’ alles, was du von mir verlangst, und wenn ich die ganze Nacht dasitze und sticke.“
Tränen schossen Melinda in die blauen Augen. Charlotte sah die Kusine mit bösem Blick an. Dann wurde ihre Miene plötzlich scheinheilig.
„Verzeih, Melinda“, sagte sie. „Verzeih, daß ich so häßlich zu dir gewesen bin. Es tut mir leid, aber Papa hat mir schon wieder Vorwürfe gemacht.“
„Weswegen denn?“ fragte Melinda.
„Deinetwegen.“
„Meinetwegen?“ fragte Melinda betroffen.
„Ja, deinetwegen“, sagte ihre Kusine und ahmte dann ihren Vater nach. „Warum siehst du nicht anständig und proper aus wie Melinda? Warum sieht dein Kleid wieder wie ein Sack aus? Melinda hat wirklich bloß alte, abgetragene Sachen und wirkt immer elegant.“
„Ich kann mir nicht vorstellen, daß Onkel Hector so etwas sagt.“
„Und ob er das sagt.“ Charlotte stampfte mit dem Fuß auf. „Und Mama sagt es auch, obwohl sie dich wirklich nicht leiden kann.“
„Ich weiß“, sagte Melinda und stieß einen kleinen Seufzer aus. „Ich tue alles, um Tante Margaret zu erfreuen, aber ich kann machen, was ich will - es ist falsch.“
„Das ist nicht der Grund“, sagte Charlotte. „Mama hat dich nicht gern im Haus, weil du hübsch bist. Sie will mich verheiraten, und jeder Gentleman, der zu uns kommt, hat nur Augen für dich.“
Melinda lachte.
„Das stimmt doch gar nicht, Charlotte. Das bildest du dir bloß ein. Denk doch nur an letzte Woche. Captain Parry ist bei der Gartenparty nicht von deiner Seite gewichen.“
„Weil er dich da noch nicht gesehen hatte“, sagte Charlotte. Sie packte die Kusine plötzlich am Arm und zog sie vom Stuhl. „Komm her und schau es dir selber an.“
„Was machst du denn da!“ rief Melinda. „Paß doch wenigstens auf dein Kleid auf.“
Es rutschte auf den Boden. Charlotte zog die Kusine vor den großen Spiegel und stellte sich daneben.
„Bitte!“ sagte Charlotte verbittert. „Schau doch selber.“
Ein ängstlicher Ausdruck schlich sich auf Melindas ebenmäßiges Gesicht. Natürlich wußte sie, wie unterschiedlich sie und ihre Kusine aussahen.
Charlotte war dicklich und hatte schwere Knochen. Ihre Haut war grau und fleckig - kein Wunder bei den Mengen von Pudding und Schokolade, die sie in sich hineinstopfte. Ihr Haar war glanzlos, die Farbe schwer definierbar. Weder braun noch aschblond. Die Zofe von Lady Stanyon konnte sich noch so anstrengen, Charlottes Frisur war immer eine Katastrophe. Charlotte hatte im Grunde kein unhübsches Gesicht, aber durch ihre ständige Unzufriedenheit hatte sich ein verbitterter Zug um den Mund und eine scharfe Falte zwischen den Brauen eingegraben. Daß sie auf ihre Kusine neidisch und deshalb eifersüchtig war, war irgendwie zu verstehen.
Melinda dagegen war zierlich und gertenschlank. Sie hatte schmale weiße Hände. Sie bewegte sich mit einer Grazie, die berauschend war. Das Auffallendste in dem herzförmigen Gesicht waren die großen tiefblauen Augen. Die dunklen Brauen verliefen in einem perfekten Bogen. Ihr Haar - es hatte die Farbe reifen Weizens - fiel in natürlichen Locken auf die Schultern herab.
„Siehst du jetzt, was ich meine?“ fragte Charlotte mit harter Stimme.
Melinda wandte sich ab. Natürlich sah sie, was ihre
Kusine meinte, und sie wußte auch, warum Charlotte sie vor kurzem „den Kuckuck im Nest“ genannt hatte.
„Meine Mutter hat immer betont“, sagte Melinda leise, „daß man sich vor Vergleichen hüten soll. Jeder Mensch hat seine eigenen Qualitäten. Denk doch nur daran, wie gut du fremde Sprachen sprechen kannst. Und deine Aquarelle sind viel gefälliger als meine.“
„Wer fragt schon nach Aquarellen?“ sagte Charlotte schnippisch.
Melinda ging wieder zu ihrem Platz am Fenster und hob das Kleid auf.
„Noch fünf Minuten, dann bin ich fertig“, sagte sie. „Du wirst zauberhaft aussehen, wenn du heute Abend mit Lady Withering dinierst. Vielleicht ist auch Captain Parry da. Daß ich nicht eingeladen bin, weißt du ja.“
„Du warst aber eingeladen“, sagte Charlotte, und die Falte zwischen den Brauen wurde noch tiefer. „Mama hat bloß behauptet, daß du nicht da bist.“
Melinda biß die Zähne zusammen und atmete tief durch.
„Tante Margaret hat gut daran getan, für mich abzusagen. Du weißt, daß ich nichts anzuziehen habe.“
„Du kannst doch Papa bitten, daß er dir ein Ballkleid genehmigt.“
„Ich habe doch noch Trauer“, sagte Melinda.
„Das ist nicht wahr, und das weißt du auch. Du mußt dein graues und braunes Zeug weiter tragen, weil Mama es so will. Sie hat Angst, daß sie dich zu Partys mitnehmen muß und mich niemand mehr beachtet, wenn du auch noch in schillernden Gewändern erscheinst.“
„Ach, Charlotte!“ rief Melinda bestürzt. „Du weißt doch, daß ich wirklich nirgends und bei niemand auffallen will.“
„Natürlich weiß ich es - und das macht alles nur noch schlimmer“, sagte Charlotte und sah noch einmal in den Spiegel. „Ich müßte ein paar Pfund abnehmen, aber ich will nun einmal die köstlichen Süßspeisen nicht aufgeben, die unser Küchenchef zubereitet, von dem frischen Brot ganz zu schweigen, das er uns jetzt jeden Morgen zum Frühstück servieren läßt. Manchmal frage ich mich, ob es sich wirklich lohnt, einem Mann gefallen zu wollen - aber was bleibt einem denn anderes übrig, als zu heiraten?“
„Ich glaube nicht, daß ich je einen Mann finde“, sagte Melinda und lächelte schwach. „Wer will denn schon eine arme Verwandte, die keine Mitgift hat - wie Tante Margaret immer wieder betont.“
„Mich würde interessieren“, sagte Charlotte, „warum dein Vater so verschwenderisch gewesen ist. Manchmal frage ich mich, wovon ihr überhaupt gelebt habt, bevor deine Eltern bei dem Kutschenunglück umgekommen sind.“
„Ich glaube, es war nie viel Geld da“, sagte Melinda bescheiden. „Wir hatten natürlich das Haus und den Garten und die Dienerschaft, die seit Jahren bei uns war. Wir haben uns nie für arm gehalten, aber mein geliebter, leichtlebiger Vater hat eben nie Rechnungen bezahlt.“
„Ich erinnere mich noch genau, wie tief betroffen Mama und Papa gewesen sind, als sie erfahren haben, wie hoch dein Vater verschuldet war.“ Charlotte zuckte mit den Schultern. „Es bleibt uns nichts anderes übrig, hat Papa damals gesagt. Mittellos wie sie ist, nimmt sie doch sonst keiner.“
„Ich hätte damals selbständiger sein sollen“, sagte Melinda mit einem Seufzer. „Ich hätte darauf bestehen sollen, daß man mich eine Stellung als Gouvernante oder Gesellschafterin annehmen läßt.“
„Das hätte Papa nie erlaubt“, sagte Charlotte. „Die Nachbarn hätten geredet, und du weißt, wie wichtig ihm sein Ruf ist. Es ist eben bloß ein Jammer, Melinda, daß du so hübsch bist.“
„Ich bin doch nicht wirklich hübsch, Charlotte“, widersprach Melinda schnell. „Ich bin bloß kleiner als du, das ist alles.“
„Nein, das ist eben nicht alles!“ rief Charlotte wie ein trotziges Kind aus. „Weißt du, was ich neulich Lord Ovington habe sagen hören?“
„Nein“, antwortete Melinda, den Kopf über die Stickerei gebeugt. „Was hat er denn gesagt?“
„Er wußte natürlich nicht, daß ich es höre“, erklärte Charlotte, „aber er hat zu Colonel Gillingham gesagt: ,Diese Nichte von Hector wird einmal eine Schönheit. Wenn er da nicht aufpaßt, bekommt er eine ganze Menge Ärger.’“
„Hat er das wirklich gesagt?“ fragte Melinda erstaunt.
„Ja. Ich wollte es dir erst nicht erzählen, aber jetzt ist es mir doch rausgerutscht. Ich kann dir einfach nichts verheimlichen, Melinda.“
„Und was hat Colonel Gillingham geantwortet?“ wollte Melinda wissen. „Dieser Mann hat eine Ausstrahlung, die mich erschreckt. Als er das letzte Mal hier diniert hat, hat er mich pausenlos beobachtet. Ich weiß nicht warum, aber mir ist angst und bange geworden. Er ist wie ein Teufel in Menschengestalt.“
„Aber Melinda!“ rief Charlotte. „Wie kannst du denn so übertreiben? Colonel Gillingham ist ein Jugendfreund von Papa. Sie gehen zusammen auf die Jagd und sitzen bis in die frühen Morgenstunden im Rauchsalon - was Mama jedes Mal ärgert. Wie alle Freunde von Papa ist er ein ganz langweiliger Mann und sonst nichts.“
„Mir ist er kreuzunsympathisch“, sagte Melinda. „Du hast mir aber immer noch nicht erzählt, was er geantwortet hat.“
„Ich bin nicht ganz sicher, ob ich mich nicht verhört habe, Melinda, aber ich glaube, er hat gesagt, daß er dich auch hübsch findet, daß du aber bestimmt über die Stränge schlägst, wenn man die Zügel locker läßt.“
„Wie kannst du so über mich sprechen, Charlotte!“ rief Melinda, und ihre Wangen röteten sich. Wenn sie sich ärgerte, schienen Flammen aus ihren Augen zu schießen.
„Ach, mach dir doch nichts draus“, sagte Charlotte und lachte. „Ich hätte es dir nicht erzählen sollen. Ich wollte, ich würde solche Komplimente über mich hören.“
„Heute Abend macht man dir bestimmt Komplimente“, sagte Melinda. „Hier, dein Kleid ist fertig. Weißt du eigentlich, daß es dir besser steht als alle deine anderen Kleider zusammen?“
„Mama sagt immer, daß es auf die richtige Farbe ankommt, ob ein Mädchen in einem Ballsaal auffällt oder nicht.“ Charlotte legte den Kopf zur Seite und überlegte. „Meinst du, Captain Parry mag rosa?“ fragte sie.
„Ich bin überzeugt davon“, sagte Melinda.
„Hoffentlich. Gott sei Dank kommst du nicht mit, Melinda.“
Ein Klopfen an der Tür.
„Ja, bitte“, rief Melinda.
Es war ein junges Zimmermädchen.
„Miss Melinda“, sagte es aufgeregt, „Sie sollen bitte unverzüglich zu Sir Hector in die Bibliothek kommen.“
Die beiden Mädchen sahen sich erschreckt an.
„Was habe ich denn jetzt schon wieder angestellt?“ fragte Melinda ängstlich. „Charlotte, du hast doch nichts wegen Flash gesagt, oder?“
„Nein, natürlich nicht“, antwortete Charlotte. „Ich wollte dich bloß ärgern.“
„Warum will er mich dann sprechen?“ Melinda schüttelte den Kopf. „Noch dazu zu dieser Tageszeit. Das ist sehr ungewöhnlich.“
Sie sah auf die Uhr über dem Kamin. Die Zeiger rückten auf die Sechs vor.
„Ich muß mich jetzt umziehen“, sagte Charlotte. „Komm anschließend in mein Zimmer und erzähl mir, was er von dir wollte. Hoffentlich hat es mit mir nichts zu tun.“
Melinda nickte. Ihr Gesicht war blaß und verängstigt, als sie noch schnell einen Blick in den Spiegel warf und den Rock des einfachen grauen Baumwollkleids mit dem gestärkten weißen Kragen glatt strich. Sie trug keine Krinoline. Lady Margaret hatte es ihr verboten.
Fast lautlos und mit der ihr angeborenen Eleganz lief Melinda die Treppe mit dem dicken Läufer hinunter und durch die Halle mit dem Marmorfußboden.
Als sie die Hand auf die Türklinke legte, holte sie noch einmal tief Luft. Dann wurde ihre Haltung stolz. Sie ermahnte sich, keine Angst zu zeigen.
„Sie haben nach mir geschickt, Onkel Hector?“
Ihre Stimme schien sich in dem hohen, pompös eingerichteten Raum mit den violetten Samtvorhängen und den Ledersesseln zu verlieren.
Sir Hector Stanyon stand von seinem schweren Schreibtisch aus massivem Mahagoni auf und stellte sich vor den Kamin. Er war ein untersetzter Mann von über fünfzig Jahren. Er hatte buschige Brauen. Sein Haar war an den Schläfen ergraut.
„Komm rein, Melinda, ich muß mit dir sprechen.“
Seine Stimme war so tief und laut, daß der Kristallüster an der Decke zu klirren schien.
Melinda schloß die Tür, ging über die Perserteppiche und blieb in respektvollem Abstand vor dem Onkel stehen.
„Wie alt bist du, Melinda?“ fragte Sir Hector.
„Achtzehn, Onkel Hector.“
„Und du lebst jetzt seit fast einem Jahr bei uns.“
„Ja, Onkel Hector. Dank Ihrer großen Güte.“
„Ich habe es schon so manches Mal bereut, dich aufgenommen zu haben, Melinda. Es war ein Fehler. Du bist nicht die richtige Gesellschaft für Charlotte.“
„Das zu hören bedaure ich zutiefst“, sagte Melinda, der das Herz bis zum Hals schlug. „Ich mag Charlotte sehr gern, und ich glaube, sie mag auch mich.“
„Das bildest du dir nur ein“, sagte Sir Hector streng und setzte eine vorwurfsvolle Miene auf. „Gestern hat mir Charlotte widersprochen. Das hätte sie vor einem Jahr noch nicht gewagt. Dein Einfluß ist das, Melinda. Du denkst zu selbständig und bist daher impertinent.“
„Aber ich versuche doch immer, bescheiden und zurückhaltend zu sein, Onkel Hector“, verteidigte sich Melinda.
„Ohne Erfolg“, sagte Sir Hector kalt.
„Das tut mir leid“, sagte Melinda. „Ich habe versucht, Ihren Ansprüchen und denen von Tante Margaret gerecht zu werden und mich Ihnen erkenntlich zu zeigen.“
„Das ist auch nicht mehr als recht und billig! Ist es dir denn überhaupt klar, daß dir dieser reizende Bruder von mir mit seinem zügellosen Lebenswandel keinen einzigen Penny hinterlassen hat? Absolut nichts! Mit dem Verkauf des Hauses konnten kaum die Schulden abgedeckt werden.“
„Ich weiß“, sagte Melinda und senkte den Kopf.
Wie oft hatte sie sich das schon sagen lassen müssen, und jedes Mal hatte sie sich eine arrogante Antwort verkneifen müssen. Sie wußte nur zu gut, daß sie sich für die Krümel, die von des reichen Herrn Tisch fielen, auch noch bedanken mußte.
„Aber ich gebe die Schuld nicht nur meinem Bruder“, fuhr Sir Hector fort. „Deine Mutter hat ihre Pflicht als Ehefrau versäumt und ihn nicht richtig beeinflußt. Sie ist zwar die Großenkelin eines Herzogs gewesen, aber in den Adern der Melchesters fließt böses, wildes Blut. Sie müssen gezähmt werden, Melinda, genau wie du.“
„Ja, Onkel Hector“, sagte Melinda leise.
Immer wieder das Gleiche, dachte sie traurig. Und anfangs, als sie in dieses Haus gekommen war, hatte sie sich in ihrer Naivität eingebildet, daß man sie ebenbürtig behandeln würde. Erst nach einer ganzen Reihe von Zurechtweisungen und Strafen hatte sie begriffen, wo ihr Platz war. Arme Verwandte besaßen nun einmal keine Privilegien und durften vor allem keinen Stolz zeigen. Sie mußten sich bescheiden und unterwürfig geben, sie mußten sich pausenlos entschuldigen, und falls sie eine eigene Meinung hatten, durften sie diese nicht äußern.
„Ich bitte Sie um Vergebung, Onkel Hector“, sagte sie fast automatisch. „Sie waren immer sehr gütig zu mir.“
„Ich habe dir etwas mitzuteilen“, sagte Sir Hector. „Ich möchte dich darauf hinweisen, daß du mehr Glück als Verstand hast.“
„Vielen Dank, Onkel Hector“, sagte Melinda. „Ich bin Ihnen sehr dankbar.“
„Du weißt ja noch nicht einmal wofür“, sagte Sir Hector. „Ich habe dir etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Etwas, was dich zweifellos sehr erstaunen wird und für jemand in deiner Position ein Geschenk des Himmels ist.“ Er schaltete eine Kunstpause ein. „Man hat um deine Hand angehalten“, sagte er schließlich.
„Um meine Hand?“ Melinda traute ihren Ohren nicht.
„Siehst du, damit hast du nicht gerechnet“, sagte Sir Hector selbstzufrieden. „Ich allerdings auch nicht, wenn ich ehrlich bin.“
Melinda war völlig verwirrt. Sie hatte in den letzten Wochen doch niemand kennengelernt; und als sie noch von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet sein mußte, hatte sie das Haus auf Anweisung der Tante nicht verlassen dürfen. Der einzige Mann, mit dem Melinda kurz gesprochen hatte, war Captain Parry gewesen, als Charlotte ihn der Kusine vorgestellt hatte. Melinda betete zu Gott, daß nicht ausgerechnet er es war, der ein Auge auf sie geworfen hatte.
„Ich sehe, du bist beschämt“, sagte Sir Hector. „Das gehört sich auch so. Heutzutage soll es ja Mädchen geben, die eigenwillig handeln und das Einverständnis der Eltern gar nicht erst abwarten. So etwas würde ich nie tolerieren!“
„Nein, natürlich nicht, Onkel Hector“, sagte Melinda schnell. „Ich habe keine Ahnung, von wem Sie sprechen.“
„Dann kann ich nur noch einmal betonen, daß du von einem Glück reden kannst, das du gar nicht verdient hast. Aber jetzt will ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Der Gentleman, der dir die große Ehre angedeihen läßt, dich um deine Hand zu bitten, ist Colonel Randolph Gillingham.“
Melinda stieß einen kleinen Schrei aus.
„Großer Gott, nein!“ rief sie. „Nein! Diesen Mann kann ich nicht heiraten!“
„Wie bitte?“ fragte Sir Hector entsetzt. „Wie darf ich das verstehen?“
„Er - er ist doch so - alt“, stammelte Melinda.
„So, alt ist er“, sagte Sir Hector mit eisiger Stimme. „Vielleicht interessiert es dich, daß Colonel Gillingham und ich gleich alt sind, und ich halte mich nicht für alt.“
„Nein, natürlich nicht. So habe ich es nicht gemeint. Nur für mich ist Colonel Gillingham zu alt. Sie sind ja schließlich auch mein Onkel.“
„Eben noch habe ich es gesagt, Melinda, du mußt gezähmt werden. Du brauchst eine harte Hand. Einen Mann, zu dem du aufschauen kannst, der dir Disziplin und Anstand beibringt.“
„Aber - aber ich will ihn nicht heiraten“, rief Melinda. „Allein die Idee ist mir schon zuwider.“
„Allein die Idee ist dir schon zuwider?“ wiederholte Sir Hector und seine Stimme war voll Spott. „Wer bist du eigentlich, daß du es dir erlaubst, so anmaßend zu sein? Colonel Gillingham ist ein sehr wohlhabender Mann. Mir persönlich ist es unbegreiflich, daß er dich zur Frau haben will, aber er hat mir versichert, daß du ihm bereits sehr viel bedeutest. Auf Knien solltest du deinem Schöpfer danken, Melinda, daß ein so nobler und respektierter Mann den Wunsch hegt, die Verantwortung für eine so oberflächliche Person wie dich zu übernehmen.“
„Das ist sehr freundlich von ihm“, sagte Melinda, „aber ich kann ihn trotzdem nicht heiraten. Bitte, Onkel Hector, richten Sie ihm aus, daß ich sehr dankbar und geschmeichelt bin, daß ich mir der Ehre wohl bewußt bin, seinen Antrag aber ablehnen muß.“
„Du glaubst doch nicht im Ernst, daß ich ihm das ausrichte!“ schrie Sir Hector.
Diesmal ließ sich Melinda nicht einschüchtern.
„Ich bedaure es, Onkel Hector“, sagte sie, „aber meine Antwort lautet so, und ich werde mich zu nichts überreden lassen. Papa hat mehrmals betont, daß er mich nie zwingen würde, einen Mann zu heiraten, den ich nicht liebe.“
„Lieben!“ Sir Hector stieß ein häßliches Lachen aus. „Dein Vater muß nicht bei Verstand gewesen sein. Wie kann man ein Mädchen darin unterstützen, daß es alle Konventionen umstößt und die väterliche Autorität mißachtet? In meinem Haus wird immer noch das getan, was ich befehle. Ein anständiges Mädchen heiratet den Mann, den seine Eltern ausgesucht haben, und da ich die Verantwortung für dich übernommen habe, tust du, was ich sage, verstanden? Du heiratest Colonel Gillingham, und kein weiteres Wort wird darüber verloren.“
„Ich kann ihn nicht heiraten, Onkel Hector. Ich mag ihn nicht. Er ekelt mich an - und ich habe Angst vor ihm.“
„Du impertinente Gans!“ schrie Sir Hector. „Wie kannst du es wagen, so von einem meiner besten Freunde zu sprechen? Keinen Penny besitzt du und erlaubst dir, den wohlhabendsten Mann in der ganzen Grafschaft abzulehnen. Du wirst den Antrag des Colonel annehmen, und deine Tante wird in ihrer unendlichen Güte einen Empfang hier in diesem Haus für dich geben. Und jetzt geh auf dein Zimmer. Die Angelegenheit ist entschieden.“
Melinda war weiß wie die Wand, aber ihre Stimme blieb fest.
„Es tut mir leid, Ihnen Ärger bereiten zu müssen, Onkel Hector“, sagte sie, „aber wenn Sie Colonel Gillingham in dem Glauben lassen, daß ich bereit bin, seine Frau zu werden, bringen Sie sich damit in eine peinliche Lage. Ich werde ihn nicht heiraten, und wenn Sie mich zwingen wollen, weigere ich mich vor dem Altar.“
„Weigern willst du dich?“ bellte Sir Hector. „Du lehnst einen Antrag ab, nach dem sich jedes anständige Mädchen alle zehn Finger abschlecken würde? Du wirst mir gehorchen. Glaubst du vielleicht, ich will vor einem meiner besten Freunde wie ein Idiot dastehen? Dazu kommt, daß die Heiratsanzeige bereits übermorgen in der ,Gazette* und der ,Morning Post’ erscheint.“
„Meinetwegen kann sie vom Stadtschreier ausgerufen werden“, sagte Melinda trotzig. „Ich werde Colonel Gillingham nicht heiraten. Ich hasse ihn. Sie können tun, was Sie wollen, ich heirate ihn nicht.“
„Das werden wir noch sehen“, sagte Sir Hector drohend.
Er hatte sich mittlerweile in einen seiner Wutanfälle hineingesteigert, die alle Dienstboten und sogar Lady Margaret fürchteten. Sein Gesicht war krebsrot, die buschigen Augenbrauen stießen fast zusammen, sein Mund war bösartig verzerrt.
„Du wirst mir gehorchen!“ schrie er. „Mir widerspricht niemand, am allerwenigsten du, ein mittelloses, undankbares Ding, das ich in mein Haus aufgenommen habe. Du heiratest ihn!“
„Ich heirate ihn nicht. Ich heirate keinen Mann, den ich nicht liebe!“ Auch Melinda hatte jetzt die Stimme erhoben.
Und damit verlor Sir Hector jegliche Selbstbeherrschung. Er riß die Reitpeitsche von seinem Schreibtisch und zog sie Melinda mit solcher Kraft über die Schulter, daß das junge Mädchen fast zusammenbrach.
„Ich heirate ihn nicht!“ schrie Melinda und verbarg das Gesicht in der Beuge des rechten Armes.
Halb wahnsinnig vor Wut packte Sir Hector das arme Mädchen am anderen Arm, warf es auf das Sofa und schlug auf es ein. Wieder und wieder sauste die Peitsche auf seinen Rücken herunter.
„Nein, nein, nein!“ wimmerte Melinda, obwohl sie halb ohnmächtig war vor Schmerzen.
„Du heiratest ihn, und wenn ich dich umbringe!“ drohte Sir Hector.
Die Peitsche zerschnitt die Luft, bis er schließlich merkte, daß Melinda nichts mehr sagte und sich auch nicht mehr regte. Sie lag quer über dem Sofa, die Haare wirr, eine Hand schlaff und wie leblos. Eine Sekunde lang hatte Sir Hector Angst, dann warf er die Peitsche in eine Ecke.
„Steh auf!“ herrschte er Melinda an. „Du hast es herausgefordert und nicht anders verdient.“
Melinda rührte sich nicht. Sir Hector beugte sich über sie, hob sie hoch und legte sie auf den Rücken. Sie war erstaunlich leicht. Ihr Kopf rollte zur Seite, sie hatte die Augen geschlossen.
„Melinda!“ rief Sir Hector. „Melinda! Dieses störrische Etwas. Sie muß gehorchen lernen. Aber Randolph wird ihr schon den Willen brechen, und ich wünsche ihm viel Vergnügen dabei.“
Er ging zu dem Butler’s Tray mit den vielen Flaschen, das in einer Ecke der Bibliothek stand. Aus einer Kristallkaraffe goß er Wasser in ein Glas, ging damit zum Sofa und schüttete es Melinda ins Gesicht.
Nach einem Moment öffnete Melinda langsam die Augen. Falls Sir Hector erleichtert war, sah man es ihm zumindest nicht an.
„Steh auf!“ sagte er streng. „Geh auf dein Zimmer und wage dich nicht heraus. Du bekommst vorerst nichts zu essen. Ich werde dich irgendwann holen lassen, und wenn du dich dann nicht einverstanden erklärst, Colonel Gillingham zu heiraten, bekommst du noch einmal die Peitsche zu spüren und noch einmal und noch einmal. Ungehorsam, das gibt es nicht in meinem Haus, hörst du? Los, ab in dein Zimmer. Und versuche nicht, dich bei deiner Tante auszujammern. Von ihr kannst du kein Mitleid erwarten.“
Wie ein Mann, der überzeugt davon war, sich einen Drink verdient zu haben, goß er sich einen Cognac ein und schlürfte ihn genüßlich.
Melinda rappelte sich auf. Sie schleppte sich von Möbelstück zu Möbelstück, bis sie endlich an der Tür war. Wie eine Schlafwandlerin ging sie durch die Halle. Es war, als ob es keinen Willen mehr gäbe, der sie leitete, sondern nur noch den Instinkt.
In ihrem freudlosen, kargen Schlafzimmer, das gegenüber dem Studierzimmer lag, schloß sie die Tür hinter sich, schaffte es gerade noch, den Schlüssel umzudrehen und brach auf dem Boden zusammen.
Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie so dagelegen war. Sie wußte nur noch, daß sie selbst in ihrer Besinnungslosigkeit unter der Erniedrigung gelitten hatte. Die Schmerzen waren weit weniger schlimm.
Es war dunkel und bitter kalt. Melinda stand auf und taumelte zu ihrem Bett. In dem Moment klopfte es.
„Wer ist da?“ fragte Melinda, zitternd vor Angst.
„Ich bin’s Miss“, rief das junge Zimmermädchen, das jeden Abend Melindas Bett zurückschlug.
„Ist schon gut, Lucy“, rief Melinda zurück. „Ich mache es selber, vielen Dank.“
„Dann gute Nacht, Miss.“
Lucys Schritte entfernten sich, und jetzt war Melinda endlich in der Lage, die Kerzen anzuzünden. Sie betrachtete sich im Spiegel und hatte das Gefühl, als starre sie ein fremdes Gesicht an.
Es war ein blasses, verhärmtes Gesicht mit Augen voller Schmerz und Dunkelheit. Die Haare waren verwirrt. Melinda drehte sich um und sah jetzt auch die dunklen, feuchten Flecken auf dem Rücken ihres Baumwollkleides.
Langsam zog sie sich aus. Jede Bewegung war eine Qual. Sie schlüpfte in ihren alten Morgenrock aus Flanell, setzte sich an den Toilettentisch und starrte mit leeren Augen vor sich hin. Sie war nicht bei Besinnung gewesen, hatte aber trotzdem die Worte des Onkels gehört.
„ ... bekommst du noch einmal die Peitsche zu spüren und noch einmal und noch einmal.“
Wie oft schon war Sir Hector drauf und dran gewesen, sie zu schlagen, wie er seine Hunde und seine Pferde schlug. Und - so hatte man es sich zugeflüstert - wie er seinen Stallburschen geschlagen hatte, dessen Eltern ihm mit einer Anzeige gedroht hatten.
Er war ein grausamer, unbeherrschter Mann. Was ihn jedoch besonders in Rage gebracht hatte, war die Tatsache, daß durch ihre Weigerung Colonel Gillingham denken würde, daß er, Sir Hector, nicht Herr in seinem Haus war. Er war ein Despot und verlangte absoluten Gehorsam.
„Und ich heirate ihn trotzdem nicht“, flüsterte Melinda vor sich hin.
Die Tränen liefen ihr über die blassen Wangen, und sie zitterte am ganzen Körper.
„Oh Papa! Mama! Wie habt ihr das geschehen lassen können?“ schluchzte sie. „Wir waren doch so glücklich zusammen. Warum habt ihr mich verlassen? Papa, Mama, wo seid ihr? Kommt doch bitte wieder zurück!“
Als ob ihr die Eltern geantwortet hätten, wußte Melinda plötzlich, was sie tun mußte. Wie Schuppen fiel es ihr von den Augen. Nicht eine Sekunde lang stellte sie sich die Frage nach Recht oder Unrecht. Im Grunde hätte sie es schon längst tun und nicht erst warten sollen, bis sie dazu gezwungen war.
Sie wischte sich die Tränen ab, stand auf, holte die kleine Reisetasche aus dem Schrank und fing an, zu packen. Sie wollte nur das Nötigste mitnehmen. Sie wußte, daß sie nicht kräftig genug war, viel mit sich herumzuschleppen.
Sie zog sich schließlich an. Frische Unterwäsche, frische Unterröcke und ihr Sonntagskleid aus lavendelfarbenem Tuch mit weißem Kragen und weißen Manschetten. Sie besaß ein dazu passendes, einfaches Häubchen. Lady Margaret hatte es nicht gestattet, daß sie etwas trug, was auch nur etwas ausgeschmückt und verziert war. Den schon etwas abgetragenen Wollschal ihrer Mutter legte sie neben die Tasche. Sie wollte ihn im letzten Moment umschlingen.
Sie mußte länger am Toilettentisch gesessen sein, als ihr bewußt gewesen war, denn die Standuhr in der Halle schlug zweimal. Melinda klappte ihre Handtasche auf. Nur ein paar Shilling besaß sie. Es waren die jämmerlichen Ersparnisse, die sie von dem mageren Taschengeld übrigbehalten hatte, das ihr Sir Hector für die Kollekte in der Kirche und sonstige Ausgaben genehmigt hatte.
Sie entnahm der Schublade des Toilettentisches ein kleines lilafarbenes Samtschächtelchen und klappte es auf. Es enthielt die zierliche Brillantnadel, die sie als Einziges hatte behalten dürfen, als das Haus und die persönlichen Dinge ihrer Eltern unter den Hammer des Versteigerers gekommen waren.
Sie hatte die Nadel auch nur deshalb behalten dürfen, weil sie ihr bereits gehörte. Sie hatte sie zum Andenken an ihre Großmutter nach deren Tod bekommen. Es war ein bescheidenes Schmuckstück, aber die Steine waren so geschliffen, daß sie glitzerten und funkelten, und Melinda wußte, daß die Nadel einen gewissen Wert hatte.
Mit dem Etui in der Hand schlich sie sich aus dem Zimmer und über den Gang. Im Haus war alles still. Bloß das Ticken der Standuhr war zu hören.
Vorsichtig öffnete Melinda die Tür zum Boudoir ihrer Tante. Drinnen war alles dunkel, aber das junge Mädchen kannte seinen Weg. Wie ein Geist huschte Melinda über die dicken Teppiche und schob den Vorhang ein wenig zur Seite, um das Mondlicht hereinzulassen. Melinda klappte den Sekretär auf. Sie wußte nur zu gut, wo das Haushaltsgeld aufbewahrt wurde, denn Woche für Woche hatte sie Lady Margaret bei der Abrechnung helfen müssen.
Melinda fand ganze zehn Goldmünzen. Sie nahm sie und legte dafür die Brillantnadel ihrer Großmutter in den Sekretär. Daß ihr Onkel sie eine Diebin schimpfen würde, war ihr klar, aber sie war überzeugt davon, daß die Nadel mehr Geld einbrachte als zehn Goldmünzen - falls Lady Margaret sie verkaufte.
Melinda schlich in ihr Zimmer zurück. Ihr Rücken schmerzte, aber sie durfte jetzt nicht daran denken. Wenn sie fliehen wollte, dann mußte es gleich geschehen.
Sie steckte das Geld in ihre Tasche, sah sich noch einmal in dem Zimmer um und blies die Kerzen aus.
„Papa, Mama“, flüsterte sie in die Dunkelheit hinein. „Helft mir. Ich habe Angst, fortzugehen, aber noch viel mehr Angst hätte ich, wenn ich bleiben würde. Helft mir. Es ist mein einziger Ausweg.“
Und dann ging Melinda ganz ruhig über die Dienstbotentreppe hinunter und verließ durch den rückwärtigen Ausgang das Haus.