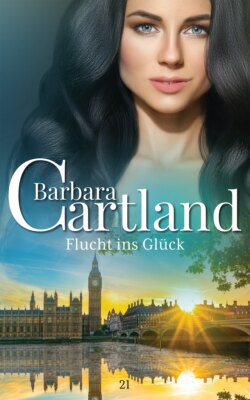Читать книгу Flucht ins Glück - Barbara Cartland - Страница 3
2
ОглавлениеVom blassen, milchigen Schein des Mondes begleitet, huschte Melinda über die Wageneinfahrt zu dem schmiedeeisernen Tor. Es war geschlossen, aber der kleine Durchgang daneben war zum Glück nicht verschlossen. Auf Zehenspitzen ging Melinda durch. Das Häuschen des Torwächters war unmittelbar daneben, aber er hörte nichts.
Mit schnellen, entschlossenen Schritten machte sich Melinda auf den Weg. Die Landstraße war staubig und kurvenreich. Schon bald gelang es Melinda nicht mehr, die Schmerzen zu ignorieren. Die Reisetasche, in die sie wirklich nur das Allernötigste gepackt hatte, schien schwerer und schwerer zu werden.
Ihr Schritt wurde langsamer, und bald sagte ihr ein schwaches Glühen am Horizont, daß der Tag anbrach. Voll Angst mußte Melinda feststellen, daß das Haus ihres Onkels noch nicht sehr weit hinter ihr lag. Wenn jemand bemerkte, daß sie nicht in ihrem Zimmer war, würde man sie im Handumdrehen wieder eingefangen haben.
Sie wußte nur zu gut, was passieren würde, wenn man sie zurückbrachte. Sir Hector würde sie auspeitschen und zur Heirat zwingen. Allein bei dem Gedanken, die Frau des ihr so verhaßten Colonel Gillingham werden zu müssen, lief ein Schaudern über ihren ganzen Körper.
Melinda hastete weiter. Die dünnen gelben Finger der Morgensonne wischten die letzten Spuren der Nacht weg. Keine Menschenseele auf der Landstraße. Bald mußten in der Ferne die ersten Häuser des kleinen Dorfes auftauchen, in dem sie ein Gefährt zu finden hoffte, das sie nach Leminster bringen würde.
Leminster war fünf Meilen entfernt und von dort aus konnte sie den Zug nehmen und nach London fahren. Ihr Plan stand fest. Es gingen auch Postkutschen nach London, aber sie waren langsamer und von einem Reiter leicht einzuholen.
Melinda war überzeugt davon, daß ihr Onkel annehmen würde, daß sie es nicht wagte, den Zug zu nehmen. Er war nämlich gegen alles, was modern war. Er vertrat die bornierte Meinung, daß ein Gentleman mit seiner Familie in eigener Kutsche zu reisen habe, mit eigenem Kutscher natürlich.
Als in Leminster jedoch der Bahnhof eingeweiht worden war, hatte ihn die Neugierde doch hingetrieben, und er hatte als Lord Lieutenant der Grafschaft eine Rede gehalten. Nachdem Lady Margaret mehrmals betont hatte, daß es eine große Ausnahme sei, war Melinda mitgenommen worden.
Sie und Charlotte hatten die Wagen mit den weichen Sitzen und den Glasfenstern bestaunt, sich aber auch die offenen mit den Holzbänken angesehen, in denen die armen Leute reisten.
Melindas Problem war es vorerst, wie sie überhaupt nach Leminster kommen würde. Sie bedauerte es fast, nicht doch auf Flash geflohen zu sein. Aber sie hatte gewußt, daß die Stallburschen es ihrem Onkel sagen würden, wenn sie nach ein paar Stunden nicht zurück war. Außerdem hätten sie es merkwürdig gefunden, wenn Melinda allein losgeritten wäre, denn Sir Hector bestand darauf, daß die Mädchen immer von einem Stallburschen begleitet wurden.
Inzwischen hatte Melinda Angst, daß sie es nicht einmal bis zu dem kleinen Dorf schaffen würde. Sie war so schwach, daß sie sich einen Moment auf einen Meilenstein setzen und ausruhen mußte. Ihre Schuhe und ihr Rocksaum waren bereits voll Staub. Wie würde sie erst aussehen, wenn sie endlich in London ankam?
Sie wischte sich gerade die Stirn mit dem weißen Spitzentaschentuch ab, in das sie ihre Initialen gestickt hatte, als sie das Schlagen von Pferdehufen hörte. Sie erschrak schier zu Tode. Kurz darauf jedoch sah sie den Leiterwagen näher kommen und wußte, daß sie keine Angst zu haben brauchte. Auf dem Wagen saß der Farmer Jenkins, einer der vielen Pächter ihres Onkels. Sie kannte den jungen Mann mit den feuerroten Haaren von ihren Ausritten.
Melinda hob den Arm hoch, und der Farmer brachte den schweren Ackergaul neben ihr zum Stehen.
„Guten Morgen, Miss Melinda“, sagte er freundlich. „Sie sind aber schon früh unterwegs.“
„Guten Morgen, Jim“, sagte Melinda. „Wohin des Wegs?“
„Es ist Dienstag, Miss, da fahre ich immer auf den Markt nach Leminster.“
Melinda seufzte erleichtert auf.
„Können Sie mich bitte mitnehmen?“
„Jederzeit gern“, sagte Jim Jenkins. „Aber als Lady können Sie doch nicht auf einen Leiterwagen steigen.“
Melinda lächelte.
„Und ob ich das kann“, sagte sie, gab Jenkins die Reisetasche, kletterte auf den Wagen und setzte sich neben ihn.
„Vielen Dank, Jim“, sagte sie so herzlich, daß der Farmer sie erstaunt ansah.
„Es geht mich zwar nichts an, Miss“, sagte er, „aber was denkt denn Sir Hector, wenn er das erfährt?“
„Ich hoffe, daß er es nie erfahren wird, Jim“, sagte Melinda. „Oh, Jim, ich kann es Ihnen nicht erklären, aber lassen Sie uns so schnell wie möglich nach Leminster fahren. Ich hätte nie gedacht, daß jemand schon so früh unterwegs ist.“
„Ich muß dort sein, wenn der Markt beginnt“, sagte Jim Jenkins. „Dann bekommt man die besten Preise.“
Melinda sah sich um. Auf dem Leiterwagen standen Holzkäfige mit Hühnern, Körbe voll Eier und große Klumpen Butter, die in feuchte Leinentücher gewickelt waren.
„Wie viel Uhr ist es denn?“ fragte Melinda. „Meinen Sie, daß in Oakle schon viele Leute auf sind?“
„Kaum“, sagte Jim Jenkins. „Das sind doch alles Faulenzer, die von Oakle.“
„Ich möchte nicht gesehen werden, Jim“, sagte Melinda. „Und ich möchte auch nicht, daß Sie meinetwegen Ärger bekommen.“
„Heißt das, daß Sir Hector nichts von Ihrem Ausflug nach Leminster weiß?“
Melinda zögerte einen Moment, dann sagte sie dem Farmer aber doch die Wahrheit.
„Nein, Jim“, antwortete sie. „Er weiß nichts davon.“
„Glauben Sie nicht, daß er wütend wird, wenn er es herauskriegt?“
„Doch“, sagte Melinda. „Aber ich möchte wenigstens vermeiden, daß Sie hineingezogen werden.“
„Von mir erfährt er nichts“, sagte Jim Jenkins. „Und wenn Sie mich fragen, Miss, dann gibt es in der ganzen Gegend niemand, der Sir Hector etwas erzählt, was ihn in Wut bringt.“
„Das glaube ich gern“, sagte Melinda. „Trotzdem ist es besser, wenn ich gar nicht erst gesehen werde.“
Als sie durch Oakle fuhren, hielt Melinda den Kopf gesenkt. Die paar Häuser lagen schnell hinter ihnen, und Melinda atmete erleichtert auf.
„Hab ich’s nicht gesagt?“ Jim Jenkins lachte. „Faulenzer sind das in Oakle.“
Es war noch nicht einmal fünf, als sie in Leminster ankamen. Jim Jenkins wollte Melinda am Bahnhof absetzen, aber sie lehnte dankend ab, denn der Bahnhof war ein ganzes Stück vom Markt entfernt, und Melinda fand außerdem, daß es wahrscheinlich weniger auffallen würde, wenn sie zu Fuß hinging.
„Vielen Dank, Jim“, sagte sie und reichte ihm die Hand. „Sie haben mir sehr geholfen. Ich hoffe nur, daß Sie nicht in Schwierigkeiten kommen.“
„Ach wo“, sagte Jim Jenkins. „Viel Glück.“
Er schüttelte ihr die Hand.
Als Melinda von ihm wegging, hatte sie das Gefühl, ihren letzten Freund zurückzulassen. Diese Farmer waren brave, zurückhaltende Menschen. Nicht eine Frage hatte er ihr gestellt, sondern die Situation einfach als gegeben hingenommen. Sie hatten wenig zusammen gesprochen, und so hatte Melinda Zeit gehabt, sich für das zu rüsten, was vor ihr lag.
Sie kam am Bahnhof an und erfuhr, daß der Nachtexpreß aus dem Norden um sechs Uhr in Leminster hielt. Sie ging zum Schalter und erkundigte sich nach dem Fahrpreis bis London. Der Unterschied zwischen der Ersten und der Zweiten Klasse war horrend. Sie zögerte kurz, überlegte sich aber dann, daß sie am falschen Platz sparte, wenn sie in einem der offenen Wagen fuhr. Sie besaß an Kleidung nur das, was sie auf dem Leib trug und konnte in London nicht wie eine Landstreicherin ankommen. Wenn sie Arbeit finden wollte, mußte sie sauber und gepflegt aussehen. Schweren Herzens gab sie daher vier von ihren Goldmünzen aus und bekam nur ein paar Shilling zurück.
Da sie noch fast eine Stunde Zeit hatte, ging sie zur Damentoilette und erfrischte sich erst einmal. Anschließend ging sie zu dem Bäckerladen, der ihr auf dem Weg aufgefallen war, und kaufte sich zwei frische Brötchen, die mit Zucker bestreut waren. Einen Penny pro Stück mußte sie zahlen. Melinda setzte sich damit in den Wartesaal und aß sie mit großem Appetit.
Und dann kam die Nervosität. Melinda hatte Angst, daß der Zug Verspätung haben könnte, daß jemand sie erkennen und von der Reise abhalten würde, daß man schlecht von ihr denken würde, weil sie allein war und sich das nicht gehörte für ein junges Mädchen aus gutem Haus.
Jedesmal, wenn die Tür aufschwang, sah Melinda erschreckt hoch, aber nichts passierte. Und als dann endlich der Zug langsam einfuhr, war plötzlich der ganze Bahnsteig voll von Menschen, die aus dem Boden gewachsen zu sein schienen. Kofferträger, Reisende, Bahnangestellte, Männer, Frauen und Kinder; es wimmelte von Menschen.
Als der Zug endlich zum Stehen kam, erfaßte alle eine fast hysterische Hast. Alles schrie durcheinander und rannte hin und her. Melinda wurde geschubst und gestoßen und schließlich half ihr jemand beim Einsteigen. Weitere fünf Reisende kletterten in das Abteil, und die Tür wurde zugeschlagen.
Melinda saß am Fenster. Ihr gegenüber hatte ein Herr Platz genommen, der in ein Cape aus dickem Tuch gewickelt war. Trotz des sommerlichen Wetters schien er Angst zu haben, erfrieren zu müssen. Seine Frau hatte einen Schleier stramm über das Gesicht gebunden und war ebenfalls in ein Cape gehüllt, das mit Ripsbändern eingefaßt war. Die anderen drei Reisenden waren Männer. Melinda hielt sie für Geschäftsleute, obwohl sie noch nie mit Menschen zusammengekommen war, die sich ihren Lebensunterhalt durch das Handeln von Waren verdienten. Als die Männer dann über Abschlüsse und Kunden sprachen, wußte Melinda, daß sie sich nicht getäuscht hatte. Einer sagte sogar Geschäften müßten die Augen aus dem Kopf springen, wenn sie die Qualität sehen würden.
Als ein schriller Pfiff ertönte und der Zug sich langsam in Bewegung setzte, hielt Melinda die Luft an. Sie hatte es geschafft. Sie war ihrem grausamen Onkel entkommen. Der Zug, der schneller war als Sir Hectors Pferde, brachte sie nach London. Sie war gerettet und konnte Colonel Gillingham vergessen.
Vor Erleichterung hätte sie fast geweint, aber tapfer schluckte sie die Tränen hinunter. Sie war zu stolz, sich vor anderen Gefühle anmerken zu lassen. Es war ein seltsames Gefühl. Der Waggon schwankte hin und her, die Räder ratterten auf den Eisenschienen, Qualm zog am Fenster vorbei. All das war neu für Melinda und so ungewöhnlich, wie wahrscheinlich ihr Leben von jetzt an sein würde.
Melinda schloß die Augen und versuchte, sich auf das zu konzentrieren, was sie tun mußte, wenn sie in London ankam. Gegen ein Uhr mußte der Zug dort eintreffen. Damit hatte sie den ganzen Nachmittag Zeit, sich eine manierliche Unterkunft zu suchen und sich zur Agentur von Mrs. Brewer durchzufragen.
Melinda hätte den Namen nicht gekannt, hätte sie nicht für ihre Tante mehrere Briefe an die Dame geschrieben, die Stellen vermittelte. Lady Margaret hatte eine neue Haushälterin gesucht und sich deshalb an die Agentur gewandt. An die Adresse konnte Melinda sich unglücklicherweise nicht erinnern. Aber sie würde sie schon in Erfahrung bringen. Daß sie keine Zeugnisse vorzuweisen hatte, war unangenehm, aber Melinda war auch diesbezüglich zuversichtlich. Sie nahm sich vor, einfach zu sagen, daß sie Lady Stanyons Nichte war, und sie konnte nur hoffen, daß Mrs. Brewer nicht an ihre Tante schrieb.
Langsam begriff Melinda, daß sich mehr Schwierigkeiten ergaben, als sie anfangs gedacht hatte. Sie war einfach blind weggelaufen, hatte aber nicht in Erwägung gezogen, daß sie vielleicht gezwungen war, zurückzukehren, falls sie keine Arbeit fand.
Ich muß es schaffen, für meinen Lebensunterhalt selbst aufzukommen, sagte sie sich immer wieder. Und ich muß von vornherein damit rechnen, daß meine Lage nicht einfach sein wird.
Melinda bedauerte es inzwischen, nicht doch Zweiter Klasse gelöst zu haben. Die sechs Goldmünzen, die ihr noch geblieben waren, kamen ihr zwar wie ein Vermögen vor, denn sie hatte seit dem Tod ihrer Eltern immer nur ein paar Shilling in der Tasche gehabt, aber trotzdem wußte sie, daß sie nicht lange von dem Geld leben konnte.
Und vor Taschendieben muß ich mich hüten, dachte sie.
Wie in Wellen schlug immer wieder die Angst über ihr zusammen. Und jedes Mal versuchte sie sich einzureden, daß sie schon durchkommen und daß Gott sie beschützen würde. Sie versuchte zu beten und döste darüber ein. Als sie die Augen wieder öffnete, hatten ihre Mitreisenden den Proviant ausgepackt.
Der Herr in dem Cape und seine Frau hatten einen ganzen Korb voll Essen mitgebracht. Die Geschäftsleute packten Berge von belegten Broten aus. Melinda war hungrig und ärgerte sich, daß sie beim Bäcker nicht noch ein paar von den gezuckerten Brötchen gekauft hatte.
Der Mann ihr gegenüber nagte an einem Hühnerbein. Danach aßen er und seine Frau frische Erdbeeren, die sie mit Zucker bestreuten. Sie hatten eigens ein silbernes Gefäß dafür mitgebracht. Melinda sah ihnen fast gierig zu. Ihr Rücken schmerzte. Sie zwang sich, aus dem Fenster zu blicken, denn sie wollte den Leuten beim Essen nicht auch noch zusehen.
„Ich habe eigentlich keinen Hunger“, sagte die Frau, die den Schleier einfach hochgeschoben hatte, um den Mund frei zu bekommen. „Der Wagen schwankt so, daß mir fast schlecht ist.“
„Willst du vielleicht einen Schluck Cognac?“ fragte ihr Mann.
„Um Gottes willen!“ Die Frau tat so, als sei ihr Gift angeboten worden. „Aber eventuell ein Glas Champagner.“
„Aber gern, mein Herz.“
Der Mann holte eine halbe Flasche Champagner aus dem Korb, den er neben Melinda auf den Boden gestellt hatte. Melinda roch das Brathuhn und die Erdbeeren und bekam noch mehr Hunger.
Der Mann goß den Champagner ein.
„Wir haben noch so viel übrig“, flüsterte er seiner Frau zu, aber Melinda verstand jedes Wort. „Sollen wir der kleinen Lady nicht etwas anbieten?“
„Du wirst dich hüten!“ herrschte ihn die Frau an. „Ein Mädchen, das allein reist, ist keine Lady. Du sprichst nicht ein Wort mit ihr, hörst du?“
Melinda schloß die Augen. So würde es ihr in Zukunft noch oft ergehen. Eine Frau ohne Begleitung war verdächtig und mußte gemieden oder zumindest ignoriert werden. Sie war froh, als der Korb endlich wieder unter der Bank verstaut wurde.
„In einer Stunde sind wir da“, sagte irgendwann einer der Geschäftsleute.
Dann kaufe ich mir als Erstes etwas zu essen, dachte Melinda.
Kurz darauf fuhr der Zug plötzlich immer langsamer. Melinda sah aus dem Fenster. Schließlich stand der Zug.
„Warum halten wir denn hier?“ fragte einer der Männer.
Ein anderer zog das Fenster herunter und steckte den Kopf hinaus.
„Ich sehe nichts“, sagte er. „Hallo, Schaffner! Was ist denn da los?“
„Ich weiß es auch nicht, Sir“, sagte der Mann, der offensichtlich ausgestiegen war. „Ich nehme an, daß die Schienen blockiert sind.“
Die Schienen waren tatsächlich blockiert, und es dauerte fünf Stunden, bis der Zug endlich weiterfahren konnte. Die Reisenden stiegen aus, gingen nach vorn und sahen zu, wie der riesige Haufen aus Sand und Steinen abgetragen wurde.
Melinda war wie die anderen aus dem Wagen geklettert, hatte sich die Beine vertreten und sich schließlich ins Gras gesetzt. Sie war immer hungriger geworden und hatte sich schließlich an den Schaffner gewandt.
„Meinen Sie nicht, ich könnte irgendwo etwas zu essen kaufen“, sagte sie. „Ich habe den Zug noch in letzter Minute erwischt und hatte keine Zeit mehr, mir etwas zu besorgen.“
„Das ist natürlich schlecht“, sagte der Schaffner, „denn mit so einem Zwischenfall muß man immer rechnen.“
„Das ist mir auch klargeworden“, sagte Melinda und lächelte. „Aber jetzt ist daran auch nichts mehr zu ändern, und ich habe einen rasenden Hunger.“
Der Schaffner nickte.
„Ich schaue mal, was sich machen läßt“, sagte er. „Ich habe selber eine Tochter. Sie ist ungefähr so alt wie Sie, Miss.“
Er verschwand in einem Waggon und kam kurz darauf mit einem großen Stück hausgemachter Wurst und einem mit Käse belegten Brot zurück.
„Eine Bauersfrau hat mir das gegeben“, sagte er. „Sie sollen es sich schmecken lassen, Miss.“
„Wie freundlich von der Frau“, sagte Melinda. „Meinen Sie, ich soll ihr Geld dafür geben?“
„Damit würden Sie die Frau beleidigen, Miss. Sie hat Ihnen das Brot und die Wurst gern gegeben.“
„Dann sagen Sie ihr bitte meinen innigsten Dank.“
Es hatte Melinda selten so geschmeckt in ihrem Leben. Wie verschieden doch die Menschen sind, dachte sie.
Der Zug fuhr schließlich weiter, und als er langsam in die Euston-Station rollte, dämmerte es bereits.
„Gott sei Dank sind wir endlich da“, stöhnte die Dame mit dem Schleier. „So eine unangenehme Reise! Das nächste Mal nehmen wir die Kutsche, das schwöre ich dir.“
„Ich wußte, daß es dir keinen Spaß macht, mein Herz“, sagte ihr Mann. „Zugfahren ist nun einmal nichts für Damen.“
„Weiß Gott nicht“, sagte seine Frau. „Laß den Korb ruhig stehen. Der Gepäckträger soll ihn holen.“
Die Menschenmenge auf dem Bahnhof war beeindruckend, und jetzt bekam es Melinda erst richtig mit der Angst zu tun. Zu dieser späten Stunde das Büro von Mrs. Brewer noch suchen zu wollen, war zwecklos.
Sie überlegte, ob sie das Ehepaar nach einer gebührlichen Unterkunft fragen sollte und hatte gerade ihren ganzen Mut zusammengenommen, als einer der Geschäftsleute die Tür öffnete und ausstieg.
„Bitte“, sagte Melinda mit zitternder Stimme, „könnten Sie mir vielleicht sagen ...“
„Nein!“ fiel ihr die Dame mit dem Schleier ins Wort und bedachte sie mit einem giftigen Blick. „Wir können Ihnen nichts sagen.“
Damit stieg sie, von ihrem Mann gefolgt, aus. Melinda stand völlig verwirrt auf dem Bahnsteig. Das Geschrei der Menschen war ohrenbetäubend.
„Träger? Träger? Träger, Miss?“
„Nein, nein danke“, sagte Melinda und ließ sich von den Menschen zum Ausgang treiben. Sie gab ihre Fahrkarte ab und blieb nach ein paar Schritten stehen. Die Reisenden eilten zu den Pferdedroschken. Jeder schien sein festes Ziel zu haben, bloß Melinda nicht. Aber sie konnte ja jemand fragen. Vielleicht einen Bahnangestellten.
„Sie machen einen etwas verlorenen Eindruck“, sagte in dem Moment eine sehr damenhafte Stimme neben ihr. „Kann ich Ihnen helfen?“
Melinda sah zur Seite. Eine geschmackvoll, aber unauffällig gekleidete Dame lächelte sie an. Sie war ungefähr fünfzig.
„Ich kenne mich in London nicht aus“, sagte Melinda, „und habe mir eben überlegt, daß ich jemand fragen sollte, wo ich übernachten kann.“
„Haben Sie keine Verwandten oder Freunde?“ fragte die Dame.
„Nein“, sagte Melinda. „Ich bin nach London gekommen, weil ich hier eine Anstellung suchen will. Der Zug hatte Verspätung, deshalb kann ich heute nichts mehr unternehmen.“
„Allerdings nicht“, sagte die Dame. „Sie suchen also eine Unterkunft?“
Melinda nickte.
„Für eine oder zwei Nächte. Eben bis ich eine Anstellung gefunden habe. Wissen Sie vielleicht, wo ich übernachten könnte?“
„Ich werde Ihnen helfen“, sagte die Dame freundlich. „Es muß ja scheußlich sein, wenn man wildfremd ist und sich nicht auskennt. Vor dem Bahnhof steht meine Kutsche. Kommen Sie, ich bringe Sie zu einer Unterkunft.“
„Das ist sehr lieb von Ihnen“, sagte Melinda dankbar. „Aber ich möchte Ihnen keine Mühe machen. Sie wollen doch sicher jemand abholen.“
„Das erzähle ich Ihnen unterwegs“, sagte die Dame. „Haben Sie kein Gepäck?“
„Nur die Tasche“, sagte Melinda.
„Dann kommen Sie, meine Liebe.“
Der Kutscher trug eine tadellos saubere Uniform. Das Pferd war gepflegt und gestriegelt, was Melinda sofort auffiel. Die Dame ließ Melinda den Vorrang, dann stieg auch sie ein.
„Aber Sie wollten doch sicher jemand abholen“, sagte Melinda noch einmal.
Die Dame stieß einen Seufzer aus.
„Ich fahre oft zum Bahnhof“, sagte sie. „Meine Tochter - sie ist ungefähr so alt wie Sie - sollte ankommen, und ich wollte sie abholen, aber sie kam wieder nicht. Ich habe seit damals nie wieder etwas von ihr gehört.“
„Wie schrecklich!“ rief Melinda.
„Ich habe nie erfahren, was geschehen ist“, fuhr die Dame traurig fort. „Deshalb fahre ich immer wieder zum Bahnhof. Ich hoffe immer noch, daß sie doch eines Tages kommt und ich sie dann mit nach Hause nehmen kann.“
„Das tut mir sehr leid“, sagte Melinda.
„Manchmal kann ich jungen Mädchen wie Ihnen helfen und dann bin ich glücklich. Verstehen Sie das?“
„Natürlich verstehe ich das“, sagte Melinda. „Vielen, vielen Dank. Ich wollte jedoch, ich wäre Ihre Tochter.“
„Wie lieb von Ihnen“, sagte die Dame. „Aber jetzt genug von meinem Kummer. Erzählen Sie mir ein bißchen. Leben Ihre Eltern auf dem Land?“
„Ich habe keine Eltern mehr“, sagte Melinda. „Mein Vater und meine Mutter sind bei einem Unfall mit der Kutsche ums Leben gekommen.“
„Sind Sie deshalb nach London gekommen?“
Melinda zögerte mit der Antwort. Vielleicht war es doch zu gefährlich, Sir Hector zu erwähnen.
„Ja, das ist der Grund“, sagte sie deshalb. „Ich habe kein Geld und muß arbeiten. Vielleicht wissen Sie die Adresse von Mrs. Brewers Agentur?“
„Darum können wir uns morgen kümmern. Wie alt sind Sie?“
„Ich bin achtzehn“, antwortete Melinda. „Ich bin bestimmt in der Lage, Kinder zu erziehen. Außer den üblichen Sachen kann ich malen, Klavierspielen und reiten.“
„Dann finden Sie bestimmt eine Stellung“, sagte die Dame. „Aber jetzt sollten wir uns gegenseitig vorstellen, finden Sie nicht auch?“
„Natürlich“, sagte Melinda und lächelte. „Ich bin Melinda Stanyon.“
„Was für ein hübscher Name!“ rief die Dame. „Und ich bin Mrs. Ella Harcourt. Ist es nicht schön, daß wir uns zufällig getroffen haben?“
„Doch, wirklich“, sagte Melinda.
Sie fuhren die ganze Zeit durch hellerleuchtete Straßen. Melinda hätte gern aus dem Fenster gesehen, wollte aber nicht unhöflich sein und schnappte nur ab und zu ein Bild aus dem Augenwinkel auf.
Mrs. Harcourt stellte viele Fragen, und Melinda war plötzlich sehr müde. Es war ein langer Tag gewesen, und die Nacht davor hatte sie ja keine Sekunde geschlafen. Melinda beantwortete die Fragen fast automatisch. Die Kutsche hielt plötzlich an.
„Wir sind da“, sagte Mrs. Harcourt. „Sie sehen müde aus. Ich bringe Sie gleich nach oben, morgen besprechen wir dann alles.“
„Ja“, sagte Melinda. „Und vielen Dank, daß Sie so nett zu mir sind. Verzeihen Sie, daß ich plötzlich so stumpf bin, aber ich kann kaum mehr die Augen offen halten.“
„Armes Kind“, sagte Mrs. Harcourt. „Kommen Sie.“
Sie stieg aus, Melinda folgte ihr. Sie befanden sich in einer ruhigen Straße mit eleganten Häusern. Sie gingen Stufen hinauf und eine Tür öffnete sich. Ein Mann in Livree geleitete einen Herrn aus dem Haus. Er hatte einen Abendanzug an. Eine gelbe Nelke steckte im Knopfloch des Jacketts. Er küßte Mrs. Harcourt die Hand.
„Ich hatte schon befürchtet, Sie heute gar nicht zu sehen“, sagte er.
„Ich war unterwegs, wie Seine Lordschaft sehen“, sagte Mrs. Harcourt.
„Wie ich sehe“, wiederholte der Herr langsam und bedeutungsvoll.
Er sah Melinda an. Sie blickte ihm in die Augen und glaubte, nie einen verderbteren Menschen gesehen zu haben. Alle Laster dieser Welt waren ihm ins Gesicht geschrieben. Zumindest war das Melindas erster Eindruck.
„Stellen Sie mich vor!“ sagte der Mann, und es klang fast wie ein Befehl.
„Ich habe die junge Dame eben erst am Bahnhof kennengelernt“, sagte Mrs. Harcourt schnell. „Sie ist todmüde und hat nur noch den Wunsch, zu schlafen. Ich hoffe, daß Sie uns entschuldigen, Lord Wortham.“
„Ich habe gebeten mich vorzustellen!“
Mrs. Harcourt zuckte fast unmerklich mit den Schultern.
„Melinda“, sagte sie, „darf ich Ihnen Lord Wortham, einen langjährigen Freund, vorstellen ... Miss Melinda Stanyon.“
Lord Wortham nahm Melinda an beiden Händen.
„Ist das Ihr erster Besuch in London, Miss Stanyon?“ fragte er.
„Ja“, sagte Melinda.
„Dann müssen wir aber alles tun, meine Liebe, daß Sie sich blendend amüsieren. Ich würde vorschlagen, daß wir uns möglichst oft treffen.“
Er hielt ihre Hände fest und sah auf sie herunter. In dem Lichtschein, der aus der Halle fiel, sah Melinda die tiefen Schatten unter seinen Augen. Seine Lippen wirkten geschwollen. Melinda wollte die Hände zurückziehen.
„Vielen Dank“, sagte sie leise, „aber ich ...“
„Wie ich schon sagte, Melinda ist todmüde, Lord Wortham“, schaltete sich Mrs. Harcourt ein, einen scharfen Ton in der Stimme.
„Ich habe es gehört, meine Liebe, ich habe es gehört“, sagte Lord Wortham. „Ein sehr süßes Gesicht. Sehr jung und unverdorben - unberührt.“
Melinda wandte sich ab.
„Bis morgen, meine liebe Melinda“, sagte Lord Wortham und küßte ihr beide Hände.
Melinda wußte nicht warum, aber die Berührung war unangenehm. Sie entzog ihm die Hände und lief an Mrs. Harcourt vorbei in die Halle.
„Lord Wortham!“ hörte sie Mrs. Harcourt wütend sagen. „Sie nehmen sich zu viel heraus!“
„Bis morgen“, erwiderte der Lord. „Und richten Sie Kate aus, daß die Kleine mir gehört.“
Melinda begriff seine Worte nicht und machte ihre Müdigkeit dafür verantwortlich.