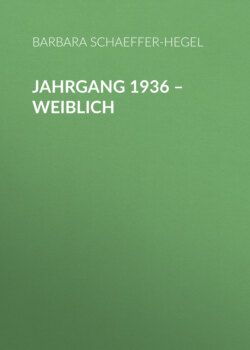Читать книгу Jahrgang 1936 – weiblich - Barbara Schaeffer-Hegel - Страница 11
Оглавление»In Wahrheit bedingt einzig Erfülltheit mit Erlebnis
das Maß einer Seele –
darum zählen in einer Lebensgeschichte
nur die gespannten Augenblicke –,
nur von ihnen aus gesehen wird sie richtig erzählt.«
(Stefan Zweig: Marie Stuart, Einleitung)
Kapitel I: Kindheit
1. Das Jahr 1936
Der 10. November 1936 war ein Dienstag.
Ich wurde morgens um 4:00 Uhr im Elisabeth Hospital in Kassel als zweites Kind und einzige Tochter des Dr. Ernst Immanuel Schweizer und seiner Frau Hilda Schweizer, geb. Schwab, geboren. Obwohl meine Mutter ihren Vornamen hasste, wurde er in der von ihr abgemilderten Form „Hilde“ der neugeborenen Barbara Christine als dritter Vorname angehängt. Eigentlich sollte meine Mutter „Paula“ heißen. Mein Großvater hatte ihr diesen im Jahre 1900 extrem altmodischen Namen aus Wut darüber verpasst, dass sein sechstes Kind nach bereits drei Töchtern schon wieder ein Mädchen war. Nach langem Drängen erreichten die älteren Schwestern meiner Mutter dann aber doch, dass ihr Vater zum Standesamt zurückkehrte und „Paula“ in „Hilda“ änderte. Mehr ging nicht.
Am Tage vor meiner Geburt hatten meine Eltern, die aus dem heimatlichen Stuttgart nach Kassel gezogen waren, eines ihrer schwäbischen Lieblingsgerichte auf dem Mittagstisch: Linsen, Spätzle und Saidewürscht, was dazu führte, dass mein Vater die am Abend einsetzenden Leibschmerzen meiner Mutter auf die Linsen zurückführte und ihr wegen ihres Speiseplans Vorwürfe machte. Es waren aber nicht die Linsen. Es war ihre Tochter Barbara, die zum errechneten Termin morgens um 4:00 Uhr als gesundes Baby auf die Welt kam.
Erste Fotos.
Ich kam zwar pünktlich, aber doch mit zehnjähriger Verspätung. Denn mein Geburtsdatum verdanke ich dem württembergischen Beamtengesetz. In Übereinstimmung mit Johann Gottlieb Fichtes (1772–1814) Geschlechterphilosophie3, nach der eine verheiratete Frau nicht Staatsbeamtin sein kann, durfte eine Beamtin, wie meine Mutter eine war als sie meinen Vater kennen und lieben lernte, noch während der Weimarer Republik nicht heiraten, es sei denn, sie würde auf ihren Beruf und auf ihren Beamtenstatus verzichten4. Frauen, so Fichte, können nicht zwei Herren zugleich dienen – dem Staat und dem Ehemann!
Meine Geburtsanzeige.
Mein Vater, promovierter Germanist, war 1923 Regisseur bei der Württembergischen Landesbühne, einem renommierten Wandertheater, und – wie viele junge Menschen heute – nur zeitlich begrenzt auf Honorarbasis angestellt. Meine Mutter hatte das Elend ihrer eigenen Mutter vor Augen und weigerte sich zu heiraten. Ihr Vater, mein Großvater mütterlicherseits, ein höherer Beamter im württembergischen Staatsdienst, war 1904 im Alter von nur 60 Jahren gestorben – wenige Jahre ehe das württembergische Beamtengesetz geändert und Beamtenwitwen eine Rente zugesprochen wurde. Ohne Beruf und ohne Einkommen stand meine Großmutter mit sechs Kindern vor dem Nichts. Sie musste den württembergischen König, bzw. die Verwaltungsdienststelle, der ihr Mann vorgestanden hatte, um Unterstützung ersuchen, was ihr unendlich schwerfiel. Dennoch erzielte sie für ihre beiden Söhne, Hugo und Gustav, Stipendien fürs Gymnasium und für das Studium an der Universität. Die beiden älteren Mädchen wurden verheiratet, meine Tante Julie gegen ihren ausdrücklichen Willen5. Für ihre beiden jüngsten Töchter, meine Mutter und ihre vier Jahre ältere Schwester Gertrud, erwirkte meine Großmutter ebenfalls Stipendien – für eine Ausbildung als Lehrerin: Mädchengymnasium mit anschließender zweijähriger Ausbildung im Lehrerinnenseminar. Auf diese Weise und durch die Vermietung mehrerer Zimmer ihrer Wohnung schaffte es meine Großmutter, sich und ihre Kinder durchzubringen. Doch als ihre Jüngste, meine Mutter, in Tübingen eine Anstellung an der dortigen Höheren Mädchenschule bekommen hatte und als Lebenszeitbeamtin gut versorgt war, waren ihre eigenen Lebenskräfte aufgezehrt. Nach mehreren erfolglosen Versuchen ertränkte sie sich 1922, gerade mal 60 Jahre alt, im Neckar.
Meine Mutter.
Gewarnt durch das Beispiel ihrer Mutter weigerte sich meine Mutter ihre Beamtinnen-Position aufzugeben, solange ihr mein Vater keine gesicherte Zukunft bieten konnte. Als wandernder Regisseur und Schauspieler mit Jahresverträgen konnte er das nicht. So lebten meine Eltern zehn Jahre lang als Verlobte zusammen, wobei sie von den Erkenntnissen der Lebensreformbewegung profitieren konnten, die in den zwanziger Jahren ausführlich über Geburtenkontrolle und Verhütungspraktiken informierte.
Großeltern, Eltern und Kinder.
Meine Mutter mit ihren 3 Kinder.
Erst als meinem Vater 1933 eine feste Anstellung als Leiter eines UFA-Lichtspielhauses angeboten wurde, kündigte meine Mutter ihre Stelle in Tübingen, heiratete und zog mit meinem Vater nach Kassel. Ein knappes Jahr später kam mein älterer Bruder Peter zur Welt.
Das Jahr 1936 war ein besonders geschichtsträchtiges Jahr. 1936 kamen weltweit – in Deutschland, in Italien, in Spanien und in gewisser Weise auch in Ostasien – die Entwicklungen zum Abschluss, die wenig später die gesamte Welt in den zweiten, den furchtbarsten Abgrund des Jahrhunderts führen würden – in den Zweiten Weltkrieg.
Das Jahr 1936 brachte u.a. die endgültige Konsolidierung der Naziherrschaft in Deutschland. Nachdem im Vorjahr 1935 die Rückführung des Saarlandes ins Deutsche Reich gelungen war und nachdem die vertragswidrige Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, ebenfalls 1935, ohne nennenswerten Widerstand der Versailler Vertragspartner hingenommen wurde, besetzte Hitlerdeutschland am 7. März 1936 das Rheinland. Ein erneuter schwerwiegender Bruch des Versailler Vertrags, mit dem sich die Mächte der Entente – Frankreich, England, Italien und die USA – durch die Überreichung von nur lauen Protestnoten abfanden. Nach der Einführung des Reichsarbeitsdienstes und der allgemeinen Wehrpflicht (beides im Jahr 1935) verpflichtete das am 1. Dezember 1936 erlassene „Gesetz über die Hitlerjugend“ neben den 15- bis 18-jährigen, der Hitlerjugend, nun auch die zehn bis 14-jährigen Jungen zum Beitritt in das Deutsche Jungvolk. 1936 kam erstmals ein kompletter Geburtenjahrgang, der Jahrgang 1926, geschlossen in die HJ. Die Mädchen wurden ab dem Alter von zehn Jahren zur Mitgliedschaft im Mädelbund, die 14 bis 16-jährigen im Bund deutscher Mädchen (BDM) genötigt. Die gesamte deutsche Jugend war ab 1936 ganztägig der Indoktrination durch Rassen- und Naziideologie ausgesetzt und wurde – unter anderem durch attraktive Sport- und Freizeitangebote – zum willigen Fußvolk des Diktators gedrillt. Ab jetzt waren Kinder und Jugendliche dem Einfluss ihrer Eltern weitgehend entzogen.
Nach der innenpolitischen Gleichschaltung, die alle Berufsverbände, Vereine, Genossenschaften und auch die Gewerkschaften, die Kirchen und selbst die Beamtenschaft betraf, gelang Hitler im Jahre 1936 auch die außenpolitische Festigung seiner Macht. Am 17. Juli verständigte sich das NS-Regime mit Österreich, am 25. Oktober bildeten Hitler und Mussolini die Achse Berlin-Rom, und am 25. November wurde der Antikominternpakt zwischen Japan und Deutschland6 unterzeichnet, dem im Jahr darauf auch Mussolinis Italien beitrat. Die Wiederaufrüstung Deutschlands lief trotz des vertraglichen Verbots bereits auf hohen Touren. Deutschland hatte die Ketten des Versailler Vertrags abgeschüttelt; die Festlichkeiten der Olympischen Spiele im August 1936 in Berlin besiegelten den Triumph Adolf Hitlers.
Doch das Jahr 1936 brachte der Welt auch ein Versprechen für die Zukunft: am 3. November 1936 wurde Frank Delano Roosevelt mit großer Mehrheit zum 32. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Roosevelt, der zweimal wiedergewählt wurde, ist bis heute der US-Präsident mit der längsten Amtszeit. Mit Churchill, dem das größte Verdienst anzurechnen ist, und auch mit Hilfe von Stalin hat Roosevelt wesentlich zur Bezwingung der nationalsozialistischen Katastrophe beigetragen. Bis zu seinem Tode am 12. April 1945 bestimmte Roosevelt entscheidend über das Schicksal der Welt und auch Deutschlands.
1936! Drei Jahren noch bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges! Nur diese knapp drei Jahre meines Lebens verbrachte ich in einem Frieden, den Hitler und seine nationalsozialistische Gefolgschaft zur Vorbereitung einer der größten Katastrophen der Geschichte nutzten – und wusste nichts davon. Vom Frieden nichts und nichts vom Krieg.
2. Kassel
Vom Krieg spürte ich, wie gesagt, nichts in unserem Kasseler Heim, einer großzügigen Wohnung mit Terrasse und Zugang zum Garten, mit Sandkasten und Spielwiese. Die erste Wohnung, an die ich mich erinnere, Weinbergstraße 33, lag in der Nähe der Villa Henschel in einer Sackgasse. Eine ideale Spielstraße. Wir hatten Freundinnen und Freunde in der Nachbarschaft; wir spielten auf der Straße, in unserem Garten, in den Gärten der Nachbarn und im Fürstengarten, einem kleinen Park, der nicht weit von unserem Haus gegenüber der Villa Henschel gelegen war und vielfältige Spielmöglichkeiten bot. Außer wenn ich dazu verdonnert wurde, in der Stube zu sitzen und Deckchen für Oma und Opa und für irgendwelche Tanten zu sticken, während meine Brüder draußen herumtoben durften, verbrachte ich meine ersten Lebensjahre überwiegend im Freien. Unsere Kinderfreundschaften waren eng und herzlich. Mit Elslein Roth, meiner ersten Freundin aus dem Haus auf der anderen Straßenseite, hielt ich noch Jahre nachdem wir getrennt worden waren, Verbindung, die dann leider mit dem Kriegsende und den großen Bevölkerungsverschiebungen in Deutschland abbrach.
Mein Vater mit meinem Bruder und mir.
Als Vierjährige verliebte ich mich zum ersten Mal. In den Freund meines Bruders Peter, in Hans Brandt. Einmal, als Peter, Hans und ich in unserem Sandkasten im Garten spielten und mein Bruder fand, dass ich das Spiel der Jungen störe, sollte ich aus dem Sandkasten verschwinden. Doch ich blieb wie festgenagelt auf der hölzernen Umrandung unseres Spielkastens sitzen. Erst nachdem mir Hans versprochen hatte, mich später zu heiraten, ließ ich die beiden Jungen in Ruhe. Und nachts wickelte ich mich genüsslich in eine rote Strickjacke, die Hans zu klein geworden war und die seine Großmutter, bei der er wohnte, meiner Mutter als Nachtjacke für mich abgetreten hatte.
Mein Bruder Jochen und ich.
Unsere Straße, die Weinbergstraße, führte nach etwa 100m stadteinwärts zwischen dem Fürstengarten und der den ganzen Hang einnehmenden Villa Henschel hindurch. Im Fürstengarten stand ich zum ersten Mal auf Skiern und fuhr als Fünfjährige einen sanft auslaufenden Abhang hinunter, der eine kaum wahrnehmbare Steigung aufwies, und an dessen Ende wir ein kleines Schneehügelchen aufgeworfen hatten. Immer geradeaus und ohne Stöcke aber mit der glücklichen Gewissheit, dass ich jetzt Skifahren könne. Was sich später, als ich an einem steileren Hang mit tieferem Schnee meinen Freunden meine sportlichen Fähigkeiten vorführen wollte, als jämmerliche Fehleinschätzung herausstellte.
Am Ende des Parks und der Henschel Villa mündete unsere Weinbergstraße in eine Fußgängerbrücke, die sich über eine unter ihr hindurchführende Schnellstraße spannte. Hinter der Brücke ging es an mehreren großen, Eindruck erheischenden Gebäuden vorbei, die früher einmal Marställe oder Stadtpaläste berühmter Edelleute gewesen sein mussten. An der Toreinfahrt eines dieser Paläste stand ich eines Tages, meinen kleinen Bruder, den mit den schorffrei glatten Knien, an der Hand, und starrte durch die Eisenstäbe hindurch. Sie verwehrten uns den Zugang zu einem großen, herrschaftlichen Hof. Auf dem Hof spielte eine Horde Kinder. Jagten sich, sprangen über Seile, rauften sich, und tummelte sich in einem riesigen Sandkasten, in welchem sie Kuchen backten und Burgen bauten. Ich konnte mich an der Schar der Kinder nicht satt sehen. Sie schienen so glücklich, so frei, so schwerelos zufrieden. Meine Mutter erklärte mir, dass dies ein „Kindergarten“ sei. Für Kinder nur, deren Eltern sich nicht um sie kümmern konnten oder sich nicht kümmern wollten. Aber ich wollte trotzdem da hinein. Musste dazu gehören, mit all diesen Kindern spielen, in dem wundervollen großen Hof, der mir der Vorgarten zu einem Palast zu sein schien.
Wie auch immer ich es erreichte, einige Zeit später marschierte ich morgens um 8:00 Uhr meinen kleinen Bruder an der Hand, und ein Brottäschchen um den Hals, in den Kindergarten und dort, da muss ich wohl schon fünf oder sechs gewesen sein, verliebte ich mich zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben in ein weibliches Wesen.
Die schlossähnliche Villa Henschel, deren Gebäude man durch einen die Straße begleitenden, mannshohen Zaun aus Eisenstäben hindurch erspähen konnte, lag mitten in einem gepflegten Park, mitten auf einem mit Blumen und bunten Büschen geschmückten Rasen. Die Menschen, die in diesem „Schloss“ wohnten und die man nie zu sehen bekam, mussten Feen oder Zauberer sein, jedenfalls von einer so besonderen Art, dass man als normaler Mensch nicht mit Ihnen sprechen konnte. Und dann bekam ich im Kindergarten ein kleines, blondes, elfenhaft schönes Mädchen zu Gesicht, von der es hieß, dass sie hinter den Henschelschen Gitterstäben wohnte. Das Elfenmädchen mit den Goldhaaren und dem Puppengesicht trug ein samt-seidiges rotes Kleidchen mit gesmokten Stickereien am Halsausschnitt und an den Ärmeln, oder auch ein blaues, oder gelbes – jedenfalls trug sie ein Kleidchen so kostbar, wie ich es nie besitzen würde. Sie spielte und lachte und sang mit den Kindern an ihrem Tisch – meilenweit entfernt von dem Tisch an dem ich saß. Aber ich konnte ihr reizendes Gesicht sehen und jedes Mal, wenn ich sie anschaute, klopfte mir das Herz so sehr, dass ich wegsehen musste. Trotzdem musste ich immer wieder hinsehen, dieses Wundermädchen anstarren, um verwirrt und beschämt die Augen zu schließen und ein warmes Schwindelgefühl im Bauch zu spüren. Ich erinnere mich nicht, dass ich meine kleine Liebe je angesprochen hätte, auch kannte ich wohl nicht einmal ihren Namen. Ich wusste nur, dass sie seit kurzem in der Villa wohnte und wahrscheinlich die Tochter ausgebombter Verwandter war. Und dass es mich jeden Morgen wie magisch in den Kindergarten zog, um sie zu sehen.
Der Kindergarten verschaffte mir aber auch das erste noch ganz unverstandene Gefühl für Naziherrschaft und Krieg. Vom Krieg wussten wir Kinder nichts, auch als später mein Vater verschwand und nur noch gelegentlich für ein bis zwei Tage am Wochenende zu Besuch kam. Wir Kinder bemerkten seine Abwesenheit kaum, war er doch auch vorher tagsüber nie zu Hause, und wenn er abends nach Hause kam, waren wir Kinder meist schon im Bett. Meine Mutter brachte ihm um die Mittagszeit das Essen in Blechdosen, die dick in Zeitungspapier eingewickelt waren, in seinen Filmpalast. Einmal durfte ich meine Mutter bei ihrem Essensgang begleiten und stellte mich, während sie beim Vater im Büro war, in die geöffnete Tür des Kinosaals. Was ich da auf der Leinwand sah, war mir völlig unverständlich. Männer mit Gewehren und Stahlmützen auf dem Kopf, Feuer und Geschrei und martialische Marschmusik. Eine tiefe Männerstimme, der das alles sehr zu gefallen schien, überdröhnte die dahin rennenden Bilder, jubelte laut und macht mir Angst. Meine Mutter zog mich von den Bildern weg und sagte etwas von Wochenschau. Von Krieg sagte sie nichts.
Als der Krieg begann, war ich noch nicht drei Jahre alt. Zwar wussten wir Kinder noch immer nichts vom Krieg, aber was etwa zwei Jahre später an einem Tag im Kindergarten passierte, gab mir eine sehr undeutliche, aber auch sehr unangenehme Ahnung. Die Regeln im Kindergarten waren streng. Wenn die Kinder an ihren kleinen Tischen saßen und ihre Hände nicht mit Essen oder Basteln beschäftigt waren, mussten sie flach auf dem Tisch liegen. Die vier Finger auf, der Daumen unter der Tischplatte. Und wir mussten mucksmäuschenstill sein. Kein Laut durfte über unsere Lippen kommen. Eines Tages, im Sommer, spielten die Kindergartentanten – es waren drei oder vier junge Frauen – zusammen mit der Köchin und der Putzfrau verrückt. Sie drehten das Radio auf, spielten laute Musik und holten Blechdeckel aus der Küche mit denen sie den Takt schlugen und dabei laut sangen. Sie saßen auf Stühlen, die sie auf unsere Kindertischchen hochgestellt hatten, kreischten und sangen, während eine von ihnen mit einem Rohrstock bewaffnet die Kindertische entlang ging und auf jede Hand schlug, die nicht ordnungsgemäß auf dem Tisch lag und jedem Kind, das einen Laut von sich gab, den Rohrstock über den Rücken zog. Dass die Kindergartentanten einen Sieg der deutschen Wehrmacht feierten, konnte ich nicht ahnen, aber dass Erwachsene für mich keine natürlichen Autoritäten mehr waren, stand nach diesem Erlebnis fest.
Noch eine andere Erfahrung, eine im Familienkreis, hat dazu beigetragen, dass ich Erwachsene schon als Kind nicht als unfehlbar wahrnahm, sondern in ihnen schon im Vorschulalter Menschen mit Fehlern sah.
Unsere Wohnung in der Weinbergstraße bestand aus fünf Zimmern, einer Kammer, einer Küche und einem Bad. Wir Kinder wohnten im Kinderzimmer, an welches das Zimmer des jeweiligen Dienstmädchens anschloss, sodass sie uns – wir aber auch sie – des Nachts überwachen konnten. Zum Garten hin lagen das Elternschlafzimmer, das Esszimmer und das Herrenzimmer, welches für uns Kindern nur zu Weihnachten zugänglich war oder wenn Gäste kamen und wir Ihnen mit Diener und Knicks guten Tag sagen durften, ehe wir im Kinderzimmer zu verschwinden hatten. Allerdings führte der Durchgang zu einer kleinen Terrasse mit der Treppe zum Garten nur durch das Herrenzimmer. Wenn wir in den Garten wollten, aber nur dann, durften wir daher das Herrenzimmer betreten.
Als mein Vater, es muss in den ersten Kriegsjahren gewesen sein, auf Urlaub oder über ein Wochenende zu Hause war, zeigt er uns Kindern seine neueste Errungenschaft: eine Taschenuhr aus Silber, die ihm ganz offensichtlich viel bedeutete. Wir durften die Uhr ansehen, sie aber nicht berühren. Das wurde uns unter Androhung der schlimmsten Strafen strikt verboten.
Ich muss zuvor sagen, dass meine Eltern uns Kinder nicht schlugen. Ich kann mich an schlimme Schimpftiraden, an Hausund Stubenarrest und an Taschengeldentzug erinnern, aber an keine elterlichen Schläge. Umso eindrucksvoller für mich war das, was an jenem Urlaubstag passierte:
Auf dem Weg in den Garten durchquerte ich das verbotene Herrenzimmer – und sah auf Vaters Schreibtisch die neue Uhr liegen. Ich blieb stehen und schaut die Uhr an. Das glitzernde runde Schmuckstück mit der langen Kette und den Zahlen im Gesicht zog mich magisch an. Schließlich lag die Uhr auf meiner Hand, ich streichelte sie vorsichtig mit nur einem Finger und entdeckte dabei ein kleines Rädchen, das sich kinderleicht drehen ließ. Mehrmals drehte ich das niedliche Rädchen hin und her und sah, wie die Zeiger der Uhr sich langsam und lautlos in Bewegung setzten. Aber mir zitterten die Knie. Zwar waren die Eltern ausgegangen und meine Brüder spielten im Garten. Es konnte also nichts passieren. Trotzdem legte ich das kleine Wunderwerk sehr bald und sehr sorgfältig an genau die Stelle zurück, an der es vorher gelegen hatte. Die Stelle hatte ich mir genauestens gemerkt.
Stunden später spielten wir drei Kinder im Kinderzimmer. Die Eltern waren zurück, es sollte gleich Abendbrot geben. Da stürmte mein Vater ins Kinderzimmer. »Wer hat mit meiner Uhr gespielt?« schrie er und ging, vor Zorn rot im Gesicht auf meinen älteren Bruder los. »Lass ihn los, lass ihn los, ich war es!« rief ich laut dazwischen und: »Ich habe die Uhr angefasst, ich habe sie in die Hand genommen, ich war es!« Mein Vater wollte nichts hören, packte meinen Bruder, legte ihn übers Knie und schlug zu. »Ich war es, ich war es!« schrie ich immer wieder, aber mein Vater ließ nicht ab. Nachdem er den Großen hinlänglich vermöbelt hatte und dieser laut heulte, packte er sich den Kleinen und versohlte ihn ebenfalls. Mein ständiges Schreien »Ich, ich war es!« hielt ihn nicht auf und erst als letzte kriegte dann auch ich meine Tracht Prügel verabreicht.
Als mein Vater wieder draußen war, schauten mich meine beiden Brüder mit bösen Blicken an und wandten sich von mir ab. Dass es mir so sehr leidtat und dass ich mich bei ihnen entschuldigte, änderte nichts daran.
3.Tübingen (1943)
In der Nacht vom 22. auf den 23. Oktober 1943, als Kassel, unter anderem der Henschel-Werke wegen, in Schutt und Asche gelegt wurde, brannte auch unser Haus in der Weinbergstraße bis auf die Grundmauern ab. Eine Phosphorbombe hatte es getroffen und alles Brennbare vernichtet. Auch meinen Puppenwagen mit meinen geliebten Puppen. Mein Vater, der einen solchen Angriff auf Kassel vorausgehen hatte, hatte dafür gesorgt, dass wir nach den Sommerferien 1943, die wir bei meiner Tante Gertrud in Tübingen verbrachten, nicht nach Kassel zurückgekehrt waren.
In Tübingen wurde ich eingeschult. Etwas spät, wie ich fand, aber da ich im November geboren war, nahm man mich 1942 mit nur fünfeinhalb Jahren trotz meines dringenden Wunsches und eines Besuchs in der Kasseler Schule, an den ich mich gut erinnern kann, nicht an. Der Schulanfang in Tübingen stellte sich für mich dann allerdings als beschwerlich heraus. Stand ich doch unter der Fuchtel von insgesamt drei Lehrern: in der Schule unter der absoluten Autorität von Herr Lange; zuhause unter der meiner Mutter und Tante Gertruds, die beide von Beruf Lehrerin waren. Immer wieder wischten Mutter und Tante die Schiefertafel aus, auf der ich die vom Lehrer am Anfang jeder Zeile vorgeschriebenen Buchstaben „OH MAMA“ und „HALLO OMA“ feinsäuberlich bis zum Ende der Zeile hingeschrieben hatte. Immer wieder, den ganzen Nachmittag, hatte ich versucht, diese verflixten Buchstaben gerade und gleichmäßig auf die Tafel zu bringen. Immer wieder kam Tante Gertrud oder Mama mit dem feuchten Schwamm und wischte alles aus. Bis endlich die ungefähr siebte vollgeschriebene Tafel Gnade bei ihnen fand. Voller Stolz präsentierte ich am nächsten Morgen mein Werk Herrn Lange, als dieser die Reihen abschritt und jede Tafel eingehend begutachtete. Ich saß in der Fensterreihe auf der letzten Bank und freute mich auf sein Lob. Doch Herr Lange schaute nur kurz auf meine Tafel, schüttelte den Kopf, nahm eine dicke rote Kreide aus der Tasche und vernichtete die Freude über mein Meisterwerk mit einem dicken Strich.
Bärbel geht zur Schule.
Tante Gertrud hatte eine große Wohnung und Platz für uns alle, aber keinerlei Verständnis für Kinder. Außerdem war sie krank und ertrug keinen Lärm. Nachdem unser Haus abgebrannt und eine Rückkehr nach Kassel daher unmöglich geworden war, eine dauerhafte Bleibe von Tante Gertrud jedoch nicht gebilligt wurde, mussten wir aus ihrer Wohnung verschwinden. Wohnungen gab es aber keine, und in Tübingen schon gar nicht. Also wohin? Mein kleiner Bruder wurde zu unserem Onkel Karl, der in Eger, im Sudetenland, eine angesehene Staatsstelle innehatte, verfrachtet. Das Kindergeschrei am Bahnhof, als der fünfjährige Jochen allein einer fremden Person übergeben wurde, klingt mir noch heute in den Ohren. Mein älterer Bruder Peter und ich wurden getrennt bei Tübinger Freunden untergebracht, während sich unsere Mutter in ganz Württemberg auf Wohnungssuche machte.
Das halbe Jahr, für das es unsere kleine Familie in wechselnder Zusammensetzung nach Tübingen verschlagen hatte, muss eine für mich nicht sehr glückliche Zeit gewesen sein. Denn nur zwei weitere, gar nicht so glückliche Ereignisse erinnere ich aus dieser Zeit. Der eine Vorfall hatte mit der Schule zu tun. Unsere Mutter war, wie gesagt, auf Wohnungssuche im „Ländle“ unterwegs und die Wohnung von Lambrechts, bei denen ich untergebracht war, lag fast eine halbe Stunde Fußmarsch von der Schule entfernt. Zu weit für meine Blase. Die Toiletten in der Schule stanken aber so grässlich und waren in jeder Hinsicht unappetitlich, dass die Blase warten musste. In zunehmender Angst, es nicht mehr halten zu können, lief ich fast den ganzen Weg bis zum hinteren Ende der Gartenstraße in Lustenau, rannte dort die Treppe hinauf in den ersten Stock, klingelte an der Wohnungstür und entleerte meine volle Blase just in dem Moment, als Frau Lambrecht mir die Türe öffnet.
Außer diesem für mich hochpeinlichen Vorfall – die Lambrechts waren ja Fremde für mich – erinnere ich nur noch den Schmerz, der mich erfüllte, als mein Bruder Peter, der bei Freunden, die auf einer Anhöhe wohnten, untergekommen war, auf dem Weg in sein Zuhause einen Hang erklomm. Ich stand am Fuß dieses Hanges und heftete meine Augen sehnsüchtig auf den kleinen Jungen, der immer kleiner wurde und schließlich auf der Höhe als winziger Punkt hinter den Bäumen verschwand.
Und doch taucht da eine Begebenheit in meinem Gedächtnis auf, die für mich zwar auch eher peinlich war, die aber dennoch eines gewissen Witzes nicht entbehrt.
Einer der Sonntagsausflüge, die meine Mutter mit uns unternahm, ehe sie auf Wohnungssuche ging, führte uns hinauf zur Wurmlinger Kapelle. Ein kleiner Friedhof, der sich mit seinen frischen Blumengestecken wie eine Art Halsschmuck um das kleine Kirchlein legte, verleitete mich zu allerlei Fragen über Kirchen, über Friedhöfe, über das Sterben und darüber, was das alles mit Religion zu tun habe. Zum ersten Mal erfuhr ich bei dieser Gelegenheit, dass es zwei verschiedene Glaubensrichtungen in Deutschland gibt, hörte etwas von „katholisch“ und „evangelisch“, und zum ersten Mal nahm sich unsere Mutter Zeit, mir alle meine Fragen zu beantworten. Denn natürlich wollte ich genau wissen, worin der Unterschied zwischen „katholisch“ und „evangelisch“ bestand. Meine Mutter erklärte es mir und sie erklärte es sicher sehr gut. Doch nichts davon erinnere ich, außer der Tatsache, die mich am meisten beeindruckte, nämlich, dass den Katholiken eine Feuerbestattung verboten war, den Angehörigen der evangelischen Kirche jedoch nicht. Als ich ein paar Tage später von Herrn Lange im Rahmen einer Erhebung von Schülerdaten gefragt wurde, ob ich evangelisch oder katholisch sei und ich mich nicht mehr an die Worte erinnern konnte, sagte ich: »ich gehöre zu denen, die nach dem Tod verbrannt werden.«
4. Künzelsau
Unter der Bedingung, dass sie ihren Beruf als Lehrerin wiederaufnehmen würde – die männlichen Lehrer waren gefallen, an der Front oder in Gefangenschaft –, ergatterte unsere Mutter tatsächlich eine für damalige Verhältnisse traumhafte Unterkunft für uns: im Lehrertrakt des Schlosses von Künzelsau. Offensichtlich hatte sie es dem Bürgermeister des Ortes angetan, denn statt sie in die schon vereinbarten zwei Dachzimmer mit Kochplatte auf dem Flur zu bringen, die ihr bei ihrem ersten Besuch angeboten worden war, führte er sie bei ihrem zweiten Besuch in Künzelsau ins Schloss.
Künzelsau,
Ölbild aus dem 19. Jhdt.
Und im Schloss ging es uns gut. Meine Mutter, wir drei Kinder und die 17-jährige Toni, die ihr Arbeitsdienstjahr in unserer Familie absolvierte und die vor Heimweh nach ihrem Dorf immer wieder in Tränen ausbrach, bewohnten zu fünft drei große Zimmer. Ein Kinderschlafzimmer, das auch Toni mit uns teilte, ein Elternschlafzimmer, das meine Mutter alleine bezog, und ein großes Wohn- und Esszimmer. Die Küche und das Bad mussten wir mit einem kinderlosen Ehepaar teilen, mit Dr. Karl Helbricht und seiner Frau Gertraude. Dr. Helbricht war Mathematiklehrer in der Napolaschule7, zu der unser Lehrertrakt gehörte. Ob in weiser Voraussicht der Dinge, die da kommen würden, oder nur, weil sie die Sprache beherrschte, jedenfalls versuchte Frau Helbricht uns Kindern Englisch beizubringen, indem sie auf alle Türen und Schränke und auf jede Menge anderer Gegenstände englischsprachige Zettel klebte, die uns den korrekten Umgang mit dem jeweiligen Gegenstand vermitteln sollten. „Please flush the toilet“stand da, oder: „Please shut the door“. Mein erster englischer Satz lautete daher:
„p l e a s e sch u t te d o r“
Das ganze Schloss war rosa angestrichen, was uns damit erklärt wurde, dass Rosa die einzige Farbe gewesen sei, die es noch gab, als es nötig wurde, das Gebäude vor dem Einzug der Napola zu verputzen. Ehe dann die kleinen Jungen in Uniform kommen konnten. Angeblich die besten ihres Jahrganges. Sie sahen wie kleine Soldaten aus und gingen, mir völlig unverständlich, immer nur neben- oder hintereinander in Reih und Glied. Man sah sie nie einzeln herumrennen oder rumtoben, nur ab und zu, von einer schreienden Stimme gezwungen, über steile, extra im Schlosshof aufgestellte Holzwände klettern oder durch Schlammpfützen kriechen.
Aber die Jungen aus der Napola gingen uns nichts an, sagte meine Mutter. Und in der Tat, wir drei Kinder lebten, sofern es das Wetter irgendwie zuließ, im Park. Der Park hinter dem Schloss, früher einmal ein groß angelegter, hochherrschaftlicher Lustgarten, war völlig heruntergekommen. Aber ein wunderbarer Spielplatz. Mit seinen gefallenen Bäumen, die tiefe Löcher im Boden hinterlassen hatten, vor denen die herausgerissenen Wurzeln wie Vorhänge hingen; mit seinen Wiesen, die nie gemäht wurden und auf denen es niemanden gab, der uns hätte verjagen können, wenn wir beim Blumenpflücken das Gras niedertrampelten; und mit seinem Wäldchen, in dem man wunderbar Verstecken spielen konnte, war er ein Paradies für Kinder. Das Schönste im Park war jedoch die Ruine eines Wohnheimes, das für noch mehr Napola Schüler gebaut werden sollte, aber niemals fertiggestellt wurde, da es kein Material mehr gab, um irgendetwas zu bauen. Das steinerne Fundament dieses Phantomgebäudes war Leonies und mein Spielhaus und das Zuhause für unsere Puppen. Leonie, die bald meine beste Freundin wurde, wohnte mit ihrer Mutter im Stockwerk über uns. Auf dem Schrottplatz vor dem Schloss fanden wir Scherben in Hülle und Fülle, die wir zusammen mit locker herumliegenden Backsteinen, abgebrochenen Ästen und lehmiger Erde zum Bau einer perfekt eingerichteten Küche benutzten.
Im Park gab es so viel zu tun, sodass ein einziger Tag uns nie ausreichte. Aber Mutter hatte nichts dagegen, wenn wir den ganzen Tag draußen blieben. Auch wenn an klaren Tagen manchmal Flugzeuge Wellen von Donner über den wolkenlosen Himmel schickten. Die Flugzeuge, das wusste ich, flogen zu den großen Städten, um dort Bomben abzuwerfen. Aber hier, im Park gab es keine Gefahr. Wenn der Sommerhimmel zu donnern begann und unsere Mütter uns nicht riefen, rannten Leonie und ich mit meinen Brüdern in das Waldstück des Parks und versteckten uns in einer Wurzelhöhle. Der donnernde Himmel war wohl kein gutes Zeichen. Aber das Rennen unter die Bäume und das sich Verstecken hinter den Wurzelgardinen war aufregend. Und die silbernen Flugzeuge auf dem tintenblauen Himmel sahen aus wie Schwärme von Zugvögeln, die vorzeitig nach Süden flogen.
Die einzige Gefahr im Park war Dr. Schütz.
Dr. Schütz war der Direktor der Napola Schule. Obwohl er nicht Mamas Direktor war – Mama unterrichtete an der städtischen Oberschule – hatte Mama uns strengstens eingeschärft, Herrn Dr. Schütz niemals zu ärgern. Wenn mir Dr. Schütz im Park begegnete, musste ich strammstehen, meinen rechten Arm nach oben werfen und rufen:
»Heil Hitler, Herr Dr. Schütz!«,
selbst, wenn wir gerade dabei waren, unsere Puppen schlafen zu legen. Wenn ich einmal vergaß, Dr. Schütz zu grüßen oder ihn gar nicht gesehen hatte, wusste meine Mutter das immer und schimpfte mich abends. Mama wurde dann richtig ärgerlich. Dr. Schütz war allmächtig. Alle hatten Angst vor ihm. Ich merkte es daran, dass die Leute, wenn sie mit ihm sprachen, ihre Stimme senkten. Und niemand würde es je wagen, ihn als erster anzusprechen. Außer natürlich mit dem obligatorischen Gruß
»Heil Hitler, Herr Dr. Schütz!«,
den bei ihm niemand zu einem nachlässigen »Ha hit la!« verwischte, was sonst durchaus üblich war.
Ich konnte Herrn Dr. Schütz nicht leiden.
Schon, weil Mama Angst vor ihm hatte konnte ich ihn nicht leiden. Ich wusste nicht, warum Mama Angst vor ihm hatte. Dr. Schütz, dachte ich, musste jemand sein, der Dinge geschehen lassen konnte, die anderen Leuten nicht möglich waren und die ihnen vielleicht schaden konnten. Und Dr. Schütz war nie freundlich. Er war böse. Dr. Schütz hatte mich noch niemals angesprochen, aber ich wusste, dass er böse war.
Eines Tages im April 1945 wurde ich schon mittags von meiner Mutter ins Haus gerufen. Am Nachmittag hatten Flieger den Himmel mit nicht endendem Gedröhn zerschnitten. Sie kamen jetzt jeden Tag. Mama und Toni waren bekümmerter als je. Die Luftangriffe, von denen ich geglaubt hatte, sie gehörten nur zu den Städten, trafen nun auch uns. Immer häufiger füllten die Luftschutzsirenen mit ihrem schrillen Heulen die Nacht. Mama bestand darauf, dass wir in unseren Kleidern schliefen. Wenn dann die Sirenen loslegten, mussten wir mitten in der Nacht aufstehen und mit den anderen Hausbewohnern in den Keller gehen, wo es seltene Süßigkeiten gab und Salzgebäck, das ich vorher noch nie gekostet hatte. Obwohl ich die nächtlichen Stunden im Luftschutzkeller sehr lustig fand, begann ich zu begreifen, was das bedeutete: KRIEG. Da ich eine Welt ohne Flugzeuge nicht kannte war es schwer, mir ein Leben ohne KRIEG vorzustellen. Das Wort FRIEDEN kannte ich schon, aber es blieb mir ein Fremdwort. Aber jetzt ahnte ich, dass die Flieger, und unser verbranntes Haus in Kassel, und die nächtlichen Exkursionen in den Keller etwas mit dem KRIEG zu tun hatten und dass er gefährlich war. Wie sehr gefährlich er war, sollte ich bald darauf noch selber erfahren.
Denn jetzt gab es auch Flieger, die ganz niedrig fliegen konnten und die auf der Straße Fahrzeuge und auch Menschen beschossen. Als ich eines Tages alleine eine menschenleere Straße entlangging, um Mama von ihrer Schule abzuholen, kreiste plötzlich ein solcher Tiefflieger über meinem Kopf. Und weit und breit keine Wurzelhöhle, in der ich mich verstecken konnte. Ich war zu Tode erschrocken, öffnete das nächstgelegene Gartentor und kroch in dem fremden Garten unter einen Busch. Noch nie war ich in den Garten eines fremden Hauses eingedrungen und noch nie hatte ich mich, wie jetzt, in einem fremden Garten unter so komisch stechende Zweige gequetscht. Das Flugzeug hatte mich sicher gesehen und würde nun auf mich schießen.
Das Flugzeug kreiste eine ganze Weile über mir, als überlege es, ob es sich lohnte mich zu erschießen. Dann spritzte es eine lange Reihe walnussgroßer Löcher in das Straßenpflaster vor dem Gartentor und machte sich davon.
Von dem Tag an wusste ich was KRIEG war und hasste ihn. Der Hass wurde noch größer, als zwei Wochen später Mama und Leonies Mutter einen Großteil der Lebensmittel, die sie gehortet hatten, in zwei große Waschkörbe packten und diese zusammen mit ihren insgesamt vier Kindern in das Haus von Frau Wagner verfrachteten, die meine Mutter von irgendwoher kannte und die mit ihrem Sohn am westlichen Abhang des Tals wohnte. Wir Kinder durften jetzt das Haus nicht verlassen, denn draußen strich die Schießerei fast den ganzen Tag lang über unsere Köpfe hinweg. Auf der Höhe hinter uns, auf dem Nagelsberg, saßen die Amerikaner mit schweren Geschützen und offenbar mit sehr viel Munition. An dem Abhang auf der gegenüberliegenden Seite des Tals kam immer wieder Feuer und Rauch aus dem Wald. Mama sagte uns, dass sich deutsche Truppen dort verschanzt hätten.
Wenn das Schießen um die Mittagszeit zum Stillstand kam, ließ Mama uns einen Moment in den Garten gehen. Mit einem Feldstecher konnten wir die amerikanischen Kampfkanonen sehen, die aus den Häusern weit oberhalb unseres Hauses in die Luft starrten.
Nach etwa einer Woche waren die mitgebrachten Lebensmittel aufgebraucht. Mama und Leonis Mutter mussten einen neuen Korb holen. Im Keller des Schlosses hatten sie noch Reserven. Der Weg zum Schloss führte durch das Kochertal über den Fluss. Von dort war es bis zum hinteren Parkeingang des Schlosses nicht sehr weit. Aber unsere Mütter mussten den Fluss überqueren, über den es keine Brücke gab. Nur ein Floß. Alle Brücken im Kochertal waren von den Deutschen gesprengt worden, um dem Feind den Übertritt über den Fluss zu verwehren. Als Mama und Leonies Mutter mit ihrem gefüllten Korb vom Schloss zurückkamen, hatte jemand das Floß auf die andere Seite des Flusses gezogen. Tiefflieger waren unterwegs. Ganz offensichtlich hatten sie die beiden Frauen schon ausgemacht und schossen auf sie. Dann ließen sie etwas fallen, was als lilafarbener Nebel wie eine Giftwolke den Berg hinunterrollte und die Badehütten umhüllte, unter denen sich – mein Bruder Peter hatte das mit dem Feldstecher beobachtet –, unsere Mütter versteckt hatten. Meine Seele schoss zum Fluss hinunter, kroch in die violette Wolke und versuchte, meine Mutter herauszuziehen. Aber wenn mir das gelingen würde, würden die Tiefflieger Mama sehen und totschießen. Ich schlug die Arme um den Körper und ging in den Keller, unseren Aufenthaltsort während des Tages. Ich setzte mich auf meinen Platz und begann wie in Trance mein Nachtgebet zu beten: »Lieber Herr Jesus, segne unseren Führer und mache, dass Deutschland den Krieg gewinnt. Bitte bring uns den Frieden und lass Vati gesund nach Hause kommen.«, das einzige Gebet, das ich kannte. Die anderen Kinder folgten und so saßen wir dann alle Fünf in dem dunklen Raum und wiederholten wieder und wieder die wenigen Gebete, die wir kannten.
Meine und Leonis Mutter kamen wohlbehalten zurück und nach ein paar Tagen konnten wir heim ins Schloss. Das Schießen hatte aufgehört und ich durfte wieder nach draußen gehen. Ich spazierte durch die Stadt, um mit eigenen Augen zu sehen, was die Bomben und die Gewehre angerichtet hatten. Schamlos präsentierte das Haus einer Mitschülerin sein Innenleben: zerbrochene Tische und Stühle, Schränke und Kommoden und überall Federn, die aus zerrissenen Daunendecken über kaputte Bettgestelle flogen. Und Bilder, die schief an der Wand hingen. Die Bäckerei war in der Mitte gespalten: zwei Häuser jetzt, die auseinanderklafften. Andere waren in Berge von Backsteinen verwandelt aus denen Teile von Möbeln herausragten wie abgetrennte Arme und Beine von Menschen, die lebendig begraben worden waren. Als ich auf die Hauptstraße kam, sah ich vor der Apotheke, die kein Dach mehr hatte Herrn Dr. Schütz auf mich zukommen. Es gab keine Möglichkeit ihm auszuweichen. So marschierte ich weiter, auf Beinen, die sich wie steife Stöcke anfühlten. Als ich Dr. Schütz fast erreicht hatte, flog mein rechter Arm nach oben, die Hand weit nach vorne gestreckt. Den anderen Arm hielt ich fest gegen meine Seite gedrückt:
»Heil Hitler, Herr Dr. Schütz!«
presste ich mit kräftiger Kinderstimme hervor. Aber dann machte Dr. Schütz, der mich noch niemals zuvor angesprochen hatte, etwas ganz Außergewöhnliches: Er trat ein paar Schritte nach vorn, beugte sich zu mir herab, ergriff meinen ausgestreckten Arm und führte ihn sanft nach unten:
»Wir grüßen jetzt nicht mehr so, Bärbelchen«,
sagte er,
»warum sagst du nicht einfach „Grüß Gott, Herr Dr. Schütz?“«.
Damit ging er weiter. Wie vom Donner gerührt blieb ich auf der Straße zurück. Nach einer Weile löste sich der Kampf in meinen Muskeln, ich schlug beide Hände vors Gesicht. Ich hatte verstanden. Der Krieg war zu Ende.
Herrn Dr. Schütz begegnete ich ein paar Jahre später wieder. Als Direktor des renommierten Stuttgarter Dillmanngymnasiums, das mein Bruder Jochen besuchte.
Nachdem wir beim Eintreffen der Amerikaner aus dem Schloss, welches sich die „Amis“ als Hauptquartier erwählt hatten, rausgeschmissen worden waren, landeten wir zunächst in einer winzigen Dachkammer in einem uralten Gasthaus in der Schnurgasse. Unser Zuhause, ein winziges Kämmerchen für vier Personen, war dunkel und eng, lag aber mitten in der Stadt, dicht neben dem Rathaus. Nach nur wenigen Wochen konnten wir jedoch in zwei Zimmer plus einer Dachkammer in die KonsulÜbele-Straße umziehen. Küche und Bad teilten wir uns mit der Hauptmieterin. Mein älterer Bruder Peter und ich mussten in der Dachkammer schlafen, in der es im Sommer brütend heiß wurde. Was uns veranlasste, nachts durch die Dachluke auf das schräge Dach zu klettern, wo mich mein Bruder anhand irgendwelcher getrockneter Blätter in die Kunst des Rauchens einführte. Auf dem Dach genossen wir ungeahnte Freiheit, fühlten uns als Herren der Welt und außerhalb jeglichen elterlichen Zugriffs. Dachten wir! Wir hatten nicht bemerkt, dass im Haus schräg gegenüber eine Frau im Rollstuhl Tag für Tag, und auch abends solange es hell war, am Fenster saß und alles beobachtete, was ihre Augen erreichen konnten. Normalerweise guckte sie auf die Straße, aber eines Abends richtete sich ihr Blick nach oben. Sie sah zwei Kinder auf einem abschüssigen Dach sitzen und bekam einen Schreikrampf. Von da an war die Dachkammer nur noch heiß und stickig, kein Fenster mehr zur Freiheit.
Die Zeit in der Konsul-Übele-Straße war auch die Zeit, in der amerikanische Soldaten in offenen LKWs durch die Straßen fuhren und den Kindern, die den Autos hinterherliefen, Kaugummis und Schokolade zuwarfen. Ein Schwarm von Kindern pflegte einem solchen Lastwagen zu folgen und manche Kinder kletterten sogar auf die Ladefläche hinauf. Ich wandte mich ab. Ich fand es abstoßend und unwürdig, dass man sich wegen ein paar Süßigkeiten vor dem „Feind“ erniedrigte. Denn Feinde waren sie doch noch immer, die amerikanischen Soldaten, oder?!
In der Konsul-Übele-Straße wohnten wir nur einen Sommer. Dann fand Mutter die Wohnung im Hause von Frau Kurtz in der Alten Amrichshäuserstraße 17, wo ich den Rest meiner Kindheit verbrachte. Die Konsul-Übele-Straße blieb mir vor allem wegen der Ausflüge aufs Dach in Erinnerung. Sie war aber auch deshalb bemerkenswert, weil ich dort meine ersten eigenen Schuhe bekam. Keine, die mein Bruder Peter schon getragen hatte, sondern ein Paar ganz neue, aus Autoreifen geschnittene Sandalen, die mit dicken Schnüren zum Festbinden versehen waren. Und ich hatte dort, obwohl noch keine 10 Jahre alt, meinen ersten Anfall von Weiblichkeitswahn. Ich schob mir zwei mit Stoffresten gefüllte kugelrunde Netze, die Art Ball, mit dem wir Kinder damals spielten, unter mein enges Sommerhemd und flanierte mit falschem Busen und stolz erhobenem Kopf die ziemlich lange Konsul-Übele-Straße hinunter. Bis mir, just in dem Moment, als mir ein Junge, den ich kannte, entgegenkam, einer der Bälle aus dem Hemd rutschte und zu Boden fiel.
5. Alte Amrichshäuser Straße 17
Erst in der Alten Amrichshäuser Straße 17, im Haus von Frau Kurtz, fand ich mein endgültiges Zuhause. Das alte Haus mit dem Holzbalkon zur Straßenseite gehörte zu den wenigen Häusern, die in den zwanziger Jahren auf der Westseite des Flusses weit außerhalb des Stadtkerns gebaut worden waren, die aber jetzt, nachdem sich das Städtchen in alle vier Himmelsrichtungen, das Tal hinauf und hinunter, und weit auf die umliegenden Anhöhen hinauf ausgedehnt hatte, zum alten Stadtteil Künzelsaus gehörten. Frau Kurtz war eine alte Dame ohne Familie. Das Haus mit dem großen Gemüsegarten vor und dem Obstgarten hinter dem Haus war ihr ein und alles. Es war in Hanglage gebaut und bestand demzufolge auf der Vorderseite aus drei, auf der Obstgartenseite nach hinten hinaus aus nur zwei Etagen.
Alte Amrichshäuser Straße 17.
Obwohl als Einfamilienhaus erbaut, hatten jetzt, kurz nach Kriegsende, insgesamt 5 Partien im Haus von Frau Kurtz Unterkunft gefunden. Zwei Familien mit Kindern, ein Ehepaar und zwei alleinstehende ältere Damen. Eine pensionierte Bibliothekarin und Frau Kurtz selbst bewohnten im ersten Stock, der Bel Etage, die zwei vorderen Zimmer mit Balkon. Im Zimmer daneben, das nach hinten hinausging und neben einem altmodischen Bad mit Holzofenboiler und einer Küche mit Kohleherd lag, wohnte ein aus Schlesien vertriebenes Ehepaar, Herr und Frau Ascherl, die noch immer auf der Suche nach ihrem einzigen Sohn waren, der in den letzten Kriegsmonaten an die Ostfront eingezogen worden war, und von dem die Eltern seither nichts gehört hatten.
Meine Familie bewohnte im Oberstock eine Küche und dreieinhalb Zimmer: Mutters Arbeits- und Schlafzimmer, ein Wohn- und Esszimmer, ein Schlafzimmer für die Kinder und ein kleines Zimmerchen, in das gerade mal ein Bett für Rosel, die „gute Seele“ unserer Familie, und ein schmaler Schrank für ihre Kleider passten. Waschen musste man sich in der Küche. Mit Rosel waren wir fünf. Meine Mutter, mein Bruder Peter, mein Bruder Jochen, Rosel und ich. Und auch später, als mein älterer Bruder für die gymnasiale Oberstufe in die Klosterschulen des württembergischen Landexamens nach Maulbronn und Blaubeuren ins Internat geschickt wurde, waren wir wieder fünf. Nachdem ein Bett im Kinderzimmer frei wurde, kam Poldi zu uns. Meine Mutter hatte ihn, der in die erste Klasse der Oberschule ging, als Pflegekind aufgenommen.
Poldis Mutter war 1946 mit einem amerikanischen Offizier nach USA entwichen. Möglicherweise in der Annahme, dass ihr Mann, Poldis Vater, nicht mehr vom Krieg zurückkommen würde. Doch Poldis Vater kam zurück. Fast zwei Jahre später und nachdem er lange nach seiner Frau und seinen beiden Söhnen gesucht hatte. Er fand Poldi und seinen Bruder Eberhard schließlich in Hohenlohe, in einem kleinen Dorf nahe Dörrenzimmern, in der Obhut seiner Eltern. Tief getroffen vom Verrat seiner Frau kehrte der Vater auf der Suche nach einem beruflichen Neuanfang in seine Heimatstadt Dresden zurück, obwohl ihn alle Freunde und vor allem seine Eltern dringend davor gewarnt hatten, sich in das Herrschaftsgebiet der Sowjets zu begeben. Ich habe nie erfahren, was Poldis Vater im Krieg und unter der Naziherrschaft gemacht hatte – ich weiß nur, dass man, nachdem er in Dresden angekommen war, nie wieder von ihm gehört hat und dass alle Versuche, ihn zu finden, umsonst blieben. Seine Kinder lebten bei den Großeltern, und da es in ihrem Dorf keine weiterführende Schule gab, suchten und fanden sie in Künzelsau Pflegefamilien, in denen ihre beiden Enkel während der Schulzeit unterkommen konnten. Eine dieser Familien waren wir. Ich mochte Poldi sehr. Ein weiterer kleiner Bruder, der so anhänglich, so liebebedürftig und selbst so liebevoll war – das war ein großes Geschenk.
Und dann gab es natürlich Rosel. Rosel, ein Flüchtlingsmädchen aus Schlesien, war erst siebzehn Jahre alt, als sie zu uns kam. Sie blieb bis zu ihrem dreißigsten Lebensjahr in unserer Familie. Damals, als Rosel noch neu bei uns war, hatte sie einen Freund, den sie, wie sie mir einmal gestand, sehr liebte. Aber sie wollte so jung noch nicht heiraten. Sie musste sich doch erst eine Aussteuer zusammensparen. Der Freund wollte aber nicht warten, verließ Künzelsau und heiratete eine andere. Trotz einer ganzen Anzahl von Verehrern, die heftig um Rosel warben, konnte sie sich für keinen anderen Mann entscheiden. Und dann, nach über zehn Jahren, hielt eines Abends ein Motorrad vor der Alten Amrichshäuser Straße Nr. 17. Rosels Jugendliebe! Seine Ehe war gescheitert, ob Rosel ihm verzeihen könne. Sie konnte und zog mit ihm nach Norden. Für mich war Rosel eine warme Freundin und Trösterin gewesen. Sie blieb mir und meiner Familie bis zu ihrem Tod im Jahre 2004 eng verbunden. Für die Mutter war Rosel eine unersetzliche Hilfe. Sie brachte der „Frau Doktor“, wie Rosel meine Mutter nannte, grenzenlosen Respekt entgegen. Obwohl meine Mutter doch gar keinen Doktortitel besaß. Den Titel hatte sie, wie das zu ihrer Zeit üblich war, mit meinem Vater geheiratet.
Mit Hilfe von Rosels landwirtschaftlichen Kenntnissen wurde unser Speisezettel bald kostengünstig angereichert. Frau Kurtz hatte uns im vorderen Garten fast die Hälfte der Nutzbeete überlassen. Auf denen nun Tomaten und Salat, Kohlrabi, Bohnen und Erdbeeren angepflanzt wurden. Und auf dem schmalen, links neben dem Haus gelegenen Rasenstreifen durften wir Hühner halten. Aus alten Brettern und Holzresten zimmerte mein Bruder mithilfe von Herrn Wüster, der im Souterrain wohnte, einen Hühnerstall und umgab ein etwa fünf mal sechs m² großes Rasenstück mit einem Zaun aus Maschendraht, damites den Hühnern – zwei weißen Leghornhennen, drei schwarzen Blesshühnern und einem bunten Gockelhahn – als Auslauf dienen konnte. Im unteren Teil des Obstgartens, der hinter dem Haus bis zur Neuen Amrichshäuser Straße anstieg, konnten meine Brüder und ich Hasen halten. Jedes der Kinder hatte einen eigenen Stall mit ein oder zwei Stallhasen – Deutsche Silber, Blaue Wiener oder Angorakaninchen –, für die wir jeweils allein zuständig waren. Wir mussten die Kaninchen füttern, den Stall ausmisten und, wenn es Junge gab, für besondere Streu und besondere Nahrung sorgen. Wenn es ans Schlachten ging, was unausweichlich anstand, gab es vor allem bei mir tränenreichen Protest.
Aber meine Mutter hatte noch weitere, sehr nützliche Ressourcen für uns erschlossen. An jedem Samstag gingen sie, mein älterer Bruder Peter und später auch ich selbst in eines der umliegenden Dörfer, um dort bei den Bauern Butter und Milch und Mehl zu kaufen. Trotz der nicht ganz unbedeutenden Ernte an Gemüsen und Obst, die wir aus unserem Garten bezogen, reichte das, was man in der Stadt im Laden kaufen konnte, nicht aus, um uns alle – Mutter, Rosel, die beiden Brüder, und mich – satt zu kriegen. Und Mutter kannte die meisten Bauern aus den Dörfern der Umgebung. Sie waren alle bei ihr im Kurs gewesen. Als es nach dem Ende des Krieges in der Schule keinen Unterricht mehr gab und Mutter keine Stelle und daher auch kein Einkommen mehr hatte, bot sie Englischkurse für Erwachsene an. Allabendlich um sechs Uhr in den Räumen des Kindergartens. Alle Leute, auch die Bauern, wollten damals Englisch lernen. Vor allem die Bauern. Da jetzt die Amerikaner die Herren im Land waren, wollten sie deren Sprache wenigstens so weit beherrschen, dass sie mit ihnen reden und verhandeln konnten. Mutters Kurse waren immer überfüllt und die Bauern bezahlten mit Milch und Eiern und Mehl. Manchmal auch mit einem Schinken oder mit Würsten, wenn geschlachtet worden war. Im zweiten Jahr nach dem Krieg, ließ dann allerdings der Andrang nach. Die Bauern hatten die Angst vor den fremden Eroberern verloren; es schien nicht mehr so wichtig, deren Sprache zu können. Aber unsere Mutter behielten sie in dankbarer Erinnerung. Wir durften jederzeit kommen und uns mit den in der Stadt noch immer raren Lebensmitteln versorgen.
Familie Wüster wohnte im Souterrain. Das Souterrain hatte einen eigenen Zugang auf der rechten Seite des Hauses und bestand aus mehreren Kellerräumen, einer großen Waschküche und einem geräumigen Wohnzimmer mit Erkerfenstern zum vorderen Garten hin. Dort war das Ehepaar Wüster mit dem achtjährigen Pflegesohn Horst einquartiert worden. Auch die Wüsters waren Flüchtlinge und hatten, wie ich später erfuhr, im Krieg zwei Söhne verloren. Der kleine Horst war ihnen zugelaufen. Sie hatten ihn im Flüchtlingstreck ohne Eltern oder sonstige Begleitperson aufgefunden und sich seiner angenommen, obwohl das Kind offensichtlich schwer gestört war. „Horstle“, wie der Bub von allen genannt wurde, war extrem scheu, stotterte, wenn er mit jemandem reden musste, und war hoch aggressiv. Er duckte sich hinter die Gartenhecke und bewarf vorüberkommende Kinder, aber auch Erwachsene, mit Dreck. Er beschimpfte meine Brüder und andere Jungen aus einem sicheren Versteck heraus mit den schlimmsten Schimpfwörtern, und wenn er eine Katze erwischte, ging es dieser schlecht. Wenn Peter oder Jochen Horstle zu fassen kriegten – was ihnen allerdings nur selten gelang –, hatte der nichts zu lachen. Es setzte Ohrfeigen und manchmal schlimme Prügel. Was Horstle dazu veranlasste, sie noch kräftiger zu beschimpfen und sie – wann immer sich eine Gelegenheit dazu bot – mit allem erdenklichen Abfall zu bewerfen. Wodurch sich meine Brüder wiederum zu noch strengeren Strafaktionen genötigt sahen.
Nur mir gegenüber war Horstle zahm. Ich war die einzige, die ihn nicht verhöhnte, ihn nicht wegen seiner groben Sprache beschimpfte, und die ihn nicht schlug. Ich hatte Mitleid mit Horstle. Dieser kleine Junge war immer allein. Er hatte keine Geschwister, seine Pflegeeltern waren schon fast im Großelternalter und in der Schule erging es ihm genauso wie bei uns auf der Straße. Kein Kind wollte etwas mit ihm zu tun haben. Ich nahm mir Zeit, um mit Horstle zu sprechen. Ich fragte ihn nach seinen Eltern, nach der Schule, versuchte ihm zu erklären, warum er den Tieren nicht weh tun dürfe und erzählte ihm Geschichten, die er nicht kannte. Horstle schien mich zu mögen; jedenfalls suchte er meine Nähe. Und ich verteidigte ihn gegen die Brüder.
Obwohl Frau Kurtzens Haus dreigeschossig war und seinen damals zwölf Bewohnern gut Platz bot, besaß das Haus nur eine Toilette. Ein Plumpsklo auf der mittleren Treppe zwischen dem ersten und dem zweiten Stock. Das Klo bot Anlass zu mancherlei Reibereien und Auseinandersetzungen zwischen den Hausbewohnern und vor allem zwischen der Hausbesitzerin und unserer Mutter. Abgesehen davon, dass man häufig – auch wenn es dringlich war – lange anstehen musste, wurden die Reinlichkeitsstandards, die Frau Kurtz verordnet hatte, nicht immer eingehalten. Vor allem von den drei Kindern aus dem Oberstock. Was meiner Mutter regelmäßig schwere Vorwürfe einbrachte. Unsere Mutter hatte sich daher angewöhnt, wenn sie von der Schule nachhause kam, als erstes das Plumpsklo zu inspizieren.
Und dann passierte es.
Von einer alten Dame, einer Nachbarin, der sie als junges Mädchen mit kleinen Dienstleistungen behilflich gewesen war, hatte meine Mutter eine wunderschöne Kamee geerbt. Eine aus einer Muschel geschnitzte Mondgöttin, die in Gold gefasst und als Brosche gearbeitet war. Meine Mutter trug sie fast täglich. Als Verschluss ihrer Bluse direkt am Hals. Ohne die Kamee war die Mutter nicht zu denken. Sie gehörte zu ihr wie die Joppe zum Jäger.
Als meine Mutter an diesem speziellen Tag nachhause kam und das Klo inspizierte, trug sie nicht nur, wie üblich, die Brosche an der Bluse, sie fand auch hinreichenden Grund, sich mit der Bürste in der einen Hand und dem Wasserkrug in der anderen über das offene Klobecken zu beugen. Mit dem Säubern kam sie allerdings nicht sehr weit. Ein Entsetzensschrei entfuhr ihrem Mund, ihre Hände flogen zum Hals. An die Stelle, an der die Kamee ihren Stammplatz hatte. Aber sie wusste ja schon, dass es zu spät war. Sie hatte die mattweiße Schönheit nach unten stürzen sehen und den dumpfen Ton gehört, als ihre Lieblingsbrosche in dem stinkenden Grab aufschlug.
Meine Mutter stürmte hinaus, alarmierte uns Kinder und es dauerte nicht lange, da waren alle Mitbewohner, und natürlich auch Frau Kurtz, voller Schrecken und Trauer am Ort des Geschehens versammelt. Die Hausbesitzerin erkannte sofort ihre Chance. Denn die versammelte Hausgemeinschaft war sich darin einig, dass man die göttliche Dame nicht einem so trostlosen Grab überlassen dürfe. Sie musste gerettet werden. Und die kluge Alte wusste auch sofort wie. Die Güllegrube, die üblicherweise gegen eine stattliche Summe von der Stadtreinigung entleert wurde und die zum Zeitpunkt des Sturzes der Schönen schon wieder fast voll war, musste geleert werden! Eimer für Eimer müsste schön gleichmäßig auf ihrem Grundstück verteilt, die Bäume, jeder einzelne, ausreichend gedüngt werden. Und beim Ausgießen könnte man dann sorgfältig untersuchen, ob sich das verlorene Schmuckstück unter den Exkrementen befand. Also wurden alle verfügbaren Eimer zusammengetragen, die Hausbewohner bildeten eine Kette von der Grube bis zum jeweiligen Baum, den die Hausbesitzerin, die das Kommando für die Aktion übernommen hatte, angab. Herr Wüster, am Anfang der Kette, füllte die Eimer, Frau Ascherl kippte sie aus und durchsuchte das Entleerte mit einem abgeflachten Holzlöffel. Genauestens. Zentimeter für Zentimeter inspirierte sie jeden Grashalm des frisch gedüngten Rasens.
Zwei Stunden arbeitete die Menschenkette aus Mitbewohnern rastlos und ohne Pause. Gespannt wie Goldsucher beim Schürfen, und ohne den Gestank, der sie umgab, wahrzunehmen. Und zwei Stunden lang stocherte Frau Ascherl auf der Suche nach der Göttlichen mit Akribie und scharfen Augen in der ausgekippten Scheiße. Bis die Grube leer, aber die Broschendame noch immer nicht aufgetaucht war. Entgeistert standen 12 Menschen um die leere Grube und starrten ratlos nach unten. Bis die beiden Knaben aus dem Oberstock befanden, dass jetzt einer in die Grube steigen müsse – einer, der nicht sehr füllig und nicht hochgewachsen sein dürfe, der klein und wendig genug sei, um sich in der Grube frei zu bewegen – ein Kind also! Das dann den Boden stochernd absuchen und die Dame finden müsse. Die Erwachsenen protestierten: Das sei gefährlich! In der Grube gäbe es giftige Gase. Nein, das gehe nicht! Aber die Buben gaben nicht nach. Das Goldfieber hatte sie erfasst. Beide wollten sie nach unten. Sowohl Jochen als auch Poldi bestanden darauf, dass sie der Verursacher des Unglücks gewesen seien und deswegen den Abstieg in die Hölle wagen müssten. Sodass schlussendlich gelost wurde. Poldi, der Pflegesohn, gewann. Zur Sicherheit wurde er angeseilt und mit einem großen Suppenlöffel bewaffnet in die Grube hinuntergelassen. Nach einer gefühlten Unendlichkeit fand Poldi das Schmuckstück. Unter dem Jubel der Hausgemeinschaft, die, was dringend nötig war, danach – von einem penetranten Geruch begleitet – quer durch die ganze Stadt in die öffentliche Badeanstalt marschierte.
Künzelsau bot uns Kindern eine prächtige Spielumgebung. Im Garten, in den Gärten der Nachbarn, in den Wiesen, die am Ende unsere Straße begannen, konnten wir spielen und rennen, uns verstecken, und, da es auf der Straße keine Autos gab – jedenfalls fast keine –, war auch die Straße unser Spielplatz und wurde durch Kreide mit allerlei Mustern und Spielplänen verziert. Aber auch die Stadt selbst und die überbauten Gässchen, die der Stadtmauer entlang unter den Häusern hindurchführten, gaben exzellente Schauplätze für Versteckspiele, für „Räuber und Gendarm“, oder auch für einsame Erkundungstouren. Künzelsau war das Traumland meiner Kindheit, die endete, als ich gezwungen wurde, mein Städtchen zu verlassen. Aber das war später. Noch spielten sich wichtige und zum Teil dramatische Entwicklungen in meinem geliebten Kochertal ab.
6. Die Schule
Die Schule in Künzelsau war ganz anders als die Schule in Tübingen. Vor allem war sie voller Überraschungen für mich. Daran, wie ich nach der Umzugspause in die erste Klasse eingeführt wurde, habe ich keine Erinnerung. Kein Lehrer, kein Schüler, kein Gesicht. Kein Vorfall, der in meinem Gedächtnis hängen geblieben wäre. Dafür anderes. Zum Beispiel, dass ich nach nur wenigen Wochen in die zweite Klasse versetzt wurde, da ich, die doch keine Tafel mit sauberen Schriftzeichen füllen konnte, den Kindern der ersten Klasse in Künzelsau angeblich weit voraus war.
Aus der zweiten Klasse, die ich dann ebenfalls nur kurze Zeit besuchte, erinnere ich mich jedoch an einen mich sehr verwirrenden Vorfall.
Die Schule, ein noch relativ junger Neubau, lag weit außerhalb der Stadt, am Rande eines Neubaugebietes. Neben der Schule war, ebenfalls neu, die Stadthalle gebaut worden als Ort, an dem Vorträge, Theateraufführungen, Konzerte und diverse andere Veranstaltungen stattfinden konnten. Zum Ende meines ersten Schuljahres, in dem ich also schon in der 2. Klasse saß, wurde dort die Abschlussfeier für die Untersekunda, nach heutiger Zählung die zehnte Klasse der Oberschule, gefeiert. Da die Oberschule in Künzelsau nur bis zur mittleren Reife führte, mussten die Schüler die Schule nach der Untersekunda entweder ganz verlassen, oder als Fahrschüler nach Schwäbisch Hall fahren, wo sie in der dortigen Oberschule Abitur machen konnten.
Meine Mutter, die ja inzwischen wieder Lehrerin an der Oberschule war, hatte mir erzählt, dass die Abschlussfeier in der Stadthalle stattfinden würde und mich neugierig gemacht. Was machten sie bei so einer Feier? Wie sieht so ein Fest aus? Würde ich meine Mutter sehen? Das war eine allzu große Verlockung, und als ich mich zum Zeitpunkt der Veranstaltung aus der Schule raus und in den Festsaal der Stadthalle hineingeschmuggelt hatte – der Lehrerin hatte ich gesagt, ich müsse aufs Klo – war der lange viereckige Saal vor mir bis auf eine letzte leere Stuhlreihe angefüllt mit Menschen. An seinem von mir entfernten Ende bewegten sich Kinder auf einer höher gelegenen Bühne, führten kleine Stücke auf, reklamierten Gedichte, und sangen dann gemeinsam »Wer ha die Käse zum Bahnhof gerollt?« Der ganze Saal lachte. Mir wurde etwas mulmig zumute, denn meine Mutter, Frau Schweizer, das wusste ich, wurde von den Schülern „die Käse“ genannt. Aber ich wusste nicht genau, ob diese Vorführung als Huldigung oder als Verspottung meiner Mutter gedacht war.
In der letzten Reihe konnte ich mich hinstellen und das Geschehen vorne verfolgen. Aber die Feier war bald zu Ende. Wie auf Kommando erhoben sich plötzlich die Menschen im Saale, streckten den rechten Arm in die Höhe und sangen ein Lied, das ich zwar schon sehr oft gehört hatte, dessen Text ich aber nicht kannte: »Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!«. Wie elektrisiert riss es auch mich vom Stuhl. Ich stand kerzengerade und mein rechter Arm flog in die Luft. Ich sang mit. Die Worte kannte ich zwar nicht, aber die Melodie: „la-la-la-la- la-la lalala…..“ . Und dann überflutete mich inmitten der brüllenden, die Hände hochreckenden Menschen ein heißer Wirbel: Stärke, Stolz, ein gewaltiges Gefühl der Verbundenheit strömte durch meine Brust, ließ mich straffer und größer werden und im Bewusstsein einer neuen Kraft sehr aufrecht in mein Klassenzimmer zurückgehen.
Doch das mich so angenehm erhebende Gemeinschaftsgefühl hatte ein ernüchterndes Nachspiel. Nach der Schule, auf dem Weg nach Hause, der sehr weit war und den ich immer noch alleine gehen musste, da ich neue Freundinnen noch nicht gefunden hatte, kam mir plötzlich ein sehr beunruhigender Gedanke: stolz darauf zu sein, eine Deutsche zu sein, mich groß und stark fühlen, weil ich in Deutschland geboren bin?! Das war doch völlig sinnlos. Wie kann man denn auf etwas stolz sein, an dem man in keiner Weise selber beteiligt, das ein reiner Zufall war. Genauso gut hätte ich irgendwo in Afrika geboren werden können, dachte ich. Zwar wusste ich nicht, wo Afrika lag, nur dass es sehr weit weg war und dass die Leute mir manchmal hinterher sangen: »Barbara, Barbara, Komm mit mir nach Afrika«. Mein Hochgefühl sackte in sich zusammen. Es gab gar keinen Grund stolz zu sein auf etwas so Zufälliges wie meine Geburt in Kassel.
Meine Schulkarriere in Künzelsau war, wie gesagt, durchaus ungewöhnlich. Nach ein paar Monaten in Klasse eins war ich etwa ein halbes Jahr später in Klasse zwei gekommen und, ebenfalls nach nur einem halben Jahr, in Klasse drei. Dann wurde wegen Kriegsende und Systemwechsel jedweder Schulunterricht eingestellt. Auch Klasse drei dauerte daher nur knappe sechs Monate und Klasse vier, die begann, nachdem sich das Leben in dem total geschlagenen Deutschland wieder einigermaßen normalisiert hatte, auch nur wenig länger. In Klasse drei kam ich mir vor wie ein armseliges Aschenputtel. Ich war die „Neue“ in der Klasse, meine Rechtschreibung war so miserabel, dass in meinem Diktatheft, das ich vergeblich vor meiner Mutter zu verstecken suchte, mehr rote als blaue Tinte zu sehen war. Außerdem wurde Klasse drei von der Tochter des Ortsgruppenleiters der NSDAP unterrichtet, einer blonden Nazischönheit, die von den Mädchen der Klasse wie eine Bienenkönigin von ihren Bienen umschwärmt wurde. Irgendwie konnte ich da nicht mithalten. Und dann passierte das Unglaubliche!! Zu Weihnachten sollte die Klasse den Eltern ein Stück vorspielen, und da ein Krippenspiel aus politischen Gründen nicht infrage kam, entschied sich die Lehrerin für „Schneewittchen“. Ich dachte gar nicht daran, mitspielen zu dürfen. Ich war die letzte Hinterbänklerin der Klasse, die Außenseiterin, der eindeutige underdog. Und außerdem war ich blond und Schneewittchens Haar war bekanntermaßen schwarz wie Ebenholz. Doch dann – ich verstand die Welt nicht mehr – wurde die blonde Bärbel Schweizer von der Nazilehrerin als Schneewittchen aufgestellt! Erst sehr viel später fand ich eine Erklärung für dieses absurde Casting: ich war das einzige Mädchen in der Klasse, das Hochdeutsch sprechen konnte!
Nach der langen Zwangspause zum Kriegsende ging die Schule für mich in der vierten Klasse weiter.
Klasse 4, mit Herrn Faude als Klassenlehrer, wurde das highlight meiner gesamten Schulzeit. Herr Faude war eigentlich gar kein richtiger Lehrer. An richtigen Lehrern fehlte es gewaltig nach dem Krieg. Daher musste man auf noch jüngere Männer zurückgreifen. Sofern sie alt genug waren und Interesse an Kindern hatten, wurden sie vor oder während ihrer Ausbildung als hauptamtliche Lehrer eingestellt. Herr Faude war jung, sah nett aus und hatte rote Haare. Und er war der beste Lehrer, den ich je erlebt habe. Wenn Herr Faude uns etwas beibringen wollte, sprach er so spannend – während er dabei durch die Bankreihen marschierte –, dass wir Schüler fasziniert an seinen Lippen hingen und ihm auf Schritt und Tritt folgten. Wie die Kinder dem Rattenfänger von Hameln liefen wir ihm durchs ganze Klassenzimmer nach. Ab und an drehte sich Herr Faude um, sah die Schülerschlange hinter seinem Rücken, klatschte in die Hände und forderte uns fröhlich aber entschieden auf, doch wieder unsere Plätze einzunehmen. Sein Unterricht war immer interessant und abwechslungsreich; vor allem aber überließ er uns Kindern einen beachtlichen Part darin. Wir sollten/ mussten/durften in Heimatkunde Vorträge halten, unsere eigenen Geschichten vor der Klasse erzählen oder vorlesen, und bei Mathematik oder Geometrieaufgaben ließ er uns die Lösungen an der Tafel selber finden. Herr Faude praktizierte Methoden, die zu seiner Zeit völlig ungewöhnlich waren, die jedoch später in die Didaktik und Unterrichtslehren eingingen. Und wir liebten ihn dafür. Er wohnte in einer Wohnung im Stadttor am Ende der Schnurgasse. Vor allem wir Mädchen brachten ihm dort immer wieder mal ein Ständchen dar.
Nach einem knappen Jahr in der vierten Klasse bei Herrn Faude wurde ich 1946 nach bestandener Aufnahmeprüfung in die erste Klasse der Oberschule aufgenommen. Diese Aufnahmeprüfung wurde ein richtungsweisendes Erlebnis für mich. In der schriftlichen Deutschprüfung hatte ich einen Aufsatz abgeliefert, dessen Inhalt alle Mitglieder der Prüfungskommission so beeindruckte, dass sie trotz der über 30 Schreibfehler, die ich auf vier Seiten Geschriebenem untergebracht hatte, davon absahen, mich durchfallen zu lassen. Sie bestellten mich zur mündlichen Prüfung ein. Diese mündliche Prüfung würde darüber entscheiden, ob ich zur Oberschule zugelassen würde oder nicht. Und dann geschah in dieser Prüfung etwas auch für mich völlig Unerklärliches. Obwohl ich noch niemals Grammatikunterricht gehabt hatte, wusste ich auf alle Fragen der Kommission eine Antwort. Zwar wusste ich nichts von Haupt- und Nebensätzen, Subjekt, Objekt, Satzgegenstand und Satzaussage, aber Herr Faude hatte mir im Rechenunterricht sehr gründlich selbstständiges Denken und Kombinieren beigebracht. »Warum stehen diese Teile des Satzes zwischen Kommata?« – an diese Frage und an meine Antwort kann ich mich noch heute, als 83- jährige, erinnern. Ich brachte eine perfekte Definition des „Relativsatzes“ zustande und weil ich mich wohl auch sonst bewährte, bestand ich die Prüfung. Die positive Erfahrung mit meiner ersten Prüfung wirkte sich auf alle weiteren Prüfungen aus, die ich in meinem Leben ablegen musste. In Prüfungen schien ich immer mehr zu wissen als ich vorher gewusst hatte; ich hatte nie Angst und habe Prüfungen immer glänzend bestanden.
Die Oberschule in Künzelsau war besonders. Sie war in sehr vieler Hinsicht besonders; für mich schon dadurch, dass meine Mutter an der Oberschule unterrichtete und daher auch meine Lehrerin war. In den unteren Klassen unterrichtete sie Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Englisch und Französisch. Es war ihr also nicht zu entkommen.
In welchem Fach und in welcher Klasse der folgende Vorfall passierte, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es im Musikzimmer im oberen Stock war und dass ich in der ersten Bank in der Fensterreihe saß und danach vor dem Musikzimmer im Flur stand und vor Wut und Empörung kochte. Meine Mutter hatte mich aus der Klasse getrieben. Meine eigene Mutter hatte mich an den Haaren durch das gesamte Klassenzimmer geschleift, von jeder Bank losgezerrt, an der ich versuchte, mich festzuhalten, und bis zur Tür geschleppt. Sie hatte mich auf den Flur gestoßen und mit einem »da bleibst du jetzt!« die Türe mit einem Knall zugezogen. Ich hatte nichts getan! Ich hatte still auf meinem Platz gesessen und hatte der Mutter zugehört, als sich diese plötzlich zu mir umdrehte und mich zur Rede stellte.
Voller Wut über die Ungerechtigkeit meiner Mutter blickte ich auf den auch jetzt vergleichsweise ruhigen Platz und dachte an das Geheimnis, das mir diesen Platz für immer lieb und wert machte. Aber auch das konnte nicht helfen gegen die Wut. Ich hasste meine Mutter. Wie konnte sie mir das antun! Das war ungerecht! Mutter hatte gar nicht hören wollen, was ich zu meiner Verteidigung vorbringen wollte. Und doch war meine Mutter, das wusste ich, unter anderem deswegen bei den Schülern beliebt, weil sie zwar streng, aber meistens sehr gerecht war. Die Schüler hatten ihr den Spitznamen „Sächle“ gegeben, weil sie im Unterschied zu den männlichen Lehrern vergleichsweise „sachlich“ blieb. Die männlichen Lehrer hatten nämlich alle einen Knall. Sie rasteten beim geringsten Anlass aus, und waren oft in hohem Maße ungerecht.
Wie zum Beispiel Herr Dürr, der Musiklehrer, der beim kleinsten Misston, den wir beim Chorsingen produzierten, wie eine Rakete in die Luft ging, sich lauthals über seine Schüler beschwerte – »das ist ja zum Kotzen mit euch!« – und das Fenster an der Schmalseite des Musikraums aufriss. Bis eines Tages unsere kleine, schüchterne Klassenbeste, Trudel Weigert, die niemals frech wurde, die eingetretene Todesstille mit »Jetzt kotzt er!« durchbrach, die ganze Klasse losprustete und in der letzten Stunde nachsitzen musste.
Oder Fräulein Raidt, die wir die „alte Jungfer“ nannten - ihr Verlobter wurde, wie es hieß, gleich in den ersten Kriegstagen getötet - und die außer meiner Mutter die einzige Lehrerin an der Schule war. Fräulein Raidt strafte mit Ironie und Sarkasmus und fixierte ertappte Sünder mit starrem Blick, während sie dabei die linke Augenbraue hochzog. Nur die linke. Alle wussten, dass dies ein Warnzeichen war. Ich brauchte lange, bis es mir durch tägliches Üben vor dem Spiegel gelang, die linke Braue anzuheben ohne die rechte zu bewegen – eine Fähigkeit, die ich noch heute beherrsche – und Fräulein Raidt bei ihrer nächsten visuellen Attacke gleiches mit gleichem vergelten konnte.
Aber die Lehrer waren schlimmer. Alle meine Lehrer waren gesund aus dem Krieg zurückgekommen. Alle hatten noch zwei Arme und zwei Beine und an jeder Hand fünf Finger. Der Krieg hatte sie auf andere Weise verletzt. Auf eine Weise, die nicht zu sehen war. Ich hatte keine Ahnung, wie das passiert sein konnte, aber ich spürte, dass diese Männer, meine Lehrer, abgesehen davon, dass sie Lehrer waren, was allein schon bedenklich schien, auf unerklärliche Weise beschädigt waren. Herr Faude war auch Lehrer. Aber der war ja nicht im Krieg gewesen.
Am schlimmsten war zweifellos der Biologielehrer, Herr Wieser, der auch Biologie und Chemie unterrichtete. Herr Wiesner war dick wie eine Trommel. Wenn er im Schulhaus die Treppe herunterkam, mussten sich entgegenkommende Schüler mit eingezogenem Bauch an die Wand drücken, damit er passieren konnte. Seine beiden Kinder jedoch, die auch in die Oberschule gingen, waren klein und schmächtig und erzielten bei den Untersuchungen für die Zuteilung der Schulspeisung – einer Spende des amerikanischen Expräsidenten Hoover – regelmäßig den höchsten Unterernährungsgrad. Sie waren immer unter denen, die in der großen Pause freie Mahlzeiten bekamen; einen zähflüssigen Schokoladenbrei, oder Maissuppe, oder dicke Bohnen. Als Lehrer war Herr Wiesner unerbittlich. Er unterrichtete nur im Chemiesaal, hatte also den erhöhten Experimentiertisch, der die ganze Breite des Raumes einnahm, zwischen sich und den Schülern, die ihm in sechs ansteigenden, ebenso langen Bänken gegenübersaßen. Herr Wieser saß wie ein Buddha nahezu unbeweglich auf seinem ausladenden Podest. Breit und gewichtig, die Arme abgewinkelt vor sich abgelegt, saß er in der Mitte seines langen Tisches und dozierte. Während der Schulstunde stand er niemals auf. Nie schrieb er etwas an die Tafel. Und Lehrmittel gab es keine. Kein Buch, keine kopierten Seiten, keine Materialien, kein nichts. Aber der dicke Wieser erwartete, dass sich die Schüler jedes seiner Worte merkten. Oder seine Ausführungen in rasendem Tempo mitschrieben. Er verhielt sich wie ein Professor (vielleicht war er das ja gewesen und war degradiert worden) und nahm keinerlei Rücksicht darauf, dass er nicht Studenten, sondern zwölfjährige Schüler und Schülerinnen vor sich hatte. Es war unvermeidlich, dass ich eines Tages mit ihm zusammenstoßen würde.
Wieser hatte als Hausaufgabe von jedem Schüler 50 gepresste Pflanzen mit deutschem und lateinischem Namen, Fundort und Blütezeiten verlangt. Das war viel Arbeit gewesen, aber jeder meiner 30 Mitschüler und alle Mitschülerinnen hatten am Ende der gesetzten Frist 50 Pflanzen abgegeben. Und dann kam die Klassenarbeit. Wieser saß auf seinem Hochsitz und wählte aus den 1500 Blättern, die er vor sich auf dem Tisch gestapelt hatte 30 Blätter aus, die er nacheinander hochhielt. Die Schüler sollten die Pflanze erkennen und benennen. Aufschreiben! Und bitte absolute Ruhe im Raum!
Die Klassenarbeit fiel katastrophal aus. Außer Hildegard Sues, die eine schlechte Schülerin, aber eine begeisterte Gärtnerin war, kassierten meine Mitschüler und Mitschülerinnen wie auch ich nur Vieren, Fünfen und Sechsen. Wie sollten wir auch die Pflanzen kennen, die wir nicht selber gesammelt, getrocknet und identifiziert hatten. Als Herr Wieser in der nächsten Stunde die Klasse zum Sitzen aufforderte, blieb ich stehen. Ich bat Herrn Wieser darum, diese Arbeit nicht fürs Zeugnis gelten zu lassen. Die Schüler hätten keine Chance gehabt. Keiner könne die Pflanzen der anderen kennen. Nur die eigenen. Und das wären fünfzig und nicht mehrere hundert verschiedene Gewächse. Die Klassenarbeit wäre ungerecht und dürfe daher nicht zählen, brachte ich mit ziemlich entschlossener Stimme vor. Aber Herrn Wieser wies mich barsch zurück. Es ginge ja nicht darum, nur die Pflanzen zu kennen, die man zufälligerweise getrocknet und gepresst habe. An Sonntagen, auf Spaziergängen mit den Eltern, bei jeder Gelegenheit müsse jeder Schüler nach unbekannten Pflanzen Ausschau halten und die Eltern fragen, wie sie hießen.
Ich war empört:
»Und wenn die Mutter die Pflanze selber nicht kennt! Was soll man dann machen?«
Die ganze Klasse lachte und Herr Wieser wusste keine Antwort. Er schlug mit seinen fetten Händen auf den Tisch und begann seine nächste Vorlesung.
Der absonderlichste von allen Lehrern war aber Dr. Wagner. Der „Wagges“, wie ihn die Schüler nannten. Herr Wagner war mein Lehrer für Latein und Geschichte. Wenn ich mich für Geschichte zu interessieren begann und das Fach später studierte, so verdankte ich das dem völlig unkonventionellen Unterricht von Herrn Wagner. Der „Wagges“ unterrichtete mit Leidenschaft, mit Fantasie, mit Sinn für Dramatik und mit schier endlosem Wissen. Er hielt sich an keinerlei Lehrpläne. Wenn er von einem Thema ergriffen wurde, dann erzählte er wie besessen und so, als ob er einen ganzen Saal voller Menschen begeistern müsste – mitreißend, spannend und mit vielen interessanten Einzelheiten und Anekdoten. Sein Geschichtsunterricht war wie eine Theatervorstellung. Und man konnte ihn wunderbar ablenken. Leonore Dilgers Eltern hatten eine Anzahl alter Stiche und Kopien von griechischen Statuen aus ihrem zerbombten Antiquitätenladen in Heilbronn gerettet. Als Leonore einmal ein solches Exemplar, eine kleine Kopie des Apolls von Praxitels, in die Schule mitbrachte, geriet der „Wagges“ in Verzückung. Eine ganze Stunde lang erzählte er von Griechenland – obwohl wir gerade bei der römischen Geschichte waren -, von seinen Reisen nach Athen und auf den Peloponnes, wie er den Olymp bestiegen hatte und in Santorin die weißen Stufen zur Kirche, und wie er in Mykene das Grab des Agamemnon und in Kreta den Palast von Knossos und die Zeushöhle im weißen Gebirge besucht hatte. „Wagges“ erzählte ohne Pause, bis die Schulglocke ihn rüde unterbrach.
Ich und meine Klassenkameraden nutzten seine Begeisterungsfähigkeit schamlos aus. Alle Schüler suchten zuhause nach irgendwelchen antiken Erinnerungsstücken, Scherben oder anderen Artefakten. Man brauchte solch ein kleines historisches Asservat nur gut sichtbar zu drapieren, möglichst auf die erste Bank, und der „Wagges“ geriet ins Schwärmen. Und unmerklich wechselte er manchmal die Zeiten. Dann waren es plötzlich nicht mehr römische Söldner, die in Italien kämpften, sondern deutsche Soldaten und Amerikaner und abtrünnige Italiener. Und dabei vergaß der „Wagges“, dass für diesen Tag eine lateinische Vokabelarbeit vorgesehen war.
Herr Wagner war, wie alle meine Lehrer, hochgradig jähzornig. Wenn er einen Schüler oder eine Schülerin beim Abschreiben erwischte, oder wenn er glaubte, ein Schüler lache über ihn – was ja oft vorkam, aber meist gut kaschiert wurde – brüllte er los und verhängte die schlimmsten Strafarbeiten. Mich erwischte es, als ich in einer Schulstunde über die Gracchen in meinem Notizheft kritzelte und mit unbeholfenen Strichen versuchte, den Hinterkopf meines Vordermannes aufs Papier zu bannen. Ich konnte nicht zeichnen. Neben Weitwurf war Zeichnen die Disziplin, für die ich keinerlei Begabung hatte. Der Kopf meines Vordermannes war also kaum erkenntlich, als der „Wagges“ mich ertappte und in dem Gekritzel auf dem Papier eine Karikatur seiner selbst zu entdecken glaubte. Ich konnte noch so heftig versichern, dass das, was ich da zeichnete, nicht der Lehrer, sondern unser Mitschüler Wolfgang, der „Schlauch von hinten“ sei. Herr Wagner war nicht zu erweichen und verordnete Nachsitzen. Und zwar am kommenden Dienstag. Nachmittags.
»Dienstag geht nicht« erwiderte ich, »am Dienstag ist schulfrei; da mache ich eine Radtour mit meiner Freundin«.
Das sei ihm völlig egal, erklärte Herr Wagner und bestand auf Dienstag. Der Einwand, dass ich dann ja nicht nur eine Stunde Nachsitzen, sondern eine viel härtere Strafe bekäme, ließ ihn ungerührt. Auch als ich am nächsten Tag vor dem Lehrerzimmer auf ihn wartete und ihn nochmals inständig um einen anderen Termin für das Nachsitzen bat. Dr. Wagner blieb eisern. Keine Chance.
Das war am Samstag nach der dritten Stunde. Am darauffolgenden Montag stand ich, mit Schulheft, Lateinbuch und Schreibstiften ausgestattet, um 16:00 Uhr nachmittags vor der Haustüre meines Lehrers. Als auf mein Klingeln hin glücklicherweise Herr Wagner persönlich die Türe öffnete, sagt ich mit ruhiger Stimme:
»Melde mich gehorsamst zum Nachsitzen!«
Ob Herr Wagner nur verblüfft war, oder verärgert, oder ob er sich amüsierte, – der Lehrer ließ sich nichts anmerken. Ich meinte nur ein leichtes, nicht unbedingt bedrohliches Zucken seiner Mundwinkel zu bemerken. Er wies mir einen Platz in seiner Laube an, bezeichnete einen Absatz im Buch zur Übersetzung und Bestimmung der Verbformen, und zog sich ins Haus zurück.
Noch immer stand ich am Fenster und dachte daran, wie ich meine Mutter damals in Schutz genommen hatte. Wie ich Herrn Wieser vor dem Lehrerzimmer abgepasst und zur Rede gestellt hatte. Dass er meine Mutter in Ruhe lassen sollte. Dass er, wenn er sich über mich ärgerte, sich bitteschön an mich wenden und nicht meine Mutter vor den Kollegen im Lehrerzimmer beschimpfen solle. Meine Mutter habe nichts damit zu tun.
Warum musste meine Mutter ausgerechnet Lehrerin an dieser Schule sein. Nichts als Ärger hatte man davon! Jeder im Ort kannte einen und wenn man einmal etwas ausgefressen hatte, erfuhr es die Mutter sofort. Andererseits hatten die Leute auch einen gewissen Respekt vor einem. Meine Mutter war ja „Jemand“ in der Stadt. Und die meisten Leute hatten Kinder oder Enkel in der Oberschule und wollten es nicht mit meiner Mutter verderben. Aber manchmal war das nur einfach peinlich. Die Sache mit der „Hexe“ zum Beispiel, unserem Hund. Als der Großvater gestorben war und nur noch die kranke Oma und mein Vater in der Stitzenburgstraße 15 in Stuttgart wohnten, war Hexe, Opas schwarzbrauner Langhaardackel, zu uns nach Künzelsau gebracht worden. Hexe, eine nicht mehr allerjüngste Dackeldame, war nicht nur bei mir und meinen Brüdern, sondern auch bei allen Hundeherren der Umgebung außerordentlich beliebt. Weshalb sie, wenn sie ihre „Tage“ hatte, nicht zuhause im Garten bleiben durfte, während die Familie in der Schule war und nur Rosel zuhause blieb. Rosel war als Hundewächterin nicht geeignet und außerdem viel zu beschäftigt mit Putzen und Kochen und allen anderen Haushaltsdingen. Daher hatte unsere Mutter für diese Notzeiten im Lehrerzimmer ein Körbchen deponiert. Hexe konnte dort, von wechselnden Lehrern bewacht, den Schulvormittag verbringen. Morgens band Mutter die läufige Hündin mit einer langen Leine an ihrem Fahrrad fest und fuhr mit ihr zur Schule. An diesen Tagen waren ich und meine Brüder heilfroh, dass wir den Schulweg nicht mehr gemeinsam mit der Mutter absolvieren mussten. Denn diese Mutter fuhr nun auf ihrem Fahrrad die ganze lange Amrichshäuser Straße hinunter, am Fluss entlang, über die Brücke, und durch die gesamte Altstadt hindurch bis zur Schule – mit Hexe an der Leine und gefolgt von einem langen Zug liebestoller Rüden.
Ich stand immer noch auf dem Flur vor dem Fenster. Ich solle bis zum Ende der Stunde vor der Türe stehen bleiben, hatte Mutter gesagt. Das wäre fast eine dreiviertel Stunde. Und eine halbe Stunde war schon vergangen, seit ich hier draußen stand. Ich hatte keine Uhr, aber die Turmuhr schlug jede viertel Stunde und zweimal hatte sie schon geschlagen. Ich hatte keine Lust mehr, hier Strafe zu stehen. Und außerdem war es ungerecht. Meine Mutter hätte mich zumindest anhören müssen, ehe sie sich von ihrem Sitz in der mittleren Bankreihe auf mich stürzte.
Meine Mutter hatte die Angewohnheit, ihr erhöhtes Lehrerpult zu verlassen und sich mit dem Rücken zur Tafel in der mittleren der drei Bankreihen auf die vorderste Schulbank zu setzen. Die mittlere Bankreihe war die kürzeste, da sie Platz für die Kipptafel lassen musste. Die Schüler, die auf der ersten Bank der Fenster- oder der Wandreihe saßen, befanden sich daher immer hinter dem Rücken und damit außerhalb des Blickfeldes der Lehrerin. So auch ich. Meine Mutter konnte also gar nicht gesehen haben, ob ich geredet, oder einen Papierflieger gefaltet, oder einem Mitschüler Fratzen gezogen hatte. War es nicht schlimm genug, die eigene Mutter als Lehrerin zu haben? Letztes Jahr hatte es einmal richtig geknallt. Wegen Christiane Wechsler, dieser Sklavenseele. Aber da hatte sich meine Mutter fair verhalten. Christiane Wechsler wohnte nur ein paar Häuser weiter in der Amrichshäuser Straße. Und sie versuchte immer, sich bei meiner Mutter beliebt zu machen, indem sie ihr die schwere Schultasche mit den Korrekturheften nachhause trug. Aber das hatten wir dieser Schleimerin dann ein für alle Mal abgewöhnt. Meine Freundin Ruth und ich hatten ihr an der Brücke aufgelauert, hatten ihr Mutters Tasche aus der Hand gerissen und ihr nebenbei einige kräftige Fausthiebe versetzt. Danach musste ich Mutters Tasche zwar selber nachhause tragen, was ganz schön lästig war. Aber der Schleimerin hatten wir es gezeigt.
Und dann, nur wenige Tage später, hüpften ich und meine Banknachbarin zwischen zwei Schulstunden in Vorfreude auf die großen Ferien auf unseren Sitzen auf und ab. Wobei der hinter uns sitzenden Christiane ein Stift aus der im Pulttisch eingekerbten Federrille rollte und zu Boden ging. Christiane hob den Stift auf und rammte ihn mit Wucht in meinen Rücken. Die sich anschließende Rauferei fand unter den anfeuernden Rufen der ganzen Klasse statt, sodass niemand bemerkte, als die Lehrerin das Klassenzimmer betrat. Meine Mutter schob die jauchzenden und grölenden Schüler beiseite, schnappte sich mein linkes und Christianes rechtes Ohrläppchen, befahl die Schüler auf ihre Bänke und zog uns beide vor die Klasse, wobei sie unsere nach unten gedrückten Köpfe fest an den Ohren hielt. Was denn hier los sei, fragte Mutter streng. Christiane heulte mit weinerlicher Stimme los: »Bärbel hat meinen Füller auf den Boden geschmissen!«. Diese Lüge konnte ich keinesfalls auf mir sitzen lassen. Ich holte mit der rechten Hand aus und verpasste der sich noch immer im festen Griff der Mutter befindenden Gegnerin eine kräftige Ohrfeige. Die Klasse johlte und klatschte und die Mutter war so perplex, dass sie uns beide losließ, auf unsere Plätze zurückschickte und uns nicht einmal eine Strafarbeit gab.
Vielleicht war es ja das. Vielleicht hatte Christiane, diese hinterhältige Kuh, ihre Mutter auf meine Mutter gehetzt. Christiane Wechslers Mutter war Juristin und arbeitete auf dem Amt. Sicher hatte Christiane den Vorfall so dargestellt, als ob ich die Schuldige gewesen sei und meine Mutter mich in Schutz genommen hätte. Und sicher hatte sich ihre Mutter daraufhin bei meiner beschwert. Und da wollte diese jetzt ein Exempel statuieren und beweisen, dass sie ihre eigene Tochter nicht schone. Aber auch ein solches Motiv entschuldigte meine Mutter in meinen Augen keineswegs. Im Gegenteil!
Noch immer in Strafacht vor dem Klassenzimmer wartend öffnete ich das Fenster und blickte auf den Kirchplatz. Ich mochte den Kirchplatz. Ich mochte auch meine alte Schule. Und die Kirche, die rechtwinklig zur Schule stand und mit ihrem reich verzierten Portal die Breitseite des Platzes einnahm. Gegenüber der Kirche war der Kindergarten, aber dazwischen war der Platz offen, stieg leicht an und verschwand in einem schmalen Gässchen, das sich entlang der alten Stadtmauer hinzog und zeitweise unter den mittelalterlichen Häusern hindurchführte.
Der Kirchplatz, auf den ich jetzt mit wütenden Blicken schaute, war für mich ein ganz besonderer Ort. Er war zwar auch der Schulhof, auf dem ich in den Pausen mit meinen Mitschülern tobte und im Winter manchmal von Fritz, meiner Schülerliebe, mit Schnee eingeseift wurde. Aber der Kirchplatz war auch ein geheimer Ort, den nur ich allein kannte. Vor zwei Jahren etwa, ich war damals gerade in die Oberschule gekommen, war ich eines Nachmittags im Sommer, ich weiß nicht mehr warum, alleine auf dem Platz gestanden. Ganz alleine. Kein Mensch war zu sehen. Ich hatte mich mit dem Rücken an die Mauer des Schulhauses gelehnt und schaute über den Platz, auf dem die Hitze über dem geteerten Pflaster zitterte. Ich hatte noch nie solche Stille gehört. An einem Ort, der sonst immer von Schülerlärm und Kindergekreisch erdröhnte. Auch die Kindergartenkinder waren heute zuhause geblieben. Und die Vögel schwiegen. Ich sog die Stille in mich hinein. Und die Hitze. Und das tiefklare Blau des Himmels. So einzigartig, so überirdisch waren die Stille, die Hitze, und der unbegrenzte Himmel - und der Platz vor meinen Augen -, dass ich kaum zu atmen wagte. Ich bewegte mich nicht. Ich wollte mich nie mehr bewegen. Nur meine Augen tasteten jede Einzelheit ab. Den leicht vermoderten Holzzaun um den Kindergarten, die Fratzen der Wasserspeier, die den Bogen über der Kirchentüre zierten, die alten, windschiefen Häuser am Ende des Platzes und rechts daneben, gerade noch zu sehen, inmitten eines prall blühenden Gartens das Pfarrhaus. So stand ich mit dem Rücken an das alte Schulhaus gelehnt und schaute und wollte ein Leben lang nur immer dort stehen und schauen. Doch auch dieser Moment würde ja vergehen. Die Sonne würde untergehen, Leute würden zur Abendandacht kommen und ich wurde zuhause erwartet. Irgendwie musste ich diesem Moment aber Dauer verleihen. Meine Augen suchten das Pflaster vor der Kirche ab und fanden, was sie suchten. Ich legte den kleinen spitzen Stein in die Mitte des Platzes, setzte meine rechte Sandale darauf, drückte sie so stark nach unten, dass die Spitze des Steins meine Fußsohle piekte, und drehte mich mehrmals um mich selbst. Als ob ich das Steinchen in meinen Fuß einschrauben wollte. Ein leichter Schmerz nur – aber der würde diese blaue, glitzernde Sonnenstille versiegeln. Eine Ewigkeit lang. Für mein ganzes Leben.
Mit einem Ruck wandte ich mich um und schloss das Fenster. Auf dem Flur war niemand zu sehen. Nur aus den Klassenzimmern tönten die unterschiedlichsten Geräusche. Lautstarke Lehrerstimmen, Gegröle und Gelächter von Schülern – da wurde wohl gerade eine Klassenarbeit zurückgegeben –, mehr oder weniger wohltönendes Singen, und konzentrierte, nur vom Scharren der Füße und von gelegentlichen Seufzern unterbrochene Ruhe. Das Schulhaus in Künzelsau hatte nur sieben Klassenräume für sechs Klassen. Wobei der Chemie- und der Physiksaal sowie der Musikraum mit dem Klavier für die jeweiligen Fachstunden reserviert werden mussten. Das verlangte vom Rektor, Herrn Schmidt, der den Stundenplan erstellte, ein Höchstmaß an logistischem Können und von den Schülern, dass sie praktisch nach jeder Schulstunde das Klassenzimmer wechseln mussten. Was immer ein großer Spaß, aber auch nicht ganz ungefährlich war. Knapp 200 Schüler bewegten sich mindestens fünfmal an jedem Vormittag vom oberen in den unteren Stock, oder vom unteren in den oberen, die schmale Treppe hinunter oder herauf. Und wenn dann noch Dr. Wieser vom Chemiesaal ins Lehrerzimmer musste und die Treppe blockierte war Feierabend. Ein Gestoße und Geschiebe war das, ein Lachen und Schimpfen, und manchmal genoss man es auch, dicht an einen Schüler oder eine Schülerin heran geschoben zu werden, die man mochte.
Ich achtete genau auf die Geräusche aus den Klassenräumen, als ich von meinem Platz am Fenster leise die Treppe ansteuerte und vorsichtig, Schritt für Schritt, um Knarren zu vermeiden, die Treppe hinunter und am Lehrerzimmer vorbei ins Freie schlich. Ich hatte mich entschieden. Weder meiner Mutter noch der dummen Christiane Wechsler gönnte ich den Triumph, dass ich am Ende der Stunde als gedemütigte Sünderin wieder gnädig in die Klasse aufgenommen würde.
7. Glaube
Als ich gegen Ende des Krieges in Angst um meine Mutter in den Keller gerannt war und dort betete, wusste ich eigentlich nicht, was ich tat. Ich war noch nie in einer Kirche gewesen, und außer meinem Gute-Nacht-Gebet, in dem der Name Jesu vorkam, kannte ich nichts, was mit Glauben oder Religion zu tun hatte. Der Osterhase, der die Geschenke versteckte, hatte keinerlei religiöse Bedeutung und auch das Christkind nicht. Außer vielleicht das Staunen darüber, dass es das Weihnachtszimmer auf so geheimnisvolle Weise verließ, ehe wir Kinder hineindurften. Und man es daher nie zu sehen bekam. Als die Kirchen nach dem Ende des Krieges schnell damit begannen, vor allem Kinder und Jugendliche für sich zu gewinnen, begann für mich eine ganz neue Zeit. In Künzelsau waren die meisten Menschen evangelisch, wie auch die Kirche evangelisch war, die in der Mitte des Städtchens stand und deren Glocken Tag und Nacht die Zeit verkündeten. Und jetzt wieder allabendlich und am Sonntagmorgen zum Gottesdienst riefen. Bald gab es einen Mädchenkreis für die kleinen und eine Jungschar für die älteren Mädchen und ich war eine der ersten, die die neuen Angebote wahrnahmen. Einmal in der Woche traf man sich im Gemeindehaus, spielte und sang, strickte und las im Neuen Testament – und am Sonntag ging man gemeinsam in die Kinderkirche. Ich war immer in Begleitung meiner Freundin Ruth. Bis Ruths Mutter, die katholisch war und in einer sogenannten Misch-Ehe lebte, ihrer Tochter den Besuch der evangelischen Veranstaltungen verbot.
Immer mehr Zeit verbrachte ich in Kirche und Gemeindehaus, aber erst als Schwester Paula in Künzelsau auftauchte, wurde ich wirklich fromm. Schwester Paula war eine Frau im mittleren Alter, mit dunklen Augen und graubraunem Haar, das im Nacken in einen festen Knoten gepresst war. Schwester Paula trug immer dunkle Kleidung. Als ob sie in Trauer wäre oder wie eine Büßerin, die die Sünden der Welt abzutragen hätte. Auf dem Kopf trug Schwester Paula eine kleine schwarze Haube mit schmalem weißem Rand. Offenbar das Abzeichen eines Ordens, dem sie angehörte, oder dem sie einmal angehört hatte. Schwester Paula war während des Krieges in der christlichen Mission in Afrika tätig gewesen und konnte stundenlang von armen, verhungerten Negerkindern erzählen, deren Augen strahlten, wenn sie ihnen von Jesus und seiner Liebe zu den Menschen sprach, und die sie aus den Fängen eines barbarischen Irrglaubens hatte retten können. Schwester Paula war die zuständige Gemeindeschwester, bei der ich zu Jungschar und Bibelstunde ging, und die immer größeren Einfluss auf mein Leben gewann. Sie hatte mich zu einer gläubigen Christin gemacht, und hieß mich zum Beispiel für das Seelenheil meines Onkels beten, der aus der Kirche ausgetreten war. Und später Danksagungen gen Himmel schicken, als meine Gebete erhört wurden und der Onkel wieder in die Kirche eintrat. Erst sehr viel später fiel bei mir der Groschen und ich erkannte, dass der Onkel sowohl den Austritt als auch den Wiedereintritt in die Kirche dem jeweiligen Zeitgeist entsprechend und seiner Karriere zuliebe vorgenommen hatte.
Schwester Paula lehrte mich beten und an Wunder glauben. Als ich ein verlorenes Silberarmbändchen nach intensiven Stoßgebeten zum lieben Heiland in einem der Nachbarsgärten zwischen den Kieselsteinen wiederfand, war das ein Wunder, das mir Gott hatte zuteilwerden lassen. Regelmäßig spendete ich die Hälfte meines Taschengeldes für die Mission in Afrika und übergab Schwester Paula den gesamten Geldbetrag, den ich am Samstag vor dem Muttertag als dreizehnjährige durch den Verkauf von selbst gepflückten Blumen erwirtschaftet hatte. Nach meiner Konfirmation begann ich als Kinderkirchenlehrerin die kleineren Jungen in biblischer Geschichte zu unterrichten.
Später kamen abendliche Treffen mit Schwester Paula hinzu. Sie waren irgendwie gruselig, aber doch so voller traumseliger Nähe und überirdischer Ahnung, dass ich wie süchtig auf die wöchentlichen Sitzungen wartete. Eine kleine Gruppe ausgewählter junger Mädchen versammelte sich im hoch über der Stadt gelegenen Kirchturmzimmer. Wenn es dämmerig wurde lasen wir bei Kerzenschein, denn es gab im Turmstübchen kein elektrisches Licht. Meiner Erinnerung nach lasen wir hauptsächlich in der Offenbarung des Johannes. Ich erzitterte vor den Visionen des Jüngsten Gerichts, widersetzte mich mit den anderen Mädchen dem Antichristen und war fest davon überzeugt, dass das Ende der Welt nahe bevorstand. Schwester Paula betete und sang mit uns, erklärte uns die Gesichter des prophetischen Apostels, und wenn wir uns dann an den Händen hielten und gemeinsam das Vaterunser gebetet hatten, sagte sie uns die Formel vor, mit der wir vereint dem Satan abschworen. Wie im Rausch ging ich nachhause. Lobte Gott ewige Treue und verspürte beißende Reue darüber, dass ich den Segensspruch, der meinem Freund Fritz bei der Konfirmation zugeteilt worden war, schneller auswendig kannte als meinen eigenen.
Bis die Sache mit dem Stadtpfarrer passierte.
Es war in der fünften Oberschulklasse. Ich war ein Jahr vorher konfirmiert worden und unterrichtete seither Sonntag für Sonntag in der Kinderkirche. Ein vorübergehend nach Künzelsau abgeordneter Vikar hatte unsere Klasse fast ein ganzes Jahr in Religion unterrichtet. Mit seinen spannenden Erzählungen aus der biblischen Geschichte hatte er alle Schüler in Bann gezogen, musste dann aber Künzelsau verlassen. Seit dem neuen Schuljahr war daher der Stadtpfarrer Hartmann unser Religionslehrer. Eine mittlere Katastrophe. Der Unterricht des Herrn Pfarrer war totlangweilig. Meist war ich die einzige in der Klasse, die seinem Unterricht folgte und seine Fragen beantwortete. Bis dem Stadtpfarrer eines Tages die Geduld riss über diese unaufmerksame und ständig schwatzende Schülerbande, die er nicht in den Griff bekam und einem Schüler eine schallende Ohrfeige verpasste. Einem Schüler, der einer der stillsten und schwächsten der Klasse war, der von den anderen häufig gehänselt und geschubst wurde und der gewiss keinen Ton von sich gegeben hatte.
Die Schüler waren empört. Da der Klassensprecher katholisch war, gab es niemanden, der dem Herrn Pfarrer den Protest hätte überbringen können. Auch war den meisten Schülern meiner Klasse der Religionsunterricht ohnehin egal. Nur mir nicht. Es konnte nicht sein, dass ein Pfarrer einen Schüler schlug – und das noch ohne sich vergewissert zu haben, ob dieser Schüler den Unterricht wirklich gestört hatte. Ich forderte meine Mitschüler zum Boykott auf. Keiner dürfe in die nächste Religionsstunde das Gesangbuch mitbringen oder das Neue Testament. In der nächsten Religionsstunde müsse mit dem Stadtpfarrer über diesen Vorfall gesprochen werden.
Als der Stadtpfarrer in der nächsten Religionsstunde die Klasse aufforderte, Matthäus II aufzuschlagen, begann die ganze Klasse zu kichern. Kein Schüler und keine Schülerin hatte die Bibel dabei. Aber es meldete sich auch niemand, um dem Pfarrer zu erklären, was da vor sich ging! Ich war wütend. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Da keiner meiner Mitschüler Anstalten machte, das Wort zu ergreifen, stand ich schließlich selber auf und sagte dem Herrn Pfarrer, dass wir die Bücher absichtlich zuhause gelassen hätten, und dass alle in der Klasse der Meinung seien, im Religionsunterricht dürfe nicht geschlagen werden. Der Pfarrer begann sich zu rechtfertigen und wies auf den Lärmpegel in der Klasse hin. Und dass die Schüler anders nicht zu disziplinieren seien.
»Aber beim Herr Vikar waren alle still. Sein Religionsunterricht war immer interessant. Da haben alle Schüler mitgemacht. Der Herr Vikar musste nicht schlagen! «
Ob der Pfarrer die Stunde zu Ende führte oder das Klassenzimmer gleich nach dem Wortwechsel mit mir verließ, kann ich heute nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es Pfarrer Hartmann nach diesem Vorfall ablehnte, nochmals in unserer Klasse zu unterrichten. Und dass er mir ein Schuldtrauma hinterließ. Ich hatte den Pfarrer angegriffen! Ihn, der doch auch für mich hohe, wenn nicht höchste Autorität besaß. Wie hatte ich das nur tun können! Wie konnte ich das je wiedergutmachen? Tagelang schlich ich nach der Schule um das Pfarrhaus herum - bis ich mir schließlich ein Herz fasste und bei dem Pfarrer klingelte. Und mich schuldbewusst und tränenreich entschuldigte.
Der Stadtpfarrer schätzte meinen Einsatz als „Hilfspastorin“ in der Kinderkirche. Er nahm meine Entschuldigung an. Aber für mich selbst war dieser Vorfall der Beginn eines Erosionsprozesses, der dazu führte, dass ich Jahrzehnte später aus der Kirche austrat.
8. Erste Liebe
Unser Haus in der Amrichshäuser Straße stand etwa 300m oberhalb des Flusses, auf dessen jenseitiger Seite das Sportfeld lag. Die Entfernung zu dem Platz war per Luftlinien also nicht besonders weit. Der Fluss teilte sich unten bei der Badeanstalt, kurz vor dem Sportplatz. In den Kanal, der den Großteil des Wassers geradeaus zur Stadt führte und die Lohmühle speiste, und den Restfluss, der bei der Badestelle, am Anfang des Kanals, rechts über ein Wehr ablief, dann einen großen Bogen um den Sportplatz machte, um am Ende des Ortes hinter der Brücke das Kanalwasser wiederaufzunehmen. Der Alt Fluss, der meine Uferseite vom Sportplatz trennte, war flach und breit und voller Steine und führte im Sommer fast kein Wasser. Nur jetzt, im Frühjahr, war er etwas angeschwollen.
Mit dem Fernglas, das ich trotz des Verbotes der Mutter aus dem Bücherschrank genommen hatte, konnte ich nach einiger Übung und wenn ich den Arm auf das Fensterbrett legte und ihn ganz ruhig hielt von unserer Wohnung aus ziemlich genau erkennen, wer sich da auf dem Sportplatz herumtrieb. Die beiden letzten Schulstunden waren heute ausgefallen und da hatten wir, ich selbst, mein Freund Fritz, dessen Freund Klaus und meine Freundin Hanne, vor dem Schulhaus mit den Fahrschülern, die auf ihren Zug warten mussten, verhandelt, ob man noch etwas unternehmen wolle. Das war üblich, wenn Randstunden ausfielen. Für mich waren die freien Randstunden das Schönste an der Schule. Eine ganze Stunde mit Fritz reden, spielen, raufen, oder sich im Winter eine Schneeballschlacht liefern!
Zwar sah ich Fritz täglich in der Schule. Und manchmal sogar beim Sonntagsspaziergang, wenn seine Eltern zufällig den gleichen Spazierweg genommen hatten und uns auf ihrem Rückweg entgegenkamen. Dann hatten wir uns immer schon von weitem erspäht. Während wir uns näherkamen, hefteten sich unsere Augen aneinander, und wenn Fritz mit seinen Eltern an mir vorbeiging, klopfte mein Herz wie wild. Dass ich Fritz täglich in der Schule sah, verlieh der Schule einen beglückenden Reiz. Wenn wir nach den Schulstunden die Klassenräume wechseln mussten, konnte Fritz mir in dem lärmenden Gedrängel oft so nahekommen, dass ich sein liebevolles Anrempeln wie eine Umarmung empfand. Dabei steckte er mir manchmal kleine Geschenke zu. Wie zum Beispiel die Geo- Dreiecke aus braunem Plastik, deren Einzelteile ich noch als Studentin in meinem Federmäppchen mit mir führte, und die damals, so kurz nach dem Krieg, eine Kostbarkeit waren. Geo- Dreiecke waren, wenn man überhaupt welche bekommen konnte, aus Pappe oder aus Holz. Aber Fritzens Tante hatte einen Schreibwarenladen, und so war er an die beiden Prachtstücke gekommen, die er mir unter dem Schutz des Schülerhaufens in der Pause in die Hand schmuggelte. Oder aber er steckte mir eine Zeichnung zu. Für den Kunstunterricht oder auch eine Erdkundezeichnung. Fritz war kein guter Schüler, war aber Klassenbester in Kunst und Sport.
Dass ich mein Abitur mit dem großen Latinum abschloss, was für meinen späteren beruflichen Werdegang nicht ganz unwichtig war, verdanke ich meiner Schülerliebe. Nach der zweiten Oberschulklasse musste ich entscheiden, ob ich Französisch oder Latein als zweite Fremdsprache nehmen wollte. Fritz hatte für Latein optiert und so stand für mich fest, dass auch ich Latein lernen würde. Und ich blieb dabei. Trotz aller Bemühungen meiner Mutter, mir klarzumachen, dass Französisch eine viel schönere Sprache sei, die mir außerdem im späteren Leben von viel größerem Nutzen sein würde, und die auch viel besser zu einem Mädchen passe. Beeindruckt von meiner Standhaftigkeit und weil mein Vater erste Anzeichen von wissenschaftlichem Ehrgeiz in seiner Tochter zu erkennen glaubte, gab die Mutter schließlich nach. Ich wurde der kleinen Gruppe der „Lateiner“ zugeordnet. Zusammen mit Fritz, der allerdings nach zwei Monaten zu den „Franzosen“ überwechseln musste, weil Latein angeblich zu schwierig für ihn war.
An diesem speziellen Tag war ich nach der Schule unschlüssig neben Fritz bei der kleinen Schar von Schülern gestanden, die den Weg nachhause nicht angetreten hatten, bzw. ihn noch nicht antreten konnten, und überlegte mit ihnen, was man bis zur Abfahrt der Fahrschüler noch unternehmen könne. Sollte man eine Runde Fangerles spielen oder Verstecken, was in den verwinkelten Gässchen immer sehr spannend war, oder sollte man nachsehen, ob es beim Konditor Österlin schon Eis gab. Immerhin war es April und erste heiße Tage hatte es schon gegeben. Das Wetter war durchwachsen, der Himmel bewölkt. Vielleicht würde es bald regnen. Irgendwie hatte dann aber doch niemand so recht Lust auf Eis oder auf Spielen und auch ein Stadtbummel reizte nicht wirklich. Das Grüppchen beschloss, nachhause zu gehen. Die Fahrschüler würden in einem leerstehenden Klassenzimmer ihre Hausaufgaben erledigen.
Und jetzt, etwa eine viertel Stunde später, stand ich mit dem Fernglas am Fenster unseres Wohnzimmers und versuchte herauszufinden, wer sich da auf dem Sportplatz tummelte. Mehrere Figuren waren das, vier oder fünf, die da hinter einander herrannten, jetzt auf dem Holzbalken saßen, der das Fußballfeld umgrenzte, und dann wieder zu rennen begannen. Und jetzt wieder nebeneinander auf dem Balken saßen. War es wirklich möglich, dass Fritz und Klaus ohne mich, ja sogar entgegen unserer gemeinsamen Abrede, mit den Fahrschülerinnen auf den Sportplatz gegangen waren? Und jetzt dort mit ihnen spielten?
Meine Augen hatten sich inzwischen an das Fernglas gewöhnt. Ich konnte jetzt alles genau erkennen: Fritz war zusammen mit den beiden Ursulas auf dem Sportplatz! Ich wollte es nicht glauben. Wie konnte er nur? Ursula Veigel und Ursula Weiß hatten einen schlechten Ruf in der Klasse. Ich wusste eigentlich nicht warum. Vielleicht „gingen“ sie ja schon mit Jungen, oder hatten einen Freund aus dem Lehrerseminar, das nach dem Krieg im Schloss eingezogen war. Jedenfalls waren sie die ältesten Mädchen in der Klasse, mehr als ein Jahr älter als ich, und sie kannten sicher schon Sachen, von denen ich keine Ahnung hatte. Ich war die jüngste in der Klasse und brannte jetzt vor Eifersucht.
Fritz gehörte zu mir! Er hatte immer zu mir gehört und jeder in der Klasse wusste das! Fritz liebt Babsi! oder Babsi liebt Fritz! stand mindestens einmal in der Woche auf der großen Kipptafel, wenn ein Lehrer sie umdrehte, um die Hausaufgaben für die Klasse aufzuschreiben. Und die ganze Klasse kicherte. Ich konnte mich nicht erinnern, ob Fritz auch schon mit mir in der Klasse von Herrn Faude gewesen war. Aber ich wusste, dass ich ihn kannte und mochte, sehr mochte, seit ich in der Oberschule war. Und Fritz mochte mich auch. Dessen war ich mir sicher. Warum sonst die Geo-Dreiecke und die Zeichnungen und das – ich wurde rot, wenn ich daran dachte –, das verbotene Zusammentreffen unserer Füße unter der Schulbank. Wenn ich mich an die Stunden erinnerte, in denen ich direkt vor Fritz saß, in einer der langen Bänke, mit denen nur der Chemie- und der Physiksaal ausgestattet waren, dann erschauerte ich. Normalerweise saß ich weder im Chemie- noch im Physiksaal direkt vor Fritz, der seinen Platz in der dritten Jungenreihe hatte, während ich in der zweiten Mädchenreihe saß. Nur im evangelischen Religionsunterricht, den die katholischen Schüler nicht besuchten, hatte es sich ergeben, dass ich in der letzten Mädchenbank saß und Fritz in der ersten Jungensbank direkt hinter mir. Und dann spürte ich eines Tages diese unsäglich wohlige Wärme in mir aufsteigen, als meine Füße versehentlich mit Fritzens Füßen zusammenstießen. Und dann immer wieder. Nicht mehr aus Zufall, sondern weil wir beide, kaum hatte der Religionsunterricht begonnen, wie Süchtige den Kontakt unter der Bank suchten. Fast die ganze Religionsstunde über brannte sich das Sündenfeuer von meinen Füßen aufwärts in die Seele. Und ich wusste, dass das, was ich da fühlte – ausgerechnet im Religionsunterricht – eine besonders schwere Sünde war.
Sollte das alles jetzt nicht mehr gelten? Wollte Fritz mich für eine dieser zickigen Puten aus Ingelfingen aufgeben! Konnten seine Blicke so lügen! Noch heute Morgen hatte er mich mit seinen dunklen Augen so angesehen, dass ich, wie immer, wenn sein Blick mich traf, vor Wohlgefühl zu zerschmelzen meinte. Und dass er mich als einziger Mensch in ganz Künzelsau mit meinem richtigen Namen ansprach: Barbara! Nicht Bärbel, oder Babsi, oder Babs wie alle anderen! All das sollte jetzt keine Bedeutung mehr haben! Wenn Fritz mich Barbara nannte, war das wie eine Liebkosung.
Ich stand am Fenster und starrte hinaus. Auf dem Sportplatz bewegten sich vier kleine Pünktchen, entfernten sich voneinander, liefen auf einander zu, um dann so nahe zusammen zu stehen, dass sie in einem großen Punkt verschmolzen. Ich war alleine zuhause. Meine Mutter und die Brüder waren in der Schule und Rosel war offenbar zum Einkaufen gegangen. Ich dachte an die heimlichen Ausflüge, die ich im letzten Sommer und auch schon im Jahr davor mit Fritz gemacht hatte. Ich und meine Freundin Hanne hatten sich für eine Tagestour mit dem Fahrrad zuhause abgemeldet und das gleiche hatten Fritz und sein Freund Klaus gemacht. Vor der Stadt, da wo die Straße nach Kupferzell steil ansteigt und die katholische Kirche etwas verlassen am Berg steht, trafen wir uns, um die gemeinsame Tour zu beginnen. Fritz und ich fuhren immer nebeneinander, eskortiert vom besten Freund und von der besten Freundin, die selbst kein Pärchen waren, aber selbstverständlich gerne mitfuhren.
Schon seit meinem zwölften Lebensjahr hatte ich Fahrradtouren unternommen. Natürlich nur mit der Freundin, aber da die Mutter in dieser Hinsicht großzügig war, durfte ich schon als Zwölfjährige mit der nur um ein Jahr älteren Hanne mehrere Tage unterwegs sein und in Jugendherbergen übernachten. So hatte ich in fast allen Ferien Radtouren in die nähere und weitere Umgebung unternommen und kannte alle Kirchen und Schlösser, alle berühmten Kunstschätze, Madonnenbilder und geschnitzten Altäre, alle von Fachwerkhäusern umstellten Marktplätze, die in zwei bis drei Tagesreisen Entfernung von Künzelsau zu besichtigen waren.
Aber die Tagesausflüge mit Fritz, von denen weder seine noch meine Eltern noch auch die Eltern unserer Freunde etwas wussten, waren besonders. Natürlich waren Fritz und ich nie allein. Davon hätte ich nicht einmal geträumt. Die Innigkeit, die daraus entstand, dass wir in so großer Nähe beieinander waren, dass wir einen ganzen Tag lang alles gemeinsam machten, die Räder gemeinsam die Scherersteige hinaufschoben, um auf der anderen Seite freihändig und jubelnd nebeneinander hinunter zu sausen, das gemeinsame Picknick im Wald, die Gespräche über die Schule, die Schulkameraden und vor allem über die verrückten Lehrer, – all das war so voll betörenden Glücks, dass ich mir nichts weiter vom Leben wünschte, als dass diese Tage nie vergehen würden.
Und jetzt spielte Fritz da unten mit den „Ursulinen“! Noch immer stand ich unbeweglich am Fenster. Aber in mir kochte es. Etwas Unbändiges, etwas, von dem ich nicht wusste, ob es Wut, Sehnsucht, Liebe, Empörung oder Hass war, etwas, das ich noch nie zuvor gefühlt hatte, überfiel mich wie ein Sturzbach. Keine Sekunde länger konnte ich das ertragen.
Wie ich zum Fluss gekommen war, wusste ich später nicht. Mit der Starrheit einer Traumwandlerin verließ ich das Haus, bog am Ende der Straße nach rechts in den Feldweg ein, an dessen Anfang noch einige Häuser standen, der aber weiter unten in eine große Wiese mündete, an deren Ende der kanalisierte Fluss entlanglief. Und an deren rechten, dem Sportplatz zugewandten Seite das alte Flussbett verlief. Manchmal, nach starkem Regen, gab es etwas Wasser im Alt Fluss, aber trotzdem konnte man, die Schuhe in der Hand, mitsamt Kleidern und Badesachen das breite Flussbett leicht durchqueren. Jetzt war April. Im April konnte man nicht baden und ich hatte den Fluss noch niemals im April durchquert. Jetzt führte er Wasser. Ziemlich viel und ziemlich schnell fließendes Wasser. So dass auch die größeren Steine von Wasser bedeckt waren. Aber ich kannte ja die Furt, kannte jeden Stein. Von so vielen Badetagen in vielen Badesommern her kannte ich den besten Übergang. Ich zögerte keinen Moment. Ich musste auf die andere Seite. Auf der anderen Seite war der Sportplatz. Und auf dem Sportplatz waren Fritz und die Mädchen! Ich musste hinüber. Auch wenn mir das Wasser bald bis zum Knie stand und dann weiter anstieg, mein Kleid und dann meine Unterhose erreichte, und ich der stärker werdenden Strömung des Flusses kaum standhalten konnte. Ich musste hinüber. Diesen Verrat konnte ich Fritz nicht durchgehen lassen. Und den beiden Ziegen aus Ingelfingen würde ich es zeigen! Ich stolperte. Die Steine waren glitschig und das schmutzig braune Wasser machte es unmöglich, sich einen flachen Stein als Tritt auszusuchen. Mit Händen und Füßen tastete ich nach Halt, versuchte verzweifelt, der Strömung zu widerstehen und mich über Wasser zu halten. Doch ich stürzte, fiel der Länge nach in den Fluss und konnte mich, klitschnass von Kopf bis Fuß, nur mit Mühe zurück an mein eigenes Ufer retten.
Als ich mit nassen Haaren und triefendem Kleid den Wiesenweg entlang und dann das kleine Straßenstück bis zu unserem Haus zurückging, war mir, als würde ich Spießruten laufen, obwohl kein Mensch auf der Straße war. Zornestränen liefen mir übers Gesicht. Zornestränen über mich selbst! Ich glaubte, jeder Mensch müsse mir ansehen, welch ungeheuerliche Dummheit ich da vorgehabt hatte. Auf den Sportplatz rennen, Fritz zur Rede stellen, die beiden Mitschülerinnen beschimpfen! Wie konnte ich nur! Wie schrecklich hätte ich mich blamiert, wenn der Fluss mich nicht aufgehalten hätte! Die Scham drang mir bis ins Mark.
Zuhause angekommen wechselte ich die Kleider und schloss mich im Kinderzimmer ein. Noch waren die anderen nicht von der Schule zurück. Ich holte ein sauberes Heft aus meinem Ranzen und schrieb mit meinem lecken Füllfederhalter, der nach jedem Gebrauch Tintenflecken auf Zeige- und Mittelfinger zurückließ, mit möglichst sauberen Buchstaben folgendes Gelöbnis in mein Heft:
»Nie mehr werde ich Fritz ansehen. Ich werde mich zur Seite drehen, wenn er mich anschaut. Nie mehr werde ich im Religionsunterricht vor ihm sitzen und ich werde niemals mehr eine Radtour mit ihm machen. Ich werde nicht mehr mit ihm spielen. Ich werde so tun, als gäbe es Fritz Weidler nicht«.
Es fiel mir unendlich schwer, mein Gelöbnis einzuhalten und Fritzens freundlichen Attacken zu widerstehen. Fritz suchte bei jeder Gelegenheit Blickkontakt, versuchte, mir kleine Geschenke und Bücher aus den Beständen seiner Tante zuzustecken, und bei dem täglichen Klassenraumwechsel boxte er mich liebevoll. Obwohl es mir das Herz zerriss, blieb ich standhaft. Ich sah ihn nicht, redete nicht mit ihm, ich ließ mich auf nichts ein. Ein ganzes Jahr lang bestrafte ich mich und hielt durch. Dann musste ich Künzelsau verlassen und zum Vater nach Stuttgart ziehen. Und sah Fritz nur noch selten. Gelegentlich an den Wochenenden. Erst jetzt sprach ich wieder mit ihm und in den großen Ferien nach meinem Auszug aus Künzelsau verabredete ich mich mit ihm zu einem Fahrradausflug.
Noch nie zuvor hatten wir einen Fahrradausflug zu zweit gemacht. Zum ersten Mal nur wir beide. Fritz und ich. So viel ich erinnere, wollten wir die Stuppacher Maria von Matthias Grünewald besuchen, die etwa 20 km von Künzelsau entfernt in einer kleinen Kapelle zu Hause war. Aber wir kamen nicht bis zur Kapelle. Auf halbem Weg packten wir in einer Waldlichtung nahe an der Straße unsere mitgebrachten Wurst- und Käsebrote aus, zogen die Cola- und für Fritz eine Bierflasche aus dem Rucksack und lagerten uns zum Picknick. Das Picknick artete jedoch in eine wilde Rauferei aus, da Fritz versuchte, mich zu küssen und ich mich mit der ganzen Entschlusskraft meiner 14 Jahre dagegen wehrte. Meine Freundin Hanne und ich, wir hatten doch geschworen, uns erst von dem Manne küssen zu lassen, den wir auch heiraten würden. Und ob ich Fritz heiraten wollte, darüber war ich mir noch nicht im Klaren. Aber der Abwehrkampf fiel mir schwer. Zum ersten Mal spürte ich die Kraft sexuellen Begehrens meinen ganzen Körper wie einen Rausch durchfluten und durfte ihm doch nicht nachgeben.
Ob wir die Stuppacher Madonna bei diesem Ausflug dann doch noch irgendwie erreicht haben, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass sich in der darauffolgenden Nacht wilde Albträume und traumatische Schuldgefühle wie Felsbrocken auf meine Brust legten. Mich nicht schlafen ließen und mich noch in den Tag hinein verfolgten. Trotzdem zog ich Ende Juli mit Fritz und Uli, dem jüngeren Bruder von Fritzens Freund Klaus, und mit meinem Bruder Jochen auf hochgepackten Fahrrädern und ausgerüstet mit Schlafsäcken und Zelt, mit Kochgeschirr und Gaskocher zu viert in die Schweiz. Die Reise war wunderschön. Erotisch aufgeladen, aber ungefährlich. Im Zelt schlief ich außen neben meinem kleinen Bruder und die gemeinsamen Unternehmungen, Zeltplätze aussuchen, Zelt aufbauen, irgendetwas Essbares für uns vier in dem großen Kochtopf zusammenbrauen, in fremden Seen baden, in Sandalen auf hohe Berge zu steigen – den Pilatus zum Beispiel und die „Jungfrau“ –, all das gehörte zum zauberhaften Schlussakt meiner Kindheit.
Denn unsere Reise endete auf dem „Tonacker“. Onkel Gusti und Tante Liseli, denen der Tonacker gehörte, hatten nach dem Krieg mehrmals unterernährte Kinder aus verschiedenen europäischen Ländern aufgenommen und auf ihrem Bauernhof hochgepäppelt. Durch die Vermittlung einer Freundin meiner inzwischen verstorbenen Tante Gertrud war ich 1949, als zwölfjähriges an chronischer Bronchitis leidendes Kind auf den Tonacker gekommen. Und hatte mich dort drei herrliche Monate lang verwöhnen lassen. Mit gutem Essen, mit nicht entrahmter Frischmilch direkt aus dem Stall, mit Bergen von Schokolade, die es in Deutschland noch nicht gab und die mir von allen Tanten und Onkeln und Freundinnen, die auf den Tonacker zu Besuch kamen, so reichlich zugesteckt wurden, dass ich Vorräte davon aufsparen und mit nach Hause bringen konnte. Verwöhnt worden war ich aber nicht nur mit Nahrhaftem, sondern auch mit Zuwendung und Liebe. Denn nicht nur Tante Liseli und Onkel Gusti, auch die im Altenteil auf dem Hof lebenden Großeltern und Erna, die Magd, waren so liebevoll und freundlich zu mir gewesen, dass ich niemals Heimweh bekam. Und jetzt den Wunsch hatte, meine Pflegeeltern von damals wieder zu besuchen.
Mit Jochen u. Fritz am Bodensee,1953.
Nach einem Tag Pause auf dem „Tonacker“ fuhren Fritz und Uli nach Deutschland zurück. Ich blieb mit meinem Bruder für eine weitere Woche zu Gast auf dem Tonacker. Onkel Gusti und Tante Liseli hatten zu dieser Zeit einen Knecht aus Deutschland eingestellt, Dieter, dessen Vater Altphilologe und Rektor des Herrenberger Gymnasiums war, der aber selbst Bauer werden wollte. Dieter war ein aufgeweckter junger Mann, mittelgroß und mit sonnengebräunten Armen, fröhlichen braunen Augen und leichtgelocktem Haar, das seinen runden Kopf wie eine braune Kappe umschloss. Dieter fand offenbar Gefallen an mir. Ich half ihm im Stall, fuhr neben ihm auf dem Kutschbock und bei Tisch lachten und scherzten wir beide auf Schwäbisch, unserer gemeinsamen Muttersprache. Eines Nachmittags versuchte Dieter mich am Ausgang der Scheune von hinten mit seinen kräftigen Armen zu fassen und zu küssen. Ich entwand mich ihm schnell; aber der kurze Moment, in dem er mich im Arm gehalten und an sich gezogen hatte, ließ mich brennen. Dieter war ein gestandener Mann. Seine Wärme ergriff meine Seele. Ich verliebte mich in Dieter.
Am Sonntag lud mich Dieter zu meinem allerersten Rendezvous ein, zu einer Kahnfahrt auf dem nahe gelegenen Zürchersee und anschließend zu Eis und Kuchen im Terrassencafé über dem Wasser. Unsere Unterhaltung verlief anfangs etwas stockend, dann aber sprachen wir über meine Radtour, über meine albernen Klassenkameradinnen in Stuttgart und über das Leben in der Stadt. Und Dieter erklärte mir, warum er Bauer werden wolle. Wir sprachen über alles, was es zwischen einem erwachsenen Mann und einem 15jährigen Mädchen zu sprechen gab. Einem jungen Mädchen, das dem jungen Mann gefiel, das aber offensichtlich völlig unerfahren und als „Pflegetochter“ des Chefs ohnehin tabu war. Dieter machte keinen weiteren Versuch, mich zu berühren, aber das war auch nicht nötig. Sobald ich mir darüber klar geworden war, dass ich diesen jungen Mann liebte, der mir jetzt ganz ohne Stallgeruch, glattrasiert und in frisch gestärktem Sonntagshemd gegenübersaß, hatte ich in meinem Jungmädchenherzen beschlossen, ihn, wenn ich älter wäre, zu heiraten und mit ihm einen Bauernhof zu betreiben. Ich war mir meiner Sache so sicher, dass ich es nicht für nötig hielt, jetzt mit ihm darüber zu sprechen. In drei Jahren, wenn ich mit der Schule fertig wäre, würde ich wiederkommen. Dass ich seinetwegen ein Jahr später nach Amerika fahren würde, ahnte ich nicht.
3Johann Gottlieb Fichte: Grundlage des Naturrechts, Deduktion der Ehe, in: Fichtes Werke, hrsg. von Immanuel Hermann Fichte Bd. 3, S. 304ff. Da eine Frau, davon geht Fichte aus, keinen Geschlechtstrieb besitzt und sich ihrem Mann daher aus Liebe hingibt, gibt sie, die an sich gleiche Rechte wie jeder Mensch hat, mit der Verheiratung nicht nur ihren Namen, sondern auch alle ihre bürgerlichen Rechte auf. Denn „Liebe“ bedeutet die vollständige Unterwerfung unter den Willen, die Rechte und die Interessen des geliebten Menschen.
4Das im Kaiserreich 1880 erlassene Gesetz, das besagte, dass Beamtinnen bei Heirat den Beruf aufgeben müssen, wurde zwar dem Grundsatze nach am 11. August 1919 durch die Weimarer Verfassung aufgehoben. Es dauerte jedoch noch mehr als 30 Jahre bis der Verfassungsgrundsatz in ganz Deutschland durch das den Ländern vorbehaltene Beamtenrecht umgesetzt wurde und Beamtinnen nach der Heirat selber entscheiden konnten, ob sie weiterhin als Beamtinnen berufstätig sein wollten, oder nicht.
5Julie hatte sich in einen der Untermieter meiner Großmutter verliebt, einen Gerichtsreferendar ohne Stelle und Einkommen. Sie musste jedoch den Bewerber heiraten, den ihre Mutter für sie ausgesucht hatte, weil er schon verbeamtet war und gut verdiente.
6Nicht-Angriffspakt zwischen Deutschland und Japan.
7Napola stand für Nationalpolitische Erziehung-bzw. Lehranstalt und bezeichnete die über ganz Deutschland verteilten Elite-Internatsschulen für Jungen, die für den nationalsozialistischen Führungsnachwuchs ausgewählt worden waren.