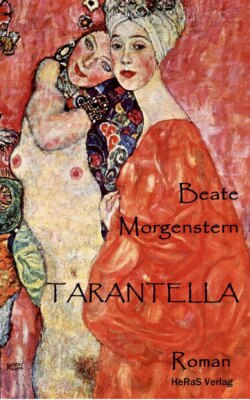Читать книгу Tarantella - Beate Morgenstern - Страница 3
1
ОглавлениеAmanda: Im zarten Alter von achtunddreißig Jahren entdeckte ich jenes süße, geheimnisvolle Geschlecht, das Männer Jahrtausende schwärmen und dichten machte. Seither träume ich davon, in einen Harem unbeschnittener Frauen verschleppt zu werden, all diese wunderbaren Geschöpfe von möglichst jeder Hautfarbe tagtäglich, nachtnächtlich um mich zu haben. Den Preis, in der vierhundertundzweiten Nacht den Herrscher zu beglücken, zahlte ich allemal.
In achtzehnjähriger Ehe hatte ich Pflichten genug und Rechte eher minder gehabt. Die Liebe war eine Angelegenheit von Viertelstunden. Nun tat sich mir die Tür zum Paradiesgärtlein auf.
Ich danke dir, Amanda. So nanntest du dich, und auch ich werde dich als Amanda in meiner Erinnerung bewahren. Ich danke dir, du erste aller meiner Frauen, ich danke dir für deine zärtlichen Hände, deine Küsse. Ich danke dir auch für all die Schmerzen, die du mir in solcher und solcher Weise bereitet hast, deine langen Fingernägel nicht schonend, so dass ich bisweilen aufschrie, und dein Herz auch nicht, das du mir für Wochen ausliehest. Nicht zu gering war ich dir. Keine Frau ist dir zu gering, als dass sie nicht dein Begehren wecken könnte. Ich danke dir, Liebste, dass du mich vom rechten Wege abbrachtest, so dass ich Mann und unmündige Kinder verließ, um dir anzuhängen. Du brachst mir das Herz.
Weine nur, Rosalia, weine, sagte sie, nachdem sie mir mitgeteilt hatte, sie sei meiner nun überdrüssig. Wir wollten uns nie belügen, das haben wir uns geschworen, sagte sie. Das sind wir uns schuldig. Ich sage dir also die Wahrheit, Rosalia. Wie du siehst, halte ich mich an unsere Abmachungen.
Rosalia, diesen Namen hatte sie mir gegeben meiner roten Locken wegen, die mir in meiner Kindheit zu schaffen machten. Mädchen zerrten an ihnen, nicht wissend, dass ich sie eines Tages dafür strafen würde.
Weine, Rosalie, weine, wiederholte sie. Tränen erleichtern. Auch ich habe geweint, als mich die Frau verließ, die mir klarmachte, dass ich von nun an Frauen lieben müsse. Aber ich bin besser zu dir als jene. Denn ich hinterlasse dir allerhand Erfahrungen, die für dein späteres Leben nützlich sein werden. Ich verspreche dir, die Zeit wird kommen, da deine Tränen getrocknet sind. Und wenn es soweit ist, wirst du dich meiner dankbar erinnern. Ich sage dir schon heute, du wirst jede Frau bereit finden, wenn du nur den dringlichen Wunsch, sie zu besitzen, auf feine Art äußerst. Denn die Weiber sind ein neugieriges Geschlecht, darauf aus, von Verbotenem zu kosten.
Ich will nur dich!, schluchzte ich. Meine Tränen flossen die Wangen hinunter, nässten meine Bluse. Nur dich, nur dich, sonst niemanden. Ich habe gedacht, dass wir für immer...
Für immer? Ein grässliches Wort. Ihr Weiber wollt immer für immer. Aber alles hat ein Ende.
Ein Ende, Amanda? Mit dem Tod vielleicht.
Bitte, Rosalia, ich hasse Szenen, sagte Amanda in ruhigem Ton. Wir hatten eine schöne Zeit miteinander. Sei dankbar. Oder war es keine schöne Zeit?
Ja, das war sie, bestätigte ich und konnte mich nicht damit abfinden, dass sie nun vergangen sein sollte. Warum nur, Amanda, warum nur?, fragte ich. Die Tränen stürzten aus meinen Augen, und ich merkte die von Amanda versprochene Wohltat dieser Tränen nicht. Ich habe alles meinem Mann gesagt. Dass ich nicht mehr in der Lage bin, mit ihm zusammenzuleben. Meine Kinder leiden. Meine Familie weiß nicht aus noch ein und hält es für ein Unglück, was mir widerfahren ist, aber ich habe es für das größte Glück gehalten.
So geh doch zu deiner Familie zurück, meine Kleine. Ich halte dich nicht, erwiderte sie.
Ich kann nicht. Ich kann nicht, stöhnte ich auf. Ich habe alle Brücken hinter mir abgebrochen.
Wenn es so ist, sagte Amanda, dann weine noch eine Weile, schmücke mein Bild mit Blumen. Trauere um mich wie um eine Tote. Denn ich bin nun für dich wie tot. Zünde zwei Kerzen an. Spiele die Platte, du weißt schon welche. Und wenn der Schmerz dir nicht mehr wie ein Messer deine Seele durchschneidet, beginnst du ein neues Leben. Mit einer anderen. Weiber gibt es unzählige, sie warten nur darauf, dass man sie entdeckt.
Aber wie, Amanda, wie entdeckt man sie?
Wie habe ich dich entdeckt, meine kleine Rosalia?
Du bist mir die Straße nachgelaufen wie ein Mann. Ich kann das nicht. Nein, ich will es auch nicht. Ich will dich, nur dich.
Du machst mich langsam ungeduldig, entgegnete Amanda. Wie gesagt, ich hasse Szenen.
Aber ich bin doch so traurig.
Geh jetzt, meine Liebe. Du möchtest doch, dass ich dich in guter Erinnerung behalte. Wir wollen einen würdigen Abschied. Oder?
Amanda, Amanda, schrie ich, warf mich vor ihr nieder.
Nein, nein, so geht es nicht, sagte Amanda. Meinetwegen bleib noch eine Weile in meiner Wohnung, während ich einkaufen gehe. Weil ich Mitleid habe, dein weiches Herz kenne und dir immer noch zugetan bin, gebe ich dir zudem einen letzten Rat: Lass die Weiber nicht bequem werden. Sorge dafür, dass sie in der Liebe fleißig sind. Denn von Natur aus sind sie keineswegs fleißig. Verwöhne sie nicht, lass dich verwöhnen. Nur so kannst du glücklich werden. Das ist meine Erfahrung und dass ich sie dir mitteile, ist mein letztes Geschenk an dich. Nun, Rosalia, ich gehe. Und sei so gut, kühle im Bad dein Gesicht, schmink dich. Es ist mir nicht recht, wenn man sieht, weinende Weibsbilder verlassen meine Wohnung. Ich bin Mitglied der Hausgemeinschaftsleitung, genieße Achtung unter den Mitbewohnern. Unsere Hausgemeinschaft funktioniert. Hier ist es nicht wie anderswo. Man kümmert sich umeinander. Also, kühle dein Gesicht und geh! Amanda gab mir einen letzten leichten Kuss auf die Wange, nahm ihre Einkaufsbeutel und verschwand aus meinem Leben und ich kurz darauf aus ihrer Wohnung.
Ich weiß nicht, wie viele Monate ich gebraucht habe, um mich im Alltag wieder zurechtzufinden. Meine Ehe wurde geschieden. Die Kinder blieben bei meinem Mann. Sie wollten es so, und ich war zu kraftlos, es ihnen auszureden. Da ich zudem versucht hatte, aus dem Leben zu scheiden, ohne dass dies ein Gott oder Schicksal beschlossen hatten, war das Gericht der Meinung, mein Sohn und meine Tochter seien bei ihrem Vater besser aufgehoben.
Ich trauerte um Amanda auf die Weise, auf die sie es mir geraten hatte, verdunkelte mein Zimmer, schmückte ihr Bild mit Blumen, zündete Kerzen an, zwang mich die Lieder zu hören, die mich an unsere Liebe erinnerten. Und eines Tages konnte ich die Größe sehen, die in ihrem Abschied gelegen hatte: Wo keine Liebe mehr ist, soll auch kein Mitleid sein.
Zwei Jahre lebte ich noch in meiner Familie, denn eine eigene Wohnung zu bekommen, war äußerst schwierig, obwohl ich all meine Beziehungen aufbot. Mein Mann erwies sich mehr und mehr seinen Aufgaben als alleinerziehender Vater gewachsen. Anfangs sagte ich ihm, was einzukaufen, worauf bei den Kindern zu achten sei, dass sie Pflichten hätten, er sie zur Erledigung der häuslichen Arbeit heranziehen könne und müsse. Ich unterwies meinen Mann und meinen Sohn - er ist der bei Weitem ältere meiner beiden Kinder - darin, wie man einfache Gerichte zubereitet. Allmählich zog ich mich aus der Verantwortung zurück, denn ich sagte mir, meine einzige Aufgabe bestehe nunmehr darin, mich überflüssig zu machen. Tut, als sei ich nicht da! So ermahnte ich meine Familie, wenn sie in alte Gewohnheiten zurückfallen wollten. Meine Kinder konnten sich in die neuen Verhältnisse nicht fügen. Aber du bist doch da, Mami, du bist doch immer noch unsere Mami!, redeten sie auf mich ein. Es fiel mir schwer, der Versuchung zu widerstehen, denn ich liebe meine Kinder. Aber da sie sich für den Vater entschieden hatten, mussten sie sich von mir lösen. Ihr Vater drängte mich zu nichts. Er ist ein weichherziger, liebevoller Mensch, der für alles, was in seinem Leben nicht glückt, die Schuld bei sich sucht. Er sang meiner Tochter abends die Lieder, die ich ihr gesungen hatte. Ich stopfte Ohropax in meine Ohren, denn es tat meinem Herzen weh. Er begann am Kochen Vergnügen zu finden, was mir mein Lebtag versagt geblieben ist, studierte Kochbücher. Das wurde zu jener Zeit Mode. Denn auch meine männlichen Kollegen in der Deutschen Galerie begannen sich für Rezepte zu interessieren und sonntags oder am Sonnabendabend ihre Frauen aus den Küchen zu vertreiben. Interessanterweise nahmen sie sich der Zubereitung einfacher Gerichte in der Woche allerdings nicht an. Diese - eher untergeordnete Tätigkeit - überließen sie weiter den Frauen. Ich glaubte, dass die Männer ihre Lust am Kochen entdeckten, weil ihre Heimwerkertätigkeit sie nicht mehr ausfüllte und es sie nach weiterer Bestätigung durch die Familie verlangte, nachdem Bestätigung im Beruf ihre Grenzen hatte, das Oben und Unten wohl geordnet war. Das Kochen wurde, so bestätigte mir auch mein Mann, eine regelrechte Sucht in der Männerwelt. Montags standen sie beieinander und berichteten darüber, was bei der Zubereitung dieses und jenes Gerichts zu beachten sei, das sie am Wochenende ausprobiert hatten, versuchten sich an Beschreibungen der Gaumenfreuden, die sie sich und ihrer Familie hatten zuteil werden lassen. Möglicherweise aber lag eine Ursache des plötzlich aufkommenden Interesses für die Kochkunst darin, dass wir in dem offiziell verkündeten Stadium des entwickelten Sozialismus schon nach Verfeinerung der Genüsse hungerten. Vielleicht war es als Zeichen der Dekadenz zu werten, des zunehmenden Verfalls der Gesellschaft. Wir Frauen lachten über die kindliche Freude der Männer. Mein Geschiedener lud mich zu Spezialitäten ein. Mittlerweile gab es auch Läden, in denen man besondere Gewürze kaufen konnte. Mein Geschiedener spendierte auch den Wein. Du musst sparen, sagte er mitleidig. Denn du fängst ganz neu an, als wärst du gerade mit dem Studium fertig geworden.
Du warst ein guter Ehemann, sagte ich. Und du bist ein noch besserer geworden. Deine spätere Frau wird von jeder anderen beneidet werden.
Aber warum kannst nicht du bei uns bleiben, Gisela, erwiderte er.
Ich kann nicht. Ich habe mich entschieden.
Was habe ich falsch gemacht? Er sah mich aus seinen engstehenden dunklen Augen an. Ich war ganz unglücklich, dass es ausgerechnet ihn treffen musste, den gewiss besten aller Ehemänner, sieht man einmal davon ab, dass er in der Liebe etwas unbeholfen war.
Nichts hast du falsch gemacht. Es ist Schicksal, sagte ich.
Diese Schlampe, diese Hure, dieses verfluchte Weibsbild.
Wäre es dir lieber gewesen, es wäre ein Mann gewesen?, fragte ich.
Er dachte nach. Einem Mann gönne ich dich noch weniger, war seine Antwort.
Meinem Mann ließ mein Verhältnis zu Amanda keine Ruhe. Als er etwas gefestigt war, stellte er Fragen. Nun sag einmal, wie tut ihr es denn eigentlich? Hat sie den Mann gespielt? Aber ihr fehlt doch das Entscheidende! Oder macht sie es mit einem Gerät?
Ich lachte über seine Einfalt. Wir Frauen hassen Frauen, die wie Männer sind. Nichts ist uns mehr zuwider. Schon die, die sich wie Männer bewegen und sprechen, haben kaum eine Chance bei uns.
Aber wie tut ihr's dann?
Wozu haben wir unsere Hände, unseren Mund.
Das reicht dir?
Vollkommen.
Aber ich habe doch auch Hände, einen Mund.
Du hast nie viel damit angefangen, mein Lieber.
Ich sollte es vielleicht?
Du würdest jede Frau glücklich machen.
Aber wenn ich doch Hände, einen Mund habe, warum bleibst du nicht bei mir?
Ich kann nicht. Ich will nun Frauen haben.
Aber eine spielt den Mann. So ist es trotzdem!
Wir spielen allerhand, aber nicht den Mann. Da kannst du sicher sein. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Obwohl mir Amanda nie gestattet hat, sie anzurühren, wahrscheinlich, weil sie keine Lust hatte, eine Lehrmeisterin zu sein, sprach ich so zu meinem Mann, denn alles musste er nicht wissen.
Gegenseitig. Das ist nicht so übel.
Das sollte immer so sein, sagte ich. Auch zwischen Mann und Frau.
Ich bedauerte schon, dass mein Mann nicht eine Frau war.
Endlich bekam ich eine moderne Appartement-Wohnung. Man wollte mir eine ganz außerhalb der Stadt geben, in einem der Neubaugebiete wie Marzahn oder Hellersdorf. Da ich Fahrzeiten von vielleicht einer Stunde und dazu einen langen Fußweg hätte in Kauf nehmen müssen, protestierte ich so energisch, dass man einlenkte und ich in der Nähe vom Ostkreuz eine Zuweisung erhielt. Ich bestellte einen Gütertransport für das Wenige, das ich mitnahm. Es war eine schöne Zeit mit euch, ihr Kinder, sagte ich zu meinem großen Sohn, meiner kleinen Tochter. Aber nichts währt ewig. Ihr geht ohnehin eines Tages aus dem Haus. Jetzt gehe ich vor euch. Lasst es euch nicht einfallen, mich so bald zu besuchen. Ich will selbständig werden. Und ihr sollt mir darin nacheifern. Nichts ist verächtlicher als willenlose, tatenschwache Menschen, die einer Entscheidung keine Taten folgen lassen. Und du, mein lieber Mann, suche dir eine liebe, hübsche Frau und erinnere dich meiner Worte, die Liebe betreffend. Dann wird alles zum Guten ausschlagen. So redete ich und brach mit meiner Familie, ihr und mir zum Besten.
Es bedurfte einiger Anstrengung, dass meine Wohnung nicht aufs Haar denen meiner Nachbarn glich. Ich bin empfänglich für den Reiz von Neubauten. Puppenhäuser, in der Nacht erleuchtet. Hübsch ist es, hineinzusehen: die Schrankwände frisch aus dem Warenhaus, nur die Menschen darin einmalig. Ich war mir offenbar meiner Einmaligkeit nicht so sicher, so dass ich schweren Herzens auf die gängige und überaus praktische Anbauwand und die Couchgarnitur verzichtete, mit deren Anschaffung ich mit einem Schlag alle Einrichtungsprobleme gelöst hätte. Ich bin handwerklich geschickt. Dank der polytechnischen Ausbildung, die wir an den Schulen erhielten, scheue ich keine Arbeit. Und so baute ich mit Hilfe von Stangen bis zur Decke hinauf und Brettern ein Regal, das die Schrankwand ersetzte.
Ich kaufte über Annonce einige wenige alte Möbel, ließ mir Gardinen für die Fensterfront anfertigen, den Zementboden mit Teppichware auslegen.
Als ersten Gast lud ich meine Kollegin Ute in mein neues Heim. Sie kam an mit Blumen, einem selbstgebackenen Kuchen und strahlte. Wenn sie nur einen Grund finden kann und sei es den einer überraschenden Begegnung oder der Freude auf einen Besuch, kann sie nicht anders als lächeln, ja strahlen wie ein Morgen- oder - noch besser - Abendstern.
Ich habe dich nie verstanden, ein so freundlicher Mann, so nette Kinder, sagte sie. Von Taktgefühl ließ sich Ute kaum leiten, jedenfalls mir gegenüber nicht. Sie liebte es, mich zu zausen, wenn auch leider nur im übertragenen Sinn, und mir ihre Gedanken freimütig mitzuteilen.
Als sie in die Deutsche Galerie kam, den Platz am Schreibtisch in der Bibliothek einnahm, den ich Jahre innegehabt hatte, hielt ich sie für nicht mehr als ein nettes Blondchen, eben sehr jung noch. Ich änderte meine Meinung, als ich beobachtete, wie sie in aller Freundlichkeit beharrlich ihren Standpunkt verfocht und sich auch auf Sophistereien verlegte, um formal recht zu behalten. Aber nicht das stimmte mich in ihrer Beurteilung um, auch nicht, dass sie grundsätzlich einen anderen Standpunkt als ihr Gesprächspartner verfocht, sondern ihr Lachen nach einem solchen Streitgespräch. Oder es ist auch ganz anders!, sagte sie abschließend mit unschuldigem Gesicht. Anscheinend nahm sie weder sich noch andere ernst oder nur bis zu einem gewissen Grade, worüber ich mich wegen der Wirkung auf andere besorgte, die von solch Tändelei nichts hielten. Doch ich hatte keinen Grund. Sie konnte ihrem Gesicht immer die Ernsthaftigkeit, ja Strenge geben, wenn sich jemand auf ihr Spiel nicht einließ. Ja, sie konnte sogar gläubig schauen, ihr blondes Gesicht noch blonder, wenn sie dies für angebracht hielt. Ohne dass sie glaubte, wie sie mich hinterher lachend wissen ließ. Du spielst, sagte ich einmal verärgert. Nein, das nicht, antwortete sie. In dem Augenblick fühle ich so.
Unsere kleine Gewerkschaftsgruppe durfte sich Bereich der vorbildlichen Ordnung und Sicherheit nennen. Eines Tages würden wir vielleicht auch in den Stand eines Kollektivs der sozialistischen Arbeit erhoben. Alte Konkurrenz war abgeschafft, doch wir befanden uns allenthalben im Wettstreit mit uns selbst, in sozialistischem Wettbewerb. Angestrebt war, dass wir nicht nur sozialistisch arbeiteten, sondern auch sozialistisch lebten. Wir hatten Geselligkeit miteinander zu pflegen, machten - nicht ganz zu unserem Missvergnügen - Betriebsausflüge, feierten gebührend Geburtstage und veranstalteten Jahresendfeiern, zu denen man sich langsam wieder Weihnachtsfeier zu sagen getraute, Frauentagsfeiern, zu denen wir auch die von uns erwählte Partnerbrigade aus der Produktion einluden, Bäckerinnen und Bäcker aus dem Backwarenkombinat Bako, und selbstverständlich - soweit vorhanden - die Ehegatten. Bei einer solchen Festlichkeit geschah es, dass Ute die um Teile der Arbeiterschaft erweiterte Runde unterhielt, das Gesicht vom Wein gerötet wie ein Jonathan-Apfel, stark gestikulierend in gefährlicher Nähe zu den Gläsern, so dass die Kollegen die vorsorglich beiseite nahmen. Ein Scherz folgte dem nächsten, wobei sie abwechselnd unglaubhafte Komplimente machte, die man doch ein wenig ernst nahm, und kleine Unverschämtheiten von sich gab, die selbst den erheiterten, den es betraf. Niemand erkannte in ihr die nette, stille Kollegin wieder, als die sie sonst erschien. Vollends verdutzt waren wir Damen, als sie unseren Direktor zum Tanz aufforderte. Und dann tanzte sie, als beobachte sie niemand und als sei das Tanzen nichts Geselliges, sondern eine Sache ganz für sie allein. Da war es um meine Fassung geschehen. Heiß wurde mir. Ich versuchte mich abzulenken, musste aber immer wieder zu ihr schauen, die auf der Tanzfläche blieb. Dann führte sie unsere Damen und Herren wie eine Tanzlehrerin auf die kleine Fläche, forderte schließlich einen uns verbundenen Arbeiter vom Backwarenkombinat auf, von dem sie nach einer gewissen Zeit eine Dame erbat, indem sie artig wie eine Muslimin die Hände zusammenlegte, so dass die Frau sich lächelnd erhob. Niemals zuvor hatten wir Frauen es fertiggebracht, die Männer von ihren zu jeder Zeit furchtbar ernsthaften Gesprächen weg auf das Tanzparkett zu bringen. Sie hat zu viel getrunken, sagten die Frauen am nächsten Tag und waren zum Verzeihen geneigt. Ich aber sah: Dies war ihre eigentliche Natur. Ein Puck, ein Kobold war sie, liebesfähig und -lustig und imstande, Männer wie Frauen zu betören. Die Schüchternheit, die sie sonst an den Tag legte, war nichts als Tarnung. Obwohl sie das heftig bestritt. Ich bin wirklich unsicher, etwas schüchtern, sagte sie. Aber ich bin es nicht nur. Das gibt es doch, dass jemand zum Beispiel feige ist und mutig. - Wieder eine deiner Spitzfindigkeiten, sagte ich. - Wenn es dir hilft, dann glaube, dass ich nicht schüchtern bin, sagte sie bereitwillig. Mir hilft es übrigens auch, wenn du das glaubst. Einmal stritt sie sich nicht bis zum Letzten, um sich nach ihrem Sieg lustig zu machen. Wie ich auch schon an ihr beobachtet hatte, gab sie recht, rechnete man auf Widerspruch. Ich begann mich wegen aufkommender Gefühle zu kontrollieren. Ganz gut kann man ihrem Gesicht ablesen, was sie denkt, wenn sie sich nicht ausdrücklich zusammennimmt. Ich war sicher, sie ahnte nichts von den mir lästigen wie süßen Gefühlen. Eine Freundschaft bahnte sich an. Mehrmals besuchte sie mich und verliebte sich sofort in meinen Mann, meine Kinder.
Und nun, was nun?, fragte sie, als sei sie die Ältere, für mich verantwortlich und ich ihr Rechenschaft schuldig.
Ich habe noch Wünsche, sagte ich.
Das ist gut. Du bist vierzig, aber du siehst jünger aus. Bestimmt.
Der Trost war unnötig. Aber ich sagte mir, dass ich in Utes Alter eine Frau mit vierzig ebenfalls für relativ chancenlos gehalten hätte, und vergab ihr.
Da muss man was tun, sagte sie.
Gewiss tue ich etwas.
Dann ist es ja gut. Und wenn was Nettes dabei ist und nicht für dich geeignet, ich könnte mich ja auch noch mal für mich selbst umschauen.
Lieber Schatz, dachte ich, du weißt nicht, was du sagst.
Ute, dieses wunderbare Geschöpf, das zur Liebe und zum Glück wie gemacht scheint und nach dem Bild, was ich von ihr habe, sich alles vom Leibe halten müsste, was beidem zuwiderläuft, war mit einem verheirateten Mann liiert und lebte infolgedessen in wenig glücklichen Verhältnissen, was ich nicht verstand und nie verstehen werde. Doch mir war die unentschiedene Situation recht, denn so hatte sie viel Zeit für eine Freundin.
Ute hatte ich es angedeutet: Die Umstände waren so weit gediehen, dass ich nach einer Gefährtin Ausschau halten durfte. Mein interessantes Äußeres, rote lange Naturlocken, braune Augen, mein jugendlicher, blasser Teint, meine ausgezeichnete sportliche Figur und nicht zuletzt mein Beruf als promovierte Kunsthistorikern ließen mich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Ich könnte alle Frauen haben, hatte Amanda gesagt. Aber ich wollte mich mit einer einzigen bescheiden.
Ich machte mich auf, ein Inserat in der republikweit erscheinenden Zeitschrift Wochenpost aufzugeben und erfuhr, dass im Annoncenteil die Rubrik Bekanntschaften von der Obrigkeit der Zeitungen gerade nicht erwünscht war. Ich denke mir, man sah sie als wenig familienförderlich an. Doch Verbote wie auch Einschränkungen, bedingt durch Materialknappheit oder auch das leidige Handelsembargo, waren ja nur die Aufforderung, einen anderen Weg für das Erreichen seines Ziels zu ersinnen. Und so war jene Zeit der Verbote und Einschränkungen auch eine höchst schöpferische und wirkte sich möglicherweise ungewollt stimulierend auf die Herausbildung des von der Obrigkeit geforderten schöpferischen, allseits gebildeten Menschen aus. Versuchen Sie es doch unter Verschiedenes, riet mir die ältere Dame am Schalter mit verständnisinnigem Blick. Ich war froh und gleichzeitig besorgt, sie selbst könnte sich unter die Bewerberinnen reihen.
Meine Interessen und meine Person hatte ich vorzüglich beschrieben. Nur in einem Punkt wahrte ich Zurückhaltung. Ich ließ nicht verlautbaren, ob ich den Kontakt von männlichen oder weiblichen Personen bevorzugte. Ich abonnierte die Zeitschrift, um nach meinen und auch anderen Kontakt-Wünschen zu fahnden. Übrigens fand ich damals trotz der Berliner Zeitung und des ND, den obligatorischen Tageszeitungen, und der Wochenpost meinen Briefkasten stets nur halb gefüllt, während ich heute meine Zeitung am Stand kaufe aus Sorge, mein Briefkasten könne einen solchen Packen aufgeschwollener Zeitungen nicht fassen, zu allem anderen Papier, das ich ungefragt als Postwurfsendung oder adressiert bekomme. Damals war die Zeit der Papier- und Informationsknappheit. Der Mangel glich sich insofern etwas aus, als die Bevölkerung das zur Verfügung stehende Material verdoppelte, indem sie nicht nur die Zeilen, sondern auch zwischen den Zeilen las.
Nach sechs, acht Wochen erschien meine Annonce. Ich wartete einige Tage. Dann fragte ich nach. Haben Sie eine Tasche mitgebracht?, fragte eine junge Angestellte. Gott sei Dank war die ältere im Hintergrund beschäftigt. Ich hatte einen Einkauf vorgehabt. Den musste ich verschieben. Die Angestellte riet mir, noch einige Male wiederzukommen, da Post gewöhnlich noch bis zu zwei Wochen nach Erscheinen der Zeitschrift einträfe. In den folgenden Tagen verwandelte sich meine kleine Wohnung in eine Wüstenei. Briefe in Haufen je nachdem, wie ansprechend ich sie fand. Die in die nähere Wahl kamen, auf den Stühlen, dem Tisch, dem Fußboden verteilt. Ich schlief von Nacht zu Nacht schlechter, hatte Träume, in denen mich Frauen in Scharen umringten, alle mit derselben dringlichen, wenn auch lautlosen Frage auf den Lippen. Oder eine einzige Frau tauchte auf, mich an mein angebliches Versprechen erinnernd. Ich flüchtete schreckvoll, denn mir war klar, dass ich genau die gewählt hatte, mit der ich nicht leben wollte.
Dir geht es schlecht!, sagte Ute, mein Blondgesicht. Inzwischen hatte sie ihren Platz in der Bibliothek einem jungen Mann geräumt und war in ein Kämmerchen neben meinem Gewölbe, einem großen Durchgangszimmer, gezogen und hatte es damit trotz offenbaren Aufstiegs in der Hierarchie räumlich schlechter getroffen. Denn wenn sie nicht die Tür zu meinem Zimmer öffnete, war sie wie abgeschnitten von der Welt, im Souterrain wie wir alle, das Fenster vergittert und keinerlei Aussicht, während ich den Blick auf ein bisschen Grün vor meinem Fenster und auf den weiten Hof genoss, nachdem ich den Schock dieses Perspektivenwechsels von oben nach unten überwunden hatte. (Ehe ich mich für die Deutsche Galerie mit der Hoffnung auf Verbesserung beworben hatte, war ich in einem Dachgeschoss des Kunstgewerbemuseums beheimatet gewesen. Lange hatte ich das Gefühl, von meinem hübschen Dachfenster aufgestiegen zu sein, um mit einem Sturzflug im Keller zu landen.) Um einen Flucht- und Zugangsweg in unsere kleine Welt zu haben, ließ Ute ständig die Tür zu meinem Zimmer offen, was mir gefiel. Bei einer anderen Kollegin als Ute hätte ich mich allerdings belästigt gefühlt. So nahe bei mir Tag für Tag, entging ihr keine meiner Stimmungen.
Ich widersprach. Nein, überhaupt nicht, sagte ich.
Die Trennung von deiner Familie tut dir nicht gut.
Ja, könnte sein, sagte ich, erleichtert, dass Utes Gedanken die falsche Richtung nahmen. Ich hab mir eine kleine Schlafstörung eingehandelt, das ist alles, sagte ich. Wenn du so nett sein könntest, mich an diesem Wochenende nicht zu besuchen, ich brauche meine Ruhe! Ute hatte es sich angewöhnt, mich am Sonntagnachmittag zu besuchen. Wie gesagt, ihr Freund verheiratet, so dass er sich an den Wochenenden in die Wonnen des Familienlebens begab und Ute nicht benötigte. Doch solange ich die Post von Bewerberinnen ordnete, durfte ich sie aus verständlichen Gründen nicht zu mir lassen.
Am Sonntag vermisste ich meinen blonden Engel, ging mit desto größerer Entschlossenheit vor und fällte gewaltsam Entscheidungen. Doch kaum hatte ich eine Auswahl getroffen, überschütteten mich nochmal dreißig bis vierzig Bewerberinnen mit Angeboten. Ich bekam Fieber, war nicht mehr in der Lage zu arbeiten, schleppte mich zu einer Telefonzelle und rief Ute auf der Arbeit an, um mich zu entschuldigen, verbat mir aber vorsichtshalber von vornherein einen zu jener Zeit üblichen Krankenbesuch, als Geste des Gemeinsinns gedacht, vielleicht auch in der Arbeiterschaft als sanfte Kontrolle. Kollegen - noch dazu alleinstehenden - sollten sich eins mit den Arbeitenden wissen, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen von ihnen getrennt waren.
Ich darf auch nicht kommen?, fragte Ute.
Ich brauche Ruhe. Nichts als Ruhe. Der sterbende Elefant zieht sich in den Urwald zurück.
Stille am Ende der Leitung.
Ich sterbe doch nicht, sagte ich mit matter Stimme. Das Stehen in der Telefonzelle strengte mich an. Noch hatte ich nur beste Aussichten auf einen Telefonanschluss. Ich wandelte, vom Fieber wie im Nebel umfangen, in die Kaufhalle, um Notwendigstes für meine Versorgung in den nächsten Tagen einzukaufen. Dann legte ich mich. Mädchen erschienen, mich im Reigen um tanzend, mich einkreisend. Näher kommend verwandelten sie sich in Vetteln mit grässlichsten Gesichtern, wie sie auf Gemälden von Bosch oder Brueghel und Franz Hals vorkommen. Ihren Umarmungen konnte ich mich nur durch verzweifelte Gewaltschläge entziehen, für die man im Traum mitunter ja große Energien zur Verfügung hat.
Wie von ferne hörte ich ein Klingeln. Ich wankte zur Tür, öffnete. Ute stand vor mir, sah mich an mit großen Augen, hatte Blumen mitgebracht und in einem Beutel Lebensmittel. Schließlich sind wir doch befreundet, sagte sie. Und du bist zum ersten Mal allein.
Ich hatte nicht die Kraft, sie abzuweisen, legte mich einfach wieder ins Bett und schloss die Augen. Vielleicht ließ sie mich in Ruhe, übersah das heillose Durcheinander. Ich koch dir was, schlug sie vor.
Eine Suppe, eine Tütensuppe höchstens!, sagte ich in klagendem Ton. Ich hab keinen Appetit. Sie machte sich in der Kochnische zu schaffen, ich bekam meinen Teller ans Bett gebracht und löffelte. Schlimm siehst du aus, sagte sie. Und erst deine Wohnung. Hast du einen Postsack geklaut?
Annoncen, seufzte ich.
So viel?
Ich nickte.
Du hast Chancen!, sagte sie.
Ich lächelte dümmlich vor mich hin.
Kann ich mal sehen?
Mein Protestschrei blieb in heiserer Kehle stecken. Ich stürzte mich aus dem Bett. Zu spät. Ute hatte den ersten Brief in der Hand. Die traut sich ja was, sagte sie. Ich hab nicht unter Heiraten weiblich annonciert!, flüsterte ich.
Vernünftig. Wer will auch gleich heiraten.
Ute, fröhlich, furchtbar gesund und nichtsahnend, griff nach weiterer Post. Ich legte mich in mein Bett, zog wie ein kleines Kind die Bettdecke über mich und wollte von ihr und der Welt nichts mehr wissen.
Nach einer Weile duselte ich ein in der Vermutung, ich hätte wieder einen Alptraum gehabt. Als ich erwachte, hatte es sich mein Alptraum auf meinem Lehnstuhl bequem gemacht, um ihn herum lagen Briefe stoßweise.
Die Situation hat dich völlig überfordert, sagte Ute. Am besten, ich erledige das für dich.
Wenn du das könntest?, flüsterte ich willenlos und glücklich.
Ich geh nach der Handschrift, nach der Farbe der Tinte, rot und grün scheiden aus, findest du doch auch? Ausdruck, Interessen sind noch wichtig.
Aber dass du mir keine hässliche andrehst!
Die sind alle schön. Behaupten sie wenigstens. Nächstes Mal bittest du um Fotos.
Geht nicht. Und findest du es nicht furchtbar?
Was?
Dass ich Frauen ... dass ich von Frauen Post bekomme.
Na ja. Du hast Pech gehabt und willst was ausprobieren.
Ich hab's schon ausprobiert.
Utes Stirn legte sich in Falten, was sie lehrerinnenhaft streng aussehen ließ.
Jetzt willst du nichts mehr mit mir zu tun haben!, klagte ich.
Halt den Mund, sagte sie. Reden kannst du heute sowieso nicht mehr, fügte sie freundlicher hinzu. Ich erledige das für dich. Hab ich gesagt, mach ich auch. Du ruinierst dich sonst schon vorher.
Was soll das heißen?, wollte ich fragen. Doch auch das Flüstern gelang nicht mehr.
Ute kam jeden Abend vorbei. Und nach gründlicher Sichtung aller Post fiel ihre Wahl auf eine Ärztin. Möglicherweise erhoffte sie für sich und mich von einer medizinischen Fachkraft Beistand in allen Notlagen.
Wie alt?, fragte ich. Sie sagte es. Nein, Ute, protestierte ich. Sie soll jünger sein.
Sie hat eine sehr sympathische Handschrift, beharrte Ute. Sie ist Akademikerin, schlank, attraktiv.
Du sagst, das sind alle.
Die ist es, die anderen sagen es bloß.
Woher weißt du das?
Gefühlssache. Und sie liebt klassische Musik. Du bist doch auch für klassische Musik. Du spielst sogar Klavier.
Ich habe Klavier gespielt! Ich habe!
Und dann dein Operntick, erinnerte sie. Deine Julia.
Hoffentlich liebt sie auch Opern. Und wenn sie sich für bildende Kunst gar nicht interessiert? Ich war schon auf dem Rückzug.
Die Frau ist es. Mosere nicht herum!, sagte Ute, meine gestrenge, jüngere Freundin. Sie schaffte alle übrigen Briefe papierkörbeweise in den Müllschlucker. Ich protestierte kaum, war zu schwach, um in ihren kurzen Abwesenheiten noch einige Briefe zu grapschen für den Eventualfall. Heilfroh, dass Ute meine Vorliebe für Frauen so kommentarlos hingenommen hatte, wollte ich gern eine zweite Annonce riskieren, wenn die Ärztin mir nicht gefiel oder ich ihr nicht, was ich fast ausschloss.
Die Alpträume wichen, nachdem Ute die Briefe entfernt hatte, mein Fieber sank noch am selben Tag. Als meine Stimme zurückgekehrt war, nahm ich meine Kräfte zusammen, ging zur nächsten funktionstüchtigen Telefonzelle. Nach mehreren Anrufen erreichte ich Hippokratia, wie ich sie in meinen Erinnerungen zu nennen pflege. Ich sagte ihr meinen Namen, meine Adresse, dass sie ein wenig Geduld haben möge. Ich habe gerade eine Grippe hinter mir, erklärte ich.
Ich auch, sagte Hippokratia. Es geht den Menschen wie den Leuten.
Dass auch Ärzte krank werden! Ein dummer Satz von mir, doch Hippokratia lachte.
Rufen Sie einfach wieder an, sagte meine zukünftig Einzige mit einer Entschiedenheit, die sicher von ihrem Arztberuf herrührte.
Ich hatte nun Zeit zu träumen, legte mir Platten mit Julia auf. Julia, die Unerreichbare, meine große, ferne Liebe, die mich in den langen Monaten nach der Trennung von Amanda und Scheidung von meinem Mann begleitet hatte. Bei einer Fernsehsendung war ich auf sie aufmerksam geworden. Seither bin ich ihr, ihrer Stimme, der Oper und allen Diven der Oper verfallen. Ich besitze sämtliche Platten mit Julia. Meine in Stuttgart lebende Patentante Hanna schickte sie mir willig zu Weihnachten und Geburtstagen statt der Kunstbände, die ich mir bisher gewünscht hatte. Außerdem habe ich Julias Fernseh- und Radioauftritte auf Kassetten mitgeschnitten. Ich hörte Julia und versank in einer Traumwelt, in der Julia auf mich, ihre Geliebte, immer nur auf mich, einsang. Ihre Stimme zart, innig, aufblühend der Ton. Dann wieder dunkel, verhalten, voller Schmelz, eindringlich. Sie erzählte leicht dahin, hielt plötzlich inne, wurde derb, breit, vulgär, schrie auf in tiefstem Frauenschmerz, um dann wieder einzulenken in süßestem Ton, meine Nachtigall. Schmal, fast stimmlos, dann wieder hell, dahinhüpfend in strahlender Eleganz, das Herz wird getroffen von großer Innigkeit oder von schmetternder Höhe. Chansonhaft schleifend ein französisches Lied, ein Lacher, frech, grell. Der leise, letzte Ton hauchend oder trotz aller Zurückgenommenheit klar, noch Stimme. Sie flüstert, sie singt überschnell dahin, jauchzend in einen Sommermorgen hinein, um sich dann als große Erzählerin zu zeigen, ein Riesenweib von alters her. Drohend, eine Megäre, furchteinflößend, schneidend, grell-böse. Und wieder singt sie in schnellem, tanzhaftem Rhythmus oder strahlend-sieghaft. Die Stimme kippt um und um, ein Jubeln, Tirilieren. Nur noch Ton, lang, hell zitternd, ein spiegelndes Schimmern auf den Wellen. Julia befand sich im Zwiegespräch mit dem Klavier, oder sie stand auf der Opernbühne in dieser und jener Rolle. Als Mann, als Mädchen, als reife Frau trat sie mir entgegen in vielerlei Gewandung. Ich liebte sie. Was hilft mir das Grasen, wenn d' Sichel nicht schneid't. was hilft mir ein Schätzel; wenn's bei mir nicht bleibt. So sagte sie mir in heller Einsicht. Und so sagte ich es mir auch und sah mich sitzen Hand in Hand mit Hippokratia, eingefangen von Julias Stimme. Das Herz tat uns weh von so viel Schönheit. Im wunderbaren Monat Mai, als alle Knospen sprangen, da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen...
An einem Sonntagnachmittag war es soweit. Wie vereinbart wartete ich vor dem Krankenhaus in Berlin-Friedrichshain, in dem Hippokratia als Anästhesistin in der Unfallchirurgie arbeitete. Der Nachmittag golden und still. Das Laub der Straßenbäume färbte sich. Gleich würde sie aus dem Gebäude treten, silberhaarig, der Teint besonders dunkel. Daran würde ich sie erkennen, hatte sie gesagt. Schwestern kamen schwatzend aus dem Krankenhaus, und dann - deutlich zu erkennen - die Ärzte. Einer trug noch eine weiße Hose. Blendend sah Hippokratia aus, schlank, doch nicht dünn, das Haar glatt, halblang, von wunderbarem Silber, der Teint südländisch dunkel, ebenmäßig, geradezu schön die Gesichtszüge. Es konnte einem angst werden. Ute, mein Herzblatt, wie recht hattest du gehabt! Mein Herz polterte stückweise tiefer, bis ich es ungefähr in Höhe meines unteren Blazerabschnitts zu packen bekam und mir in die Tasche steckte. Ein kurzer Blick von ihr. Auch sie hatte mich gesehen. Ich wartete ab, bis sich ihre Kollegen verabschiedet und entfernt hatten. Hallo!, sagte sie. Und ich hatte Gelegenheit, mich aus der Nähe davon zu überzeugen, dass sie so schön war, wie ich aus der Ferne vermutet hatte. Nicht langweilig schön, sondern eigenartig. Wir werden ja immer angezogen von dem, was wir selbst nicht haben, selbst nicht sind. Sie schien abgespannt. Hallo!, sagte auch ich und lächelte genau abgewogen, maßvoll zurück.
Ich habe Sie schon von oben gesehen.
Also war sie neugierig gewesen, natürlich. Die erste Prüfung hatte ich bestanden.
Wir könnten in eine Gaststätte gehen!, sagte sie. Aber ich weiß keine.
Ich auch nicht.
Vielleicht finden wir etwas auf der Schönhauser?
Wir stiegen in ihren Skoda ein. Ich bin müde, sagte sie nach einigem Fahren. Ich bin zu müde, um in eine Gaststätte zu gehen.
Nach dem anstrengenden Dienst, sagte ich verständnisvoll und dachte nicht daran, ihre Müdigkeit als Desinteresse zu werten.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie mit in meine Wohnung kommen.
Was will sie?, dachte ich eine Schrecksekunde lang.
Ich bin müde, todmüde, wiederholte sie. Es tut mir so leid.
Das braucht Ihnen nicht leid zu tun, versicherte ich. Mein Herz, wohl wieder am rechten Fleck, flatterte unruhig wie ein Vöglein im Käfig, sich dauernd an Gitterstäben stoßend.
In der Nähe der Schönhauser, in einer Straße nahe der Mauer, stiegen wir aus. Das Haus, in dem sie wohnte, von allen anderen unterschieden, im Jugendstil erbaut, mit Erkern, Grünspan auf Türmchen, dem Dach. Sie fuhr sich über das Gesicht, massierte kreisend die Schläfen. Mit einem Mal so ein Abfall. Ich hatte doch gehofft... Sie sprach nicht weiter. Im Treppenhaus Läufer ausgelegt, von Messingstangen gehalten. Sie ging voran, Treppen hinauf, blieb vor ihrer Wohnungstür stehen. Mein Herz begann zu rasen, vor Angst nun, die Hände pendelten, kalt schwitzend sie und ebenfalls die Stirn. Ich starrte Hippokratia an, keiner Rede mehr fähig. Schön war sie und klug dazu, denn sie bemerkte meine Pein. Ach, wir sollten es heute ganz lassen. Ich bin so müde, sagte sie.
Die Angst verging. Enttäuschung kam auf. Vielleicht ein andermal, sagte ich so beiläufig wie nur möglich.
Ganz sicher ein andermal, sagte sie.
Schon wollte ich mich zum Abschied wenden, knapp und ebenfalls sehr beiläufig. Eine Bitte hätte ich noch, sagte sie.
Ja?, meine frohlockende Antwort.
Könnten Sie noch warten, bis ich mich hingelegt habe und eingeschlafen bin?
Der Wunsch war für einen erwachsenen Menschen merkwürdig. Ich stimmte zu. Die Wohnung ungewöhnlich groß. Und nur eine Person wohnte darin! Hatte sie Mann und mehrere Kinder gründlich anästhesiert, geschickt und ohne juristische Folgen für sich, um allein zu sein? Denn war man erst eingesessen, interessierte sich das Wohnungsamt nicht mehr für die Quadratmeter, die man bewohnte. Die Räume hoch und auf das herrlichste mit antiken Möbeln eingerichtet, die man in den fünfziger Jahren noch preiswert bekam. Danach wurden sie von Jahr zu Jahr teurer und spärlicher. Die Menschen im Osten begannen sich zu interessieren und - wie man weiß - die im Westen auch, so dass eine Valutaeinnahme daraus wurde, denn an Devisen mangelte es dem Arbeiter-und-Bauern-Staat ja allenthalben. Ich hatte mich mit Fabrikware von 1910 und danach begnügen müssen. Meine Blicke schweiften. Ich vertiefte mich in den Anblick der kostbaren Stücke. Stunden hätte ich so sitzen mögen. Im Geist brachte ich schon meine Bibliothek und Plattensammlung unter. Hier könnte ich ungestört arbeiten. Und wenn Hippokratia nach einem Schlaf endlich erquickt und tatenmunter aufgewacht wäre, so wollte ich schon mit ihr tun, was sie wünschte. Hippokratia rief mich in ihr Schlafgemach. Sie lag in einem Bett, etwa so breit wie lang. Auf einer schön gearbeiteten Ablage neben dem Bett eine Flasche Wein und zwei Gläser. Sie schenkte ein, nahm meine Hand, streichelte sie ein wenig. Sie Kind!, sagte sie. Gleich fühlte ich mich so. Mit meinen vierzig Jahren hatte ich keine Erfahrungen außer der mit Amanda. Aber das konnte sich ja ändern, dachte ich froh. Mein Blick fiel auf Tablettenschächtelchen und -gläschen, mir wohl bekannt aus der Zeit nach der Trennung von Amanda. Sie langte nach einem. Flugs schaute ich nach der Aufschrift. Die Tabletten waren von der stärksten Sorte. Kein Arzt verschrieb sie. Hätte ich bei dem Versuch, mich aus der Welt zu schaffen, die zur Verfügung gehabt, säße ich wohl heute nicht bei Hippokratia, sondern womöglich auf einer Wolke und sähe von da aus sie wie viele andere Schöne im Schlafe liegen, ganz umsonst sich nach weiblicher Umarmung sehnend. Allerdings wären mir Wochen Therapie in der Klinik erspart geblieben, mit der Aufgabe zu lernen, dass das Leben sich immer noch lohnt. Warum es sich lohnt, konnte man mir allerdings nicht gut erklären. Gott sei Dank kam man nicht damit, dass man mich dringend zum Aufbau des Sozialismus benötige. Man brachte mir bei, dieser mein Schritt hätte nur verletzte Eitelkeit und das Verlangen nach Aufmerksamkeit zur Ursache. Obwohl Gedanken dieser Art meinem Herzen nicht zu Ohren gekommen waren, glaubte ich den Therapeuten damals und damit meiner wenig schmeichelhaften Motivlage. Sie waren es, die mich eine Abscheu vor Tabletten und jeglicher Droge gelehrt hatten. Und so schauderte es mich, als Hippokratia, die Schöne, unbedenklich davon nahm am hellen Tage, die Tabletten mit Wein hinunterschluckte. Ich hätte mir sagen können, sie sei kundig in Sachen Betäubung. Aber ich fürchtete für mich und mein in der Therapie neu erworbenes Leben und kam nicht auf den Gedanken, dass Menschen wie Hippokratia, denen verwehrt ist, in einem gleich ablaufenden Tagesrhythmus zu leben, ein Recht auf Schlaf haben, auch wenn er sich nicht mehr von allein einstellt. Sie bemerkte meinen entsetzten Blick, lächelte. Sie Kind!, sagte sie zum zweiten Mal. Ich saß an ihrem Bett wie vor einigen Zeiten noch an dem meiner kleinen Tochter, wartete, bis ich sie ruhig atmen hörte, ging leise durch die Wohnung, zog sacht die Tür hinter mir zu, wie sie es mir gesagt hatte. Tage später meldete sie sich am Telefon.
Bitte rufen Sie mich nicht mehr an!, sagte ich.
Schade! Sie Kind! Ich hörte es zum dritten und letzten Mal.