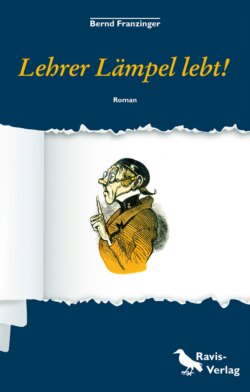Читать книгу Lehrer Lämpel lebt! - Bernd Franzinger - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Kapitel
ОглавлениеFüße – nass, kalt. Mehr brachte Lehrer Lämpels lahmes Hirn nach 150 Jahren Tiefschlaf nicht zustande.
Irgendwann verspürte er ein unerträgliches Kribbeln in seinen Füßen.
Maikäfer?, fragte er sich angewidert.
Vor seinem geistigen Auge tauchte Onkel Fritz auf, dem Max und Moritz gerade einen bösen Streich spielten.
Lämpel versuchte, seine Beine anzuheben, doch sie bewegten sich keinen Deut.
Wie bei Sokrates, sinnierte er, eingedenk seiner humanistischen Bildung. Nur eben umgekehrt. Bei Sokrates hat das Gift zuerst die Füße, dann die Beine und schließlich den gesamten Körper gelähmt. Aber ich werde anscheinend von unten nach oben entlähmt.
Entlähmt? Welch barer Unsinn! Die deutsche Sprache kennt dieses Wort nicht. Das sollte Lehrer Lämpel leichthin wissen! Mir scheint, ich bin noch nicht recht bei Sinnen.
Wo befinde ich mich eigentlich?
Er hielt den Atem an und horchte angestrengt. Um ihn herum war es still, totenstill.
Liege ich etwa in einem Sarg, tief verborgen in der Mutter Erde feuchtem Schoß?
Plötzlich zuckte es in seinem linken Daumen. Nach und nach kehrte das Leben in jeden einzelnen Finger zurück. Er drückte die Knöchel nach oben und zog die Fingerkuppen zur Handwurzel. Der Untergrund war kalt und glitschig.
Eis und Tauwasser?, grübelte er.
Lämpel schob die Hände nach außen. Die Finger ertasteten senkrechte, eisige Wände.
Ich liege in einem frostigen Grab, aus dem ich nicht entfliehen kann. Nie mehr werde ich die Sonne sehen, jammerte er in Gedanken.
Panik erfasste ihn. Sein Körper verkrampfte sich und die Lippen zuckten wild. Er versuchte zu schreien, brachte jedoch nur ein ersticktes Krächzen hervor. Blinzelnd öffnete er die Augen.
Nichts als rabenschwarze Dunkelheit, stellte er resigniert fest.
Lämpel seufzte tief.
Ist ja auch kein Wunder, wenn man sich in einem Sarg befindet.
Er stieß ein grunzendes Geräusch aus, das jedem Wildschwein zur Ehre gereicht hätte.
Wieso liege ich eigentlich in einem Gletschergrab und nicht zu Hause in meinem warmen Bett?
Ein dezentes Schmunzeln huschte über sein Gesicht.
Wahrscheinlich bin ich ja dort und träume alles nur.
Erleichtert schlummerte er ein.
Viele Stunden später erwachte er mit hämmernden Kopfschmerzen. Er drückte die eiskalten Fingerspitzen auf die Schläfen und massierte sie. Das half ein wenig. Als er die Hände herabsinken ließ, klatschen sie ins Wasser. Frostige Schauer jagten seinen Rücken hinunter.
Um Himmels Willen, das Eis taut! Ich werde ertrinken!, pochte es unter seiner Schädeldecke.
Lämpel streckte die Arme nach oben. Die Fingerspitzen stießen auf einen Widerstand. Wie Stützpfeiler schob er beide Hände unter die eisige Platte und presste fest dagegen. Mit einem schmatzenden Geräusch schnellte der Sargdeckel zwanzig Zentimeter in die Höhe. Doch gleich darauf fiel er zurück auf die Handflächen.
Da ein Schulmeister selbst in Extremsituationen nicht von humanistischen Bildungsgütern verschont bleibt, dachte er unweigerlich an Atlas, den Zeus als Strafe für seine Teilnahme am Kampf der Titanen gegen die Götter dazu verdammt hatte, für alle Zeit den Himmel auf seinen Schultern zu tragen.
Aber du, mein lieber Lehrer Lämpel, sollst nicht bestraft, sondern belohnt werden, ertönte plötzlich eine tiefe Männerstimme in seinem Kopf.
»Wofür?«
Für den vorbildlichen Einsatz, den du vor 150 Jahren in deiner Schule geleistet hast.
»Womit soll ich belohnt werden?«
Mit nichts Geringerem als einem neuen Leben, antwortete die geisterhafte Stimme.
»Danke.«
Keine Ursache. Allerdings hat die Sache einen Haken.
»Und welchen?«
Du musst einen Auftrag erfüllen.
»Und welchen?«, fragte Lämpel noch einmal.
Du sollst die Schulen des 21. Jahrhunderts inspizieren und mir ausführlich darüber Bericht erstatten.
»Und wie soll ich das machen? Ich meine …«
Um die Übermittlung deiner Beobachtungsergebnisse musst du dich nicht kümmern, unterbrach die Stimme.
Du gehst einfach in die Schulen und schaust sie dir genau an. Außerdem redest du mit allen, die etwas mit dem modernen Bildungswesen zu tun haben, also mit Lehrern, Schülern, Eltern, Ministerialbeamten et cetera. Anschließend ordnest du deine Gedanken, indem du diese Beobachtungen feinsäuberlich in einem Tagebuch notierst.
»Und das bringe ich dir dann.«
Nein, das brauchst du nicht. Jedenfalls noch nicht.
»Wieso?«
Weil es mir vorläufig reicht, deine Gedanken zu lesen.
»Das kannst du?«
Sicher.
»Dann musst du Gott sein.«
Ein sonores Lachen dröhnte in Lämpels Kopf. Nein, der bin ich nicht.
»Wer bist du dann?«
Wilhelm Busch.
»Ach so«, murmelte Lämpel enttäuscht.
Was in deinem speziellen Fall wohl auf dasselbe hinauslaufen dürfte, gab die Männerstimme pikiert zurück.
Denn ich habe dafür gesorgt, dass du wieder zum Leben erweckt wirst. Abermals erklang dieses dumpfe Lachen.
Trotzdem musst du mich nicht Gott nennen. Das wäre wahrlich ein wenig zu viel der Ehre.
»Warum soll ich mir eigentlich die Schulen anschauen?«
Weil mich brennend interessiert, wie sich das deutsche Bildungssystem in den letzten 150 Jahren verändert hat.
»Und wie …«
Folge einfach den Pfeilen.
»Welchen Pfeilen?«
Lämpel wartete geduldig auf eine Antwort. Doch sein imaginärer Gesprächspartner war verstummt. Mit gekrümmtem Rücken setzte er sich auf die Fersen, krallte seine Finger in den Spalt und hievte sich ruckartig in die Höhe. Der Sargdeckel klappte nach hinten und schlug mit einem dumpfen Geräusch irgendwo dagegen. Nur einen Sekundenbruchteil später flammte grelles Licht auf.
Reflexartig kniff Lämpel die Lider zusammen und warf die Hände vors Gesicht. Nach ein paar Sekunden öffnete er die Augen, spähte durch die gespreizten Finger. Doch seine Nickelbrille war beschlagen und er sah nichts als eine milchigtrübe Nebelwand.
Lämpel zog die Brille ab und schaute sich um. Unzweifelhaft befand er sich in einem aus Bruchsandsteinen gemauerten Gewölbekeller. Der fensterlose Raum war mit einer Hobelbank, Werkzeug, Bauholz, Dachziegeln und allem möglichen Gerümpel vollgestopft. Die Gegenstände waren mit einer dicken Staubschicht und Spinnweben überzogen.
Mit einem kräftigen Zug blähte er die Lungen auf. In diesem Keller roch es ziemlich modrig, trotzdem war die Luft bei weitem frischer und angenehmer als diejenige in seiner eisigen Gruft.
Er kletterte aus dem Sarg und entdeckte die Pfeile, von denen die ominöse Stimme in seinem Kopf gesprochen hatte. Irgendwer hatte sie im Abstand von zwei Metern mit Kreide auf den Kellerboden gezeichnet.
Dort, wo er gerade stand, bildete sich in Windeseile eine Wasserpfütze. Ungelenk stampfte er los und hinterließ eine Spur nasser Fußabdrücke. Kraftlos schleppte er sich die Kellertreppe hinauf. Vor der Abschlusstür hielt er inne.
Was, und vor allem wer, erwartet mich wohl hinter dieser Tür?, überlegte er mit bangem Blick. Was soll ich denn nur antworten, wenn man mich fragt, wer ich bin und wo ich herkomme? Soll ich vielleicht sagen:
»Guten Tag, ich bin Lehrer Lämpel und habe 150 Jahre lang in Ihrem Keller in einem Eissarg geschlafen.«
Nervös knetete er sein unter einem Vollbart verstecktes Kinn. Das glaubt mir doch kein Mensch. Die werden mich bestimmt sofort ins Irrenhaus einliefern.
Du alter Hasenfuß, frotzelte die Stimme in seinem Kopf. Du brauchst keine Angst zu haben, das Haus ist leer.
Lämpel zögerte noch einen Moment, dann kratzte er allen Mut zusammen und drückte die Metallklinke herunter. Zentimeter um Zentimeter schob er das Türblatt nach vorne. Dann streckte er den Kopf durch den Türspalt und schaute sich vorsichtig um. Der Flur war hell erleuchtet. Er schloss die Augen und horchte konzentriert. Kein Geräusch, nichts, aber auch rein gar nichts war zu hören.
Auf Zehenspitzen schlich er über knarzende Holzdielen hinweg zur Haustür und blickte nach draußen. Nichts als rabenschwarze Dunkelheit. In der Ferne bellte ein Hund. Lämpel wandte sich um, ging zurück zur Kellertür und folgte den Pfeilen.
Sie geleiteten ihn in eine gemütlich eingerichtete Küche, vor deren einzigem Fenster die Vorhänge zugezogen waren. Auch dieser Raum wurde von einem sonnenartigen, gleißenden Licht erleuchtet, wie er es noch niemals zuvor gesehen hatte. Zudem entdeckte er Gegenstände, die er nicht kannte und für die er auch keine Namen parat hatte.
Träume ich das alles?, fragte er sich nun schon zum wiederholten Male. René Descartes hat behauptet, dass niemals Wachen und Träumen nach sicheren Kennzeichen voneinander unterscheidbar seien. Und zwar deshalb, weil die Traumerlebnisse eine Intensität erreichen könnten, die denjenigen im Wachzustand erlebten, gleichkämen.
Das hat der alte Schlawiner den Vorsokratikern geklaut, monierte der Mann, der behauptete, Wilhelm Busch zu sein.
Zum Beweis ein Zitat von Heraklit, zweitausend Jahre vor Descartes: ›Es ist immer ein und dasselbe, Lebendiges und Totes, das Wache und Schlafende, Jung und Alt.‹ Wie du siehst, geht doch nichts über eine humanistische Bildung.
»Die habe ich ebenfalls genossen«, betonte Lämpel.
Ja, ich weiß. Aber mal was anderes: Meinst du nicht, du solltest endlich deine nassen Kleider und Schuhe ausziehen? Du bibberst ja schlimmer als Schneider Böck, nachdem ihn damals die Gänse aus dem Bach gezogen hatten.
Erst jetzt wurde Lämpel bewusst, dass er tatsächlich wie Espenlaub zitterte. Ängstlich blickte er sich um.
Du brauchst dich nicht zu zieren. Ich hab dir doch schon gesagt, dass niemand im Haus ist.
In der Ecke entdeckte Lämpel einen mit Kleidern und einem Handtuch bestückten Stuhl. Darunter standen dunkle Halbschuhe, in denen schwarze Socken steckten.
So, und nun marsch, marsch an die Arbeit!, befahl die Stimmen.
Alles, was du brauchst, um in deinem neuen Leben zurechtzukommen, findest du in dem Ordner auf dem Tisch. Studiere ihn Zeile für Zeile und befolge strikt die darin enthaltenen Anweisungen. Du musst unbedingt alles daransetzen, in deiner neuen Umgebung so wenig wie möglich aufzufallen.
Lämpel fiel spontan kein anderer Ort ein, an dem er seine triefende, altmodische Bekleidung deponieren konnte. Also legte er Frack, Hose, Hemd, Schnürschuhe und Kniestrümpfe einfach in die Edelstahlspüle. Nun trug er nur noch seine graue Leinenunterwäsche am Körper.
Auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz für seine pitschnasse lange Unterhose durchstöberte er die neuen Sachen, doch er entdeckte lediglich eine Feinripp-Garnitur. Während er ängstlich die Küchentür im Auge behielt, zog er die nasse Unterwäsche aus, trocknete sich geschwind ab und sprang förmlich in die kurze Unterhose. Ansonsten hatte der unbekannte Kleiderspender mit seiner Wahl genau ins Schwarze getroffen, denn Sakko, Hemd, Hose und Schuhe passten wie angegossen.
In den trockenen Kleidern fühlte sich Lämpel wie neu geboren. Er verschränkte die Hände auf dem Rücken und stolzierte pfeifend durch die Küche. Er fühlte sich rundherum wohl, seine zeitweiligen Ängste hatten sich verflüchtigt, und er war sehr neugierig auf das, was ihn außerhalb dieser vier Wände wohl erwarten würde. Vor einem neben dem Fenster aufgehängten Bild blieb er stehen. Die Fotografie zeigte ein altes Fachwerkhaus.
Dieses Haus kenne ich doch, sagte er zu sich selbst. Ja, sicher, das ist unzweifelhaft Wilhelm Buschs Elternhaus.
Nun erinnerte er sich auch wieder an die Haustür mit dem rautenförmigen Fensterchen, den dunklen Dielenboden im Flur und die verzierte Eckvitrine in der Küche, die noch am selben Platz stand.
Hier in dieser beschaulichen Gemeinde hatte der Schüler Heinrich Christian Wilhelm Busch drei Jahre lang Lehrer Lämpels Dorfschule besucht. Und hier in diesem Haus war Lämpel anno 1841 mehrmals zu Besuch gewesen. Aber nicht etwa, weil der kleine Wilhelm Anlass zur Besorgnis oder gar Beschwerde gegeben hätte. Nein, mit ihm gab es keine Probleme.
Mit seinem störrischen, uneinsichtigen Vater hingegen schon, denn dieser puritanischen Krämerseele genügte die Dorfschule nicht. Deshalb meldete der alte Busch seinen erst neunjährigen Sohn von Lämpels Bildungsanstalt ab und schickte ihn zu seinem Schwager, einem hunderte Kilometer entfernt lebenden Pastor, der Wilhelm fortan privat unterrichtete.
Lehrer Lämpel litt unter diesem Affront so sehr, dass er nächtelang nicht schlafen und tagsüber nur schwerlich seine Lehrtätigkeit verrichten konnte. Bei seinen Hausbesuchen zog er alle Register: Wechselweise redete er mit Engelszungen auf Wilhelms Eltern ein oder er warnte vor der Entwurzelung und Entfremdung ihres sensiblen Zöglings. Ein andermal drohte, schimpfte und fluchte er. Ja, er mobilisierte sogar den Pfarrer und den Arzt zur Unterstützung. Aber nichts half, der alte Sturkopf rückte keinen Millimeter von seinem Entschluss ab.
Bei meinem letzten Auftritt habe ich diese Haustür wutentbrannt zugeworfen und seitdem das Anwesen der Familie Busch nie mehr betreten, erinnerte sich Lämpel. Jedenfalls wissentlich, ergänzte er in Gedanken. Denn an der Tatsache, dass ich ausgerechnet hier aufgewacht bin, besteht ja wohl kaum ein Zweifel. Wieso bin ich überhaupt in diesem Haus gelandet?
Frag nicht so viel, sondern setz dich endlich an den Tisch und lies den Ordner!, polterte die Geisterstimme.
Lämpel tat wie ihm geheißen. Unmittelbar vor ihm lag ein dicker Aktenordner. Rechts daneben stand ein Glas und eine Flasche Mineralwasser. Er schenkte sich ein und trank einen Schluck. Als er das Kribbeln der Kohlensäure auf der Zunge spürte, leckte er sich verdutzt die Lippen. Erst jetzt bemerkte er die aufsteigenden Gasperlen in seinem Glas. Kopfschüttelnd faltete er die Hände zu einem stillen Gebet. Anschließend klappte er den Deckel auf.
Wirf mal einen Blick in die Schublade!
Lämpel nahm den Oberkörper zurück und zog die Tischschublade bis an seinen Bauchnabel heraus.
»Du hast wirklich an alles gedacht. Danke«, sagte er in die Stille hinein.
Diesmal antwortete die Stimme nicht. Staunend entnahm er eine Meerschaumpfeife, Tabak, Zündhölzer, einen Pfeifenstopfer sowie einen Aschenbecher.
»Ist zwar leider nicht meine alte«, murmelte Lämpel, als er die Pfeife begutachtete. »Die hier ist ganz neu, das Tonmaterial ist noch marmorweiß, richtig jungfräulich.« Er kicherte hinter vorgehaltener Hand.
»Aber sie liegt ausgesprochen gut in der Hand. Meine alte wäre mir zwar lieber, aber die ist mir ja damals bei dem heimtückischen Anschlag dieser Lauselümmel um die Ohren geflogen.«
In aller Ruhe stopfte er seine Pfeife, zündete sie an und schmauchte genüsslich ein paar Züge. Dann blätterte er um.
Sehr geehrter Herr Lehrer Lämpel,
wenn Sie diese Zeilen lesen, habe ich bereits meine letzte Reise angetreten. Mein Name ist Theodor Busch. Ich bin der Urenkel des berühmten Schriftstellers, Malers und Satirikers Wilhelm Busch. Seit fünf Generationen bewohnt unsere Familie dieses schmucke Fachwerkhaus.
Da ich keine Nachkommen habe, ist es nun an mir, das Vermächtnis meines Urgroßvaters in die Tat umzusetzen und Sie zum Leben zu erwecken. (Das war nebenbei bemerkt nicht sonderlich schwer, schließlich musste ich mich dazu lediglich neben die Tiefkühltruhe stellen, Ihnen den 4. Streich aus ›Max und Moritz‹ vorlesen – und den Stecker ziehen.)
Bis zum heutigen Tag haben wir unser Familiengeheimnis wie einen Schatz gehütet. Die Biographen meines Urgroßvaters behaupten zwar immer noch unverdrossen, dass er für seine mit schwarzem Humor gespickten Geschichten fiktive Figuren verwendet habe. Dem ist aber definitiv nicht so. Alle in ›Max und Moritz‹ auftauchenden Personen haben tatsächlich existiert, wenn auch manche unter anderem Namen.
Für Sie trifft diese Einschränkung jedoch nicht zu, denn Sie haben damals als Dorfschulmeister Lämpel gewirkt. Im Gegensatz zu den anderen literarischen Figuren leben Sie allerdings noch. Diese Behauptung mag Sie verblüffen und Ihnen unwirklich erscheinen, aber sie entspricht der Wahrheit. (Wovon Sie sich im Übrigen selbst überzeugen können, indem Sie sich in die Nase zwicken.)
Max und Moritz’ Attentat mit dem Flintenpulver hat Sie damals zwar ziemlich zugerichtet, aber Sie wurden dadurch nicht getötet, sondern sind ins Koma gefallen. Diesen gravierenden Unterschied bemerkte aber anscheinend niemand, denn man hat Sie für tot erklärt und kurz darauf bestattet. Da sich Wilhelm Busch Ihnen sehr verbunden gefühlt hat und Sie nach Ihrem vermeintlichen Ableben unbedingt in seiner Nähe haben wollte, schlich er bei Nacht und Nebel auf den Friedhof und hat Ihren Sarg wieder ausgegraben.
Eigentlich wollte er Sie in unserem Garten beerdigen. Als er jedoch den Sarg öffnete, bemerkte er, dass Ihr Körper keinerlei Anzeichen einer Verwesung aufwies. Bei einer näheren Begutachtung stellte er schließlich fest, dass Sie sich in einem tiefschlafähnlichen Zustand befanden. Daraufhin hat er Sie als lebende Mumie in unserem Keller versteckt.
Durch die Explosion sind Sie offensichtlich dauerhaft konserviert worden. Obwohl Sie all die Jahre über weder Nahrung noch Flüssigkeit zu sich genommen haben, sind Sie nicht gestorben. Zudem hat Sie dieser Lausbubenstreich anscheinend unverwundbar gemacht.
Mit eigenen Augen habe ich einmal beobachtet, wie eine Ratte an Ihrer Hand herumnagte. Kurz darauf fiel sie tot um, während die Wunde sofort wieder zuheilte. Irgendwann hatte mein Vater dann die geniale Idee mit der Tiefkühltruhe. Damit war das Rattenproblem ein für alle Mal erledigt. Selbst diese hohen Minustemperaturen konnten Ihnen nichts anhaben. Sie sind eben ein medizinisches Wunder!
So, jetzt aber zu einem weiteren Familiengeheimnis. Sie erinnern sich bestimmt daran, dass der kleine Wilhelm damals von seinem Vater in einem Akt barbarischer Willkür von Ihrer Dorfschule abgemeldet wurde. Dieser Schock hat bei Wilhelm ein Trauma ausgelöst, unter dem er zeitlebens gelitten hat.
Andererseits hat dieses einschneidende Erlebnis aber auch ein außergewöhnliches Interesse an Bildungsfragen in ihm erweckt. Aus diesem Grund hat mein Urgroßvater testamentarisch verfügt, dass seine Nachkommen in regelmäßigen Abständen das aktuelle Schulsystem einer kritischen Analyse unterziehen sollen. Und da ich, wie bereits erwähnt, keine Nachkommen habe und selbst nicht mehr am Leben bin, fällt Ihnen diese wichtige Aufgabe zu.
Nun, mein lieber Lehrer Lämpel wird es ein wenig makaber: Nachdem Sie das Dossier mit der ungeschminkten Bestandsaufnahme des deutschen Schulwesens zusammengestellt haben, müssen Sie es in unserer Familiengruft deponieren. Bisher sind alle dort abgelegten Dossiers innerhalb kürzester Zeit aus der Gruft verschwunden, so als ob sie Wilhelm höchstpersönlich abgeholt hätte. Richtig unheimlich, nicht wahr?
Die nächsten Stunden verbrachte Lämpel mit der Lektüre des übrigen Ordnerinhaltes. Der Integrationshelfer in sein neues Leben hatte wirklich an alles gedacht. In einem Regal lagerten Tageszeitungen, mit deren Hilfe sich Lämpel aktuelle Informationen besorgen und sich in die Sprache der Gegenwart einlesen konnte.
Dort stieß Lämpel auch auf ein Geschichtsbuch, das einen kompakten Überblick über die wichtigsten Ereignisse und Veränderungen der letzten eineinhalb Jahrhunderte enthielt. In einer Klarsichthülle entdeckte er einen auf seinen Namen ausgestellten gültigen Personalausweis und ein notariell beglaubigtes Testament, das ihn als rechtmäßigen Besitzer dieses Hauses auswies. In einer Anmerkung unterrichtete ihn Theodor Busch darüber, dass er ihn bereits vor Wochen im Dorf als entfernten Verwandten und seinen potentiellen Alleinerben avisiert habe.
In diesem Aktenordner stieß Lämpel zudem auf ein amtliches Dokument des Kultusministeriums, das ihm überall Tür und Tor öffnen sollte. Es handelte sich dabei um eine perfekt gefälschte Bestallungsurkunde zum Oberministerialrat mit Sonderaufgaben und uneingeschränkten Befugnissen. Und zu guter Letzt hatte sein verstorbener Mentor zu jedem im Haus befindlichen technischen Gerät die Bedienungsanleitung abgeheftet und wertvolle Tipps beigefügt.
»So, Herr Lehrer Lämpel, das war’s. Ich hoffe, dass Ihnen diese Informationen helfen werden, sich in unserer modernen, ziemlich verrückten Welt einigermaßen zurechtzufinden«, las Lämpel laut vor. »Dabei wünsche ich Ihnen von Herzen viel Glück! Ihr Theodor Busch.«
Als er den Ordner zuklappen wollte, bemerkte er am unteren Ende der Seite ein Postskriptum.
»An Ihrer Stelle würde ich mich jetzt umgehend ins Bad begeben und mich ein wenig zurechtmachen. Denn so, wie Sie aussehen, können Sie sich unmöglich unter Ihre Mitmenschen wagen. Außerdem muffeln Sie ganz gewaltig.«
Reflexartig schnüffelte Lämpel an seiner Kleidung, doch die war neu und roch entsprechend. Also lüpfte er den Halsausschnitt seines Unterhemdes und steckte die Nase hinein. Der strenge Geruch, der sein Riechorgan narkotisierte, überzeugte ihn schlagartig von Buschs Behauptung.
Da er stets auf tadellose Bekleidung und ein gepflegtes Äußeres geachtet hatte, war ihm dieser Vorwurf extrem peinlich. Er eilte ins Badezimmer – und erschrak fürchterlich. Denn diese Gestalt, die ihm im Spiegel mit weit aufgerissenen Augen entgegenstarrte, hatte mit dem Bild, das er von sich selbst in Erinnerung hatte, wahrlich nichts mehr gemein. Zwar trug sein Visavis ein tadellos sitzendes, dunkles Sakko und ein sauberes Hemd. Aber der Männerkopf über dem Stehkragen!
»Oh je«, stieß Lämpel entsetzt aus, als er sein rußgeschwärztes Gesicht, die schulterlangen Haare und den dünnen, graumelierten Vollbart erblickte.
»Wie ein Ziegenbock, der in den Kohlenkeller gefallen ist.«
Er hielt nach einem Wasserbottich Ausschau, konnte aber nichts Derartiges entdecken. Mit gekrauster Stirn spielte er an der Mischbatterie herum. Plötzlich schoss ein dicker Strahl aus dem Wasserhahn. So als ob gerade eine Stichflamme aus der Badewanne emporschoss, machte sein Körper einen Satz nach hinten. Dabei knallte er mit dem Rücken ans Waschbecken.
»Au, au, au«, jammerte er und rieb sich die Lenden.
Nachdem er sich ausgiebig bemitleidet hatte, ließ er sich in die gut gefüllte Badewanne gleiten und seifte sich von oben bis unten ein. Er las die Gebrauchsanweisung eines nagelneuen Mach-3-Turbo-Nassrasierers und schaffte es doch tatsächlich, sich ohne Schnittverletzungen von seinem Bart zu befreien.
Anschließend verpasste er sich einen eher stümperhaften Haarschnitt, den er auf Theodor Buschs schriftliches Anraten hin mit Gel in Form brachte. Zufrieden nickte Lämpel seinem deutlich gepflegteren Konterfei zu. Dann schleppte er sich zur Wohnzimmercouch, wo er sofort einschlief.
Als er gegen 9 Uhr die Augen aufschlug, wusste er im ersten Moment nicht, ob er noch träumte. Deshalb zwickte er sich in die Nase. Die stechenden Schmerzen überzeugten ihn schlagartig vom Gegenteil. Er rieb die Augen, gähnte wie ein Löwe und schlurfte in die Küche.
In der Nacht hatte er ein Blatt Papier auf dem Ordner abgelegt, das konkrete Handlungsanweisungen für den ersten Tag seines neuen Lebens enthielt. Und diesen von Busch erstellten, detaillierten Aufgabenplan galt es nun gewissenhaft abzuarbeiten.
»1. Frühstücken!«, las er sich selbst vor. Grinsend legte er eine Hand auf seinen knurrenden Magen. »Also auf die Idee wäre ich durchaus von alleine gekommen.«
Sein fürsorglicher Gastgeber hatte perfekte Vorbereitungen getroffen. Der Kühlschrank war von oben bis unten mit Lebensmitteln gefüllt. Lämpel nahm jedes Glas, jeden Becher und jede Tüte in die Hand, studierte fasziniert die Verpackungstexte und reihte die wundersamen Dinge auf dem Küchentisch auf.
Er benötigte einige Minuten, bis er eine Auswahl getroffen hatte. Bis auf abgepacktes Graubrot, Milch, Butter, Pflaumenmus und eingeschweißten Emmentaler wanderten alle anderen Lebensmittel wieder zurück in den Kühlschrank.
Die Gebrauchsanweisung für die Kaffeemaschine verursachte ihm keine ernsthaften Probleme, nur die Sache mit dem elektrischen Strom war ihm äußerst suspekt. Er drückte den roten Knopf und wartete gespannt, was nun passierte. Wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal einen leuchtenden Christbaum bestaunt, beobachtete er mit großen Augen die seltsame Maschine bei ihrer röchelnden und blubbernden Arbeit.
Den Geschmack seiner Lieblingsmarmelade hatte er noch sehr gut aus seinem früheren Leben in Erinnerung. Seine Mutter hatte damals die Früchte mit einem Gemisch aus rohem Zucker und Honig eingekocht. Diese neumodische Premium-Gourmet-Konfitüre war jedoch viel süßer, cremiger und schmeckte auch bedeutend intensiver nach Pflaumen als die, die er vor 150 Jahren verköstigt hatte. Dafür war die Milch weniger fett und wies keine Rahmabsonderung auf. Die Butter wiederum war gelber und streichzarter.
»Von glücklichen irischen Kühen«, murmelte er kopfschüttelnd. »Glückliche Kühe«, wiederholte er und kicherte dabei wie ein pubertierendes Schulmädchen.
Nach dem ausgiebigen und mit einem Tabakpfeifchen gekrönten Frühstück wandte sich Lämpel dem nächsten Tagesordnungspunkt zu: 2. Fernsehen!
Er hatte diesen merkwürdigen, direkt gegenüber der Couch befindlichen Kasten in der Nacht zwar bemerkt, ihm aber keine weitere Beachtung geschenkt.
»Rechts unten befindet sich der Einschaltknopf. Draufdrücken! Grünes Licht muss aufleuchten«, zitierte er die kommandoartigen Bedienhinweise seines Gastgebers.
»Und jetzt?«, fragte Lämpel in die Stille hinein.
Plötzlich fing der merkwürdige Kasten an zu zischen und zu knacken, so als wolle er explodieren. Gleichzeitig flackerten auf der Glasscheibe Gewitterblitze. In schmerzlicher Erinnerung an das auf ihn verübte Sprengstoffattentat hechtete er hinter die Couch.
Aus Richtung des Zauberkastens hörte er menschliche Stimmen. Zitternd wagte er einen ängstlichen Blick über die Rückenlehne. Was er dort auf der Mattscheibe sah, konnte er einfach nicht begreifen. Eine geschlagene Stunde lang saß er reglos auf der Couch und glotzte gebannt in die Flimmerkiste. Doch dann tränten ihm die Augen und er bekam Kopfschmerzen. Er schaltete das Fernsehgerät aus und versuchte die Eindrücke zu verarbeiten.
Die Menschen Anfang des 21. Jahrhunderts sind wunderschön, lachen viel, haben gerade, strahlendweiße Zähne, sind gut gelaunt, ordentlich gekleidet und haben Essen im Überfluss. Sie leben im Paradies, schlussfolgerte er.
Er seufzte ergriffen. Diese Menschen sind bestimmt sehr, sehr glücklich und zufrieden. Und ihre Kinder sehen so nett und schlau aus. Sie zu unterrichten muss das reinste Vergnügen sein.
Sein hungriger Magen meldete sich erneut. Er kehrte in die Küche zurück und wandte sich seinem Tagesplan zu: 3. Mittagessen!, lautete der nächste Punkt auf der Agenda.
Lämpel befolgte die Anweisungen akribisch. Zuerst entnahm er dem Eisfach eine tiefgefrorene Schale, die mit durchsichtigem Papier überzogen war.
»Steam Cuisine, Thai Curry, Chicken mit Basmatireis und Power-Gemüsemix”, las er gleich dreimal hintereinander abgehackt vor, ohne jedoch den Inhalt zu verstehen.
»Das Gerät auf dem Küchenschrank heißt Mikrowelle und wird besonders häufig in Single-Haushalten benutzt. Einfach Tür öffnen, Fertigmenü reinstellen, Tür wieder zu, Knopf drücken, warten, bis die Klingel ertönt.«
Die Wartezeit vertrieb sich Lämpel mit einem weiteren Entspannungspfeifchen. Er hatte sie noch nicht fertiggeraucht, da erklang auch schon der angekündigte Signalton. Er öffnete das Glastürchen, fasste die Schale an – und verbrannte sich die Finger.
»Verdammt und zugenäht«, fluchte er. »Wie kann dieses Essen ohne Feuer nur so heiß werden? Das geht doch überhaupt nicht.«
Er warf der Mikrowelle einen bitterbösen Blick zu. »Was bist du bloß für eine verfluchte Teufelsmaschine«, schimpfte er weiter, während er die Finger unter kaltes Wasser hielt.
Immer noch wütend kostete er sein fernöstliches Mittagessen, aber dieser unbekannte Geschmack vermochte ihn nicht zu überzeugen. Angewidert schob er die heiße Schale beiseite und schmierte sich stattdessen zwei Leberwurstbrote.
Der Rest des Tages stand ganz im Zeichen weiterer autodidaktischer Studien, schließlich sollte Lämpel gut vorbereitet in sein neues Leben starten. Theodor Buschs Aktenordner und die reich bestückte Bibliothek beinhalteten alle dazu erforderlichen Informationen. Darüber hinaus fungierte das Fernsehgerät als Fenster zur modernen Welt.
Wenn Lämpel das Gefühl hatte, in der auf ihn einströmenden Informationsflut zu ertrinken, zog er sich in Buschs Arbeitszimmer zurück, setzte sich in den behaglichen Lesesessel, stopfte sich eine Pfeife und schmökerte im Faust. An Goethes zeitlosem Meisterwerk hatte er sich bereits in seinem früheren Leben fast täglich ergötzt. Wenn er eine Passage gelesen hatte, schob er das Buch zurück an seinen angestammten Platz und strich zärtlich über den Buchrücken.
Am darauffolgenden Morgen weckte ihn kurz vor sieben Uhr ein Geräusch, das er zuvor noch niemals gehört hatte. Er öffnete die Augen, schob die Brille auf die Nase und blickte sich schlaftrunken um. Durch die Vorhangschlitze sickerte das Dämmerlicht des erwachenden Frühlingstages. Gähnend erhob er sich und reckte die steifen Glieder. Anschließend ging er zum Schlafzimmerfenster, hinter dem nach wie vor dieser merkwürdige, intervallartige Lärm tönte. Vorsichtig schob er die schwere Gardine ein Stück zur Seite und spähte durch die Lücke.
Etwa fünfzig Meter von seinem Haus entfernt, hatte sich ein Kleinkind im Auto der Eltern eingeschlossen und die Innenraumüberwachung der Alarmanlage ausgelöst. Der Mann schimpfte wild gestikulierend auf seine Frau ein, während die junge Mutter mit ihrem Sohn herumzeterte. Ein paar Minuten später fand der Spuk ein Ende, denn der Vater hatte den Ersatzschlüssel besorgt.
Mit quietschenden Reifen fuhr die gestresste junge Familie die kleine Nervensäge zu dem nur zweihundert Meter entfernt gelegenen Ganztagskindergarten. Lämpel hatte sich natürlich inzwischen über die modernen Verkehrsmittel und die sonstigen technologischen Innovationen informiert, doch nun hatte er zum ersten Mal mit eigenen Augen solch ein Wunderwerk der Technik bestaunen können. Lämpel zog den Vorhang wieder vor und schlurfte in die Küche.
Den ganzen Morgen über beschäftigte er sich mit dem von seinem Mentor entwickelten Crashkurs über die Segnungen des modernen Kommunikationszeitalters. Da Theodor Busch jedoch weder ein Handy noch einen Computer besaß und sich für diese Dinge auch nicht interessierte, sparte er diese beiden Geräte bei seinem Vorbereitungslehrgang aus. Allerdings hatte er an dieser Stelle des Ordners den Werbeprospekt eines Elektronikmarktes abgeheftet, der alle möglichen Handys, PCs und Laptops in Hochglanzformat präsentierte.
Natürlich musste Busch davon ausgehen, dass Lämpel irgendwann mit diesen Hightechprodukten konfrontiert werden würde. Deshalb erteilte er ihm einen entsprechenden Rat: Er solle einfach kundtun, dass er in seinem bisherigen Leben sehr gut ohne Handy und Computer zurechtgekommen sei und dies auch in Zukunft zu tun gedenke – ein Recht, das man einem älteren Herrn durchaus zugestehen sollte, wie Theodor Busch handschriftlich anmerkte.
Weisungsgemäß beschäftigte sich Lämpel nun mit dem Telefon. Mit spitzen Fingern tippte er eine vorgegebene Nummer in die piepsende Tastatur ein. Nach einigen Ruftönen meldete sich eine barsche Frau.
»Finanzamt, Zentrale«, bellte die Stimme.
Verdutzt nahm Lämpel den Hörer vom Ohr und bestaunte ihn ungläubig. Im ersten Moment wollte er sofort wieder auflegen, doch dann erinnerte er sich an seine Kommunikationsaufgabe und entschuldigte sich höflich für die Störung der Beamtenruhe.
Amüsiert lauschte er ein paar Sekunden dem Gezeter seiner Gesprächspartnerin, dann legte er auf und wählte die nächste Telefonnummer. Mehr als 10 Minuten lang musste er sich die quäkende Melodie von Beethovens ›Ode an die Freude‹ anhören, bis sich endlich die synthetische Stimme eines Sprachcomputers meldete:
»Guten Tag und herzlich willkommen bei der Kundenhotline der Deutschen Telekom. Damit Sie gleich mit dem passenden Berater verbunden werden, nennen Sie bitte kurz den Grund Ihres Anrufs.«
»He?«, war alles, was Lämpel hervorbrachte.
»Nennen Sie ein Thema, wie zum Beispiel: Beratung, Rechnung, Störung, Umzug, Nachfrage zum Auftrag, oder sagen Sie ›anderes Anliegen‹.«
»Anderes Anliegen.«
»Ich konnte Sie leider nicht verstehen.«
»Anderes Anliegen«, blaffte Lämpel abermals.
»Ich konnte Sie leider wieder nicht verstehen. Probieren Sie es bitte zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.«
»Verstehst du kein Deutsch, du, du, du Suppenhuhn?«
Sein scheinbar allwissender Mentor hatte dieses Fiasko offenbar vorausgeahnt und belohnte ihn mit der Erlaubnis zu seinem ersten Freigang. Zuvor musste er allerdings noch die Vorhänge zurückziehen und sein Domizil anständig durchlüften. Mit diesem symbolischen Akt signalisierte er den Nachbarn, dass der neue Hausherr inzwischen eingezogen war. Theodor Busch hatte gute Vorarbeit geleistet und den Dorfbewohnern seinen Alleinerben als skurrilen, stillen und introvertierten Zeitgenossen beschrieben, der sehr zurückgezogen zu leben pflege und den man am besten ganz in Ruhe lasse.
Bei seinem Spaziergang zum See begegneten Lämpel mehrere Passanten. Sie belästigten ihn nicht mit neugierigen Fragen, sondern grüßten ihn freundlich und zogen dann still ihres Weges.
Nach einem strengen Winter erweckte der sonnige, wohltemperierte März die Natur aus ihrem monatelangen Tiefschlaf. In den Vorgärten reckten Schneeglöckchen und Krokusse ihre Köpfchen der Sonne entgegen, Forsythien setzten die ersten gelben Farbtupfer und aus den kahlen, leblosen Ästen der Sträucher sprießten grüne Triebe hervor.
Die von einer lachenden Sonne erwärmte Luft war erfüllt vom erdigen und würzigen Duft des aufkeimenden Lebens. Die ersten Zugvögel kehrten aus ihrem Winterquartier zurück und begannen mit dem Nestbau.
Bis auf den dichteren Uferbewuchs sah der See noch genau so aus, wie ihn Lämpel in Erinnerung hatte. Unweit der kleinen Gemeinde inmitten von Grünland und Ackerflächen gelegen, glänzte die kreisrunde Wasserfläche wie eine silberne Scheibe. Sogar die beiden Sitzbänke standen noch an derselben Stelle. Allerdings waren sie nicht mehr wie damals aus Holz gefertigt, sondern aus recyceltem Kunststoff.
Verwundert strich Lämpel über das ihm unbekannte Material. Danach setzte er sich, zog die Tüte mit den Brotresten aus der Leinentasche und schaute sich um. Es dauerte nicht lange und einige Enten kamen aus dem nahen Schilf auf ihn zugewatschelt.
Lämpel schritt auf sie zu und streute Futter aus. Laut schnatternd machten sich die Tiere die größten Bissen streitig. Mit der Zeit gesellte sich noch eine Schar frecher Spatzen hinzu, wodurch sein Vorrat bald aufgebraucht war.
»Ihr seid immer noch genauso verfressen wie vor 150 Jahren«, nuschelte er lächelnd vor sich hin.
Als er sich umdrehte, weiteten sich erschrocken seine Augen, denn von ihm völlig unbemerkt hatte sich ein Mann auf der anderen Sitzbank niedergelassen. Er war etwa Mitte Sechzig, trug einen schwarzen Mantel und einen breitrandigen Hut, unter dem ein grauer Pferdeschwanz baumelte.
Lange Haare, unrasiert, das muss ein Landstreicher sein. Da mache ich mich lieber gleich aus dem Staub, dachte Lämpel, dem diese verwegene Gestalt nicht geheuer war.
Doch der ältere Mann schien keinerlei Notiz von ihm zu nehmen und blickte starr nach unten auf seinen Schoß, wo sich irgendein Gerät befand, auf dem er herumdrückte.
Wahrscheinlich eines dieser neumodischen Mobiltelefone, spekulierte Lämpel und kehrte zu seiner, etwa zehn Meter von der anderen entfernt unter einer prächtigen Trauerweide stehenden Bank zurück.
Andächtig ließ er den Blick über die unbewegte Wasserfläche schweben, dann schloss er die Augen und labte sich an den wärmenden Sonnenstrahlen. Seine Gedanken kreisten um die Frage, welche Überraschungen sein neues Leben wohl noch für ihn bereithalten mochte.
»Jawohl, ich hab’s geschafft!«, ertönte plötzlich ein Jubelschrei.
Lämpel schaute hinüber zu der anderen Bank. Die Blicke der beiden Männer begegneten sich. Der ältere Herr lächelte und grüßte freundlich, indem er seinen Hut lupfte. Obwohl ihm sein Mentor aus Vorsichtsgründen aufgetragen hatte, in der nächsten Zeit keinen persönlichen Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen, reagierte er auf diese nette Geste und nickte.
Schließlich ist Höflichkeit eine der zentralen kulturellen Errungenschaften, sinnierte Lämpel. Ich war früher ein rechtschaffener, höflicher Mensch und werde dies auch in meinem neuen Leben bleiben. Nein, ich werde mich keinen Deut ändern.
Brauchst du doch gar nicht, du alter Kauz, polterte Wilhelm Busch in seine Gedanken hinein. Hör dir besser an, was ich über deine vergötterte Tugend ›Höflichkeit‹ gedichtet habe:
Wer möchte diesen Erdenball
noch fernerhin betreten,
wenn wir Bewohner überall
die Wahrheit sagen täten?
Ihr hießet uns, wir hießen euch
Spitzbuben und Halunken,
wir sagten uns fatales Zeug,
noch eh wir uns betrunken,
und überall im weiten Land
ein langbewährtes Mittel
entsproßte aus der Menschenhand
der treue Knotenkittel.
Da lob’ ich mir die Höflichkeit,
das zierliche Betrügen:
Du weißt Bescheid, ich weiß Bescheid,
und allen macht’s Vergnügen.