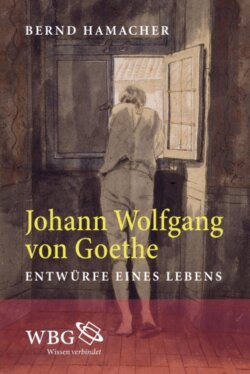Читать книгу Johann Wolfgang von Goethe - Bernd Hamacher - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Geprägte Form“?
ОглавлениеDer Drang zur Ganzheit war also ein Versuch, die unhintergehbare Kontingenz der modernen Welt, die Zufälligkeit des Lebens zu bewältigen. Auf dieser Grundlage ist auch Goethes autobiographisches Projekt noch einmal in seiner Grundkonzeption in den Blick zu nehmen. Zunächst zeigt sich die Bedeutung von Schicksalszeichen und Orakelbefragungen am konzeptionellen Design von Dichtung und Wahrheit. Das erste Buch beginnt nach dem oben ausführlich zitierten Vorwort mit der astrologischen Konstellation bei der Geburt, die leicht ironisch gezeichnet ist (dass die Sonne in der Mittagsstunde ihren höchsten Punkt erreicht, versteht sich von selbst). Es bleibt in der Schwebe, wie sehr das Leben dadurch determiniert wird:
Am 28. August 1749, Mittags mit dem Glockenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich; die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau, und kulminierte für den Tag; Jupiter und Venus blickten sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig: nur der Mond, der so eben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis diese Stunde vorübergegangen. (FA I 14, S. 15)
Das Ende der Darstellung ist offen. Goethe hat bis fast an sein Lebensende am vierten Teil von Dichtung und Wahrheit gearbeitet, der aber erst durch Eckermann zu einem notdürftigen Ende gebracht und aus dem Nachlass ediert wurde. Das 20. und letzte Buch endet, wie bereits erwähnt, mit dem Aufbruch nach Weimar und einem Schicksalsanruf, einem Selbstzitat aus dem Drama Egmont: „Kind, Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts, als mutig gefaßt, die Zügel festzuhalten, und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da die Räder abzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam.“ (FA I 14, S. 852)
Mit dieser geschickt hergestellten Rahmung und der zukunftsgewissen, herausfordernden Vorausdeutung am Schluss wird kaschiert, dass das autobiographische Gesamtprojekt Goethes gescheitert ist. Intendiert war nämlich etwas ganz anderes als das, was nun mit Dichtung und Wahrheit vorliegt. Auskunft und Rechenschaft darüber wollte Goethe in einer im Sommer 1813 entstandenen Vorrede zum dritten Teil liefern, die er jedoch unterdrückte und nicht veröffentlichte:
Ehe ich diese nunmehr vorliegenden drei Bände zu schreiben anfing, dachte ich sie nach jenen Gesetzen zu bilden, wovon uns die Metamorphose der Pflanzen belehrt. In dem ersten sollte das Kind nach allen Seiten zarte Wurzeln treiben und nur wenig Keimblätter entwickeln. In zweiten der Knabe mit lebhafterem Grün stufenweis mannigfaltiger gebildete Zweige treiben, und dieser belebte Stengel sollte nun im dritten Bande ähren- und rispenweis zur Blüte hineilen und den hoffnungsvollen Jüngling darstellen.
Freilich ist es Gartenfreunden wohl bekannt, daß eine Pflanze nicht in jedem Boden, ja in demselben Boden nicht jeden Sommer gleich gedeiht, und die angewendete Mühe nicht immer reichlich belohnt; und so hätte denn auch diese Darstellung, mehrere Jahre früher, oder zu einer günstigern Zeit unternommen, eine frischere und frohere Gestalt gewinnen mögen. Sie ist aber nun, wie es jedem Gewordenen begegnet, in ihre Begrenzung eingeschlossen, sie ist von ihrem individuellen Zustand umschrieben, von dem sich nichts hinzu noch hinweg tun läßt und ich wünsche, daß dieses Werk, eine Ausgeburt mehr der Notwendigkeit als der Wahl, meine Leser einigermaßen erfreuen und ihnen nützlich sein möge. Diesen Wunsch tue ich um so angelegentlicher, als ich mich für eine Zeitlang von ihnen beurlaube: den[n] in der nächsten Epoche zu der ich schreiten müßte fallen die Blüten ab, nicht alle Kronen setzen Frucht an und diese selbst, wo sie sich findet, ist unscheinbar, schwillt langsam und die Reife zaudert. Ja wie viele Früchte fallen schon vor der Reife durch mancherlei Zufälligkeiten, und der Genuß, den man schon in der Hand zu haben glaubt, wird vereitelt. (FAI 14, S. 971 f.)
Inwiefern Goethe dieses Scheitern fruchtbar machen konnte, wird noch zu zeigen sein. Einen Extrakt des ursprünglichen Unternehmens, nämlich das Programm der Individualitätsentfaltung, wie es dann in der Autobiographie nicht realisiert werden konnte, lieferte Goethe aus der Perspektive seines Spätwerks in dem aus fünf Stanzen (einer feierlich-strengen italienischen Strophenform) bestehenden Gedichtzyklus Urworte. Orphisch. Er kann nicht nur als abstrahierender Kommentar zu den autobiographischen Schriften und als eine Art Bildungsroman in nuce gelesen werden. Denn die damit vorgenommene Besinnung auf letzte und allgemeinste Prinzipien, die sich in der Gestaltung von menschlichem Leben auswirken, liefert gewissermaßen die Software der Biographiemaschine. Der Denk- und Kategorienfehler, der in der Goethe-Rezeption immer wieder begangen wurde und wird, besteht darin, dass das offene Ende selbst dieses idealtypischen Modells allzu einseitig auf das Gelingen hin gelesen wurde. Hätte Goethe einen solchen Ideallebenslauf führen können, wie er ihn hier skizziert, so wäre er der vollendete Mensch, als den ihn viele ältere Darstellungen erscheinen lassen, für heutige Leserinnen und Leser aber nur noch von historischem Interesse und nicht mehr mit der eigenen Lebens- und Lesegegenwart zu vermitteln.
Die Urworte sind 1817 entstanden, wurden von Goethe im zweiten Heft seiner Zeitschrift Zur Morphologie 1820 erstmals veröffentlicht und noch im selben Jahr in Über Kunst und Alterthum erneut publiziert und mit einem erläuternden Kommentar versehen. In Anspielung auf neuplatonische, vermeintlich orphische Schriften (nach Orpheus, dem griechischen Sänger), die auf eine monotheistische Urreligion verweisen sollten, liefern die Stanzen und mehr noch ihr Kommentar ein Programm des Umgangs mit solchen ,Urworten‘. Sie sind als griechische Überschriften (mit Übersetzung) über die Strophen gesetzt und werden in den folgenden Texten erläutert – das Modell einer Aufklärung und damit Entschärfung prophetischer Lehren: „einem klaren Sinne gemäß und einer reinen Erkenntniß übergeben“ (FA I 20, S. 491 f.), wie Goethe eingangs seiner Erläuterungen schreibt. Diese Lehren werden nun auf die erfolgreiche Gestaltung eines Lebenslaufs bezogen, auf eine gelingende Individuation. Die erste, Dämon überschriebene Strophe variiert und verallgemeinert den astrologischen Eingang von Dichtung und Wahrheit:
Wie an dem Tag der Dich der Welt verliehen
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz wonach Du angetreten.
So mußt Du seyn, Dir kannst Du nicht entfliehen,
So sagten schon Sybillen, so Propheten,
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
Geprägte Form die lebend sich entwickelt.
Goethe erläutert:
Der Dämon bedeutet hier die nothwendige, bey der Geburt unmittelbar ausgesprochene, begränzte Individualität der Person, das Charakteristische wodurch sich der Einzelne von jedem andern, bey noch so großer Aehnlichkeit unterscheidet. Diese Bestimmung schrieb man dem einwirkenden Gestirn zu […]. Hiervon sollte nun auch das künftige Schicksal des Menschen ausgehen, und man möchte, jenes erste zugebend, gar wohl gestehen daß angeborne Kraft und Eigenheit mehr als alles Uebrige des Menschen Schicksal bestimme.“ (FA I 20, S. 492)
Was dann weiter das „nur aus sich selbst zu entwicklende Wesen“ genannt wird (FAI 20, S. 493), wird also doch einer höheren Einwirkung zugeschrieben, gegen die das Individuum machtlos ist, wenn es die Konstellation nicht erzählerisch korrigiert. Was angeblich seine unverwechselbar eigene Form ist und nur aus ihm selbst kommt, verdankt sich der Determination durch eine transzendente Einwirkung, verbildlicht in der Planetenkonstellation bei der Geburt, den „unendlich mannigfaltigen Bewegungen und Beziehungen der Himmelskörper, unter sich selbst und zu der Erde“ (FA I 20, S. 492). So ist es denn nicht nur Tyche, das Zufällige (wie die zweite Strophe lautet), was für die unabweisbare Kontingenz des Lebenslaufs verantwortlich ist, sondern ebenso die in der Geburtsstunde begründete Zufälligkeit der Individualität selbst.
„Tyche“ wird nun insbesondere mit der Erziehung identifiziert, was einen aufschlussreichen Rückbezug auf das Motto von Dichtung und Wahrheit herstellt, das von dem antiken Komödiendichter Menander stammt und wörtlich übersetzt lautet: „Der nicht geschundene Mensch wird nicht erzogen.“
In der dritten, von Eros, der Liebe, handelnden Strophe sollen sich nun „der individuelle Dämon und die verführende Tyche mit einander“ verbinden (FA I 20, S. 494), wodurch das Individuum vollends die Kontrolle verliere: „der Mensch scheint nur sich zu gehorchen, sein eigenes Wollen walten zu lassen, seinem Triebe zu fröhnen, und doch sind es Zufälligkeiten die sich unterschieben, Fremdartiges was ihn von seinem Wege ablenkt; er glaubt zu erhaschen und wird gefangen, er glaubt gewonnen zu haben und ist schon verloren. […] hier ist keine Gränze des Irrens: denn der Weg ist ein Irrthum.“ (FAI 20, S. 494 f.) Als Steuerungsinstrumente werden in der Erläuterung Ehe und Familie eingeführt. Durch sie soll freie Selbstbestimmung möglich, hier sollen Sicherungsorgane gegen die Unordnung der Liebe gefunden sein: „Alle Theile sehen sich durch die bündigsten Contracte, durch die möglichsten Oeffentlichkeiten vor, daß ja das Ganze in keinem kleinsten Theil durch Wankelmuth und Willkühr gefährdet werde.“ (FA I 20, S. 496) Die vierte Strophe, Ananke, Nöthigung, spricht hingegen illusionslos von einer umfassenden und totalen Determination, einer völligen Fremdbestimmung des Lebenslaufs:
Da ist’s denn wieder wie die Sterne wollten:
Bedingung und Gesetz und aller Wille
Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten,
Und vor dem Willen schweigt die Willkühr stille;
Das Liebste wird vom Herzen weggescholten,
Dem harten Muß bequemt sich Will und Grille.
So sind wir scheinfrey denn, nach manchen Jahren,
Nur enger dran als wir am Anfang waren. (FA I 20, S. 496)
Dass „solcher Grenze, solcher ehrnen Mauer / Höchst widerwärtge Pforte wird entriegelt“ (FAI 20, S. 497), ist nur die abschließende, nicht mehr kommentierte Hoffnung (Elpis) des Textes – diese letzte Strophe hat keinen Kommentar mehr. Die Probe aufs Exempel dieser bloßen Behauptung wird der einzelne Lebenslauf erbringen müssen. In der die Nötigung übersteigenden Hoffnung wird man sicherlich einen Schlüssel für Goethes Produktivität erblicken können, allerdings verdeckt die Fixierung auf das Gelingen gewissermaßen die Folgekosten der Modernisierung, mit denen dieses Gelingen bezahlt werden muss. Diese Folgekosten bestanden für Goethe darin, dass er die Software der Biographiemaschine austauschen, seine Lebensentwürfe immer wieder neu und umschreiben musste.
Goethe tat jedoch das Seinige, dies zu vertuschen und der stereotypen Legendenbildung über sein Leben Vorschub zu leisten. In seiner Gedichtsammlung von 1827 finden sich unter den Zahmen Xenien folgende Verse:
Vom Vater hab’ ich die Statur,
Des Lebens ernstes Führen,
Von Mütterchen die Frohnatur
Und Lust zu fabulieren.
Urahnherr war der Schönsten hold,
Das spukt so hin und wieder,
Urahnfrau liebte Schmuck und Gold,
Das zuckt wohl durch die Glieder.
Sind nun die Elemente nicht
Aus dem Complex zu trennen,
Was ist denn an dem ganzen Wicht
Original zu nennen? (FA I 2, S. 682)
Die Goethe-Forschung stand nicht an, dem Autor die Antwort postum hinterherzurufen: „das Sittliche, das Poetische, das Erotische und das Künstlerische“ seien Goethe original zu eigen.5 Unter der scheinbar so modernen Frage, welche Anteile der Persönlichkeit nicht durch Vererbung determiniert sind, schauen alte Klischees hervor, in die sich auch die zitierte Antwort verstrickt. Denn wenn man sie auf die Verse zurückbezieht, erweist sich keiner dieser Bereiche als „original“: Das Sittliche soll vom Vater, das Poetische von der Mutter, das Erotische vom ,Urahnherrn‘ und das Künstlerische von der ,Urahnfrau‘ ererbt sein. Damit aber werden Stereotype über die vermeintlichen Persönlichkeits- und Charakterunterschiede von Mann und Frau fortgeschrieben.
Das Individuum also – nichts als ein Bündel von Klischees? Nur aus Vorurteilen bestehend, in keinem einzigen seiner Elemente einzigartig, sondern allenfalls noch in der spezifischen Mischung der ererbten Partikeln? Sosehr das Individuum Goethe schon durch seine eigene Legendenbildung in seinem Kern unkenntlich ist, so repräsentativ ist es auch darin, dass es unter anderem Anlass gibt, über die noch in der gegenwärtigen Kultur umlaufenden Vorstellungen über geschlechtsspezifische Anteile an der Persönlichkeitsentwicklung nachzudenken.