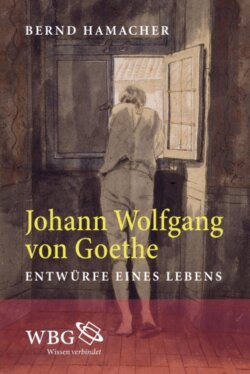Читать книгу Johann Wolfgang von Goethe - Bernd Hamacher - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Es gibt keine Individuen“
ОглавлениеEin Mann steht am Fenster und sieht hinaus. Der leere Raum liegt im Dämmerlicht, nur ein Fensterflügel ist geöffnet, draußen ist es hell, sonnig vermutlich, vielleicht heiß, so heiß, dass man sich gerne in die Kühle des Zimmers mit seinem gekachelten Fußboden zurückzieht. Der Blick fällt auf das Haus gegenüber; was der Betrachter unten auf der Straße sehen mag, bleibt uns verborgen. Der Mann am Fenster selbst ist lässig gewandet, Beinkleid und Frisur à la mode, die Füße in bequemen Pantoffeln.
Viele kennen dieses hier in der Titelei reproduzierte Aquarell und wissen, dass es Johann Wolfgang von Goethe zeigt, festgehalten von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein in der Wohnung, die Goethe am römischen Corso im Jahr 1787 mit ihm teilte. Ein intimes Bild, das uns Einblick in Privates gewährt und doch nichts preisgibt. Goethe kehrt uns den Rücken zu – er fühlt sich sicher, von unseren Blicken nicht bedroht, wendet sich aber auch von uns ab. Es fällt leicht, uns ihm zu nähern, ihm vielleicht die Hand auf die Schulter zu legen oder uns gar an seine Stelle zu denken. Und doch sehen und wissen wir nichts – wir kennen sein Gesicht nicht, nicht den Ausdruck, den es in diesem Moment zeigt, und wir wissen nicht, was er sieht. Wir sehen die Welt mit seinen Augen und sind doch blind, leben mit ihm und kennen ihn nicht. Das Bild lädt zur Identifizierung ein und schließt uns gleichzeitig unbarmherzig aus. Wir sind mit Goethe eng vertraut, und wir sind ihm völlig gleichgültig.
Wer also war Goethe? Weshalb ist er für unsere Kultur immer noch so bedeutsam, dass sein Name im Ausland die deutsche Kultur repräsentieren kann? Oder ist das nur mehr ein Relikt aus vergangenen Zeiten? Dass seine Werke in den Regalen von Buchhandlungen und bürgerlichen Haushalten ebenso stehen wie auf den Lehrplänen und Lektürelisten von Schule und Universität, verdeckt den Abgrund an Fremdheit, der heutige Leserinnen und Leser von ihm trennt. Gerade der Umstand, dass das Leben keines Schriftstellers, ja kaum eines Menschen so umfassend dokumentiert sein dürfte wie dasjenige Goethes, lässt den interessierten Blick häufig hilflos schielen: Das eine Auge fließt über vor Detailwissen über das von Tag zu Tag rekonstruierte Leben1 oder Goethes Wort für Wort erschlossene Sprache.2 Das klassische Bild, das im anderen Auge entsteht, bleibt blass und ohne Kontur, ein steinernes Monument, totes Bildungsgut. Normalerweise kann das menschliche Auge, zur Not mit Hilfsmitteln, das Schielen so weit korrigieren, dass ein einheitliches Bild im Gehirn entsteht. Den schielenden Blick auf Goethe indes halten – wenn überhaupt – nur Spezialisten aus; allen anderen kann man es nicht verdenken, wenn sie die Augen, die kein räumliches, lebendiges Bild erfassen können, früher oder später schließen und kein Blick mehr auf Goethe fällt. Vielleicht lohnt es sich ja auch gar nicht mehr hinzusehen, vielleicht kennt man ihn ja im Schlaf? Dieses Buch versteht sich als Einladung, die Augen zu öffnen, Goethe vor dem Bildungstod zu retten und neu sehen und lesen zu lernen, aber ohne gegen die drohende Fehlsichtigkeit einfach eine akademische Brille reichen zu wollen: „Wer durch Brillen sieht, hält sich für klüger als er ist“ (FA I 10, S. 384). Durch solche Zitate (auch wenn sie, wie hier, aus dem Mund einer Romanfigur, nämlich Wilhelm Meister, stammen) scheint Goethe der heutigen Zeit denkbar fern gerückt, und doch erweisen sich gerade solche vermeintlichen Kuriositäten oft auf überraschende Weise aktuell, aber anders als im Sinne einer platten Fortschritts- oder Modernitätskritik, für die Goethe oft genug (auch) in Anspruch genommen wird.
Das Wissen um Goethe, die Goethe-Wissenschaft, blühte, nur scheinbar paradox, in dem Moment auf, als die leibliche Genealogie Johann Wolfgang von Goethes erloschen war: Mit dem Tod des letzten Enkels, Walther Wolfgang von Goethe, am 18. April 1885 fielen Wohnhaus, Sammlungen, literarischer Nachlass und die gesamte sonstige Hinterlassenschaft durch dessen Vermächtnis an die Großherzogin Sophie von Sachsen, die das Erbe als nationale Aufgabe begriff, für Wissenschaft und Öffentlichkeit zugänglich machte und für seine editorische Erschließung sorgte. Als Vertrauensmann der Großherzogin fungierte der österreichische Germanist Wilhelm Scherer, der den bedeutendsten germanistischen Lehrstuhl im deutschen Kaiserreich in Berlin innehatte und die noch junge wissenschaftliche Disziplin entscheidend prägte. Aus seinem Briefwechsel mit Erich Schmidt, der als erster Leiter des Goethearchivs in Weimar vorgesehen war und nach Scherers frühem Tod dessen Lehrstuhlnachfolger wurde, erfährt man viel über die Wissenschaftspolitik der Zeit und über die zufälligen Umstände, von denen das Bild Goethes damals und mit weitreichenden Folgen lange darüber hinaus bestimmt war. Am 7. Juni 1885 schrieb Scherer an Schmidt:
Sie müssen, wenn sich unsere Hoffnungen verwirklichen, nie vergessen, daß wir uns für die Goetheausgabe und die sonstigen Goethepublikationen in den Dienst einer Frau gestellt haben. Ihr zu dienen, das ist der Preis, den wir zahlen, damit wir Goethes Nachlaß zum Frommen der Wissenschaft in die Hand bekommen. Diese Frau nun, eine sehr charaktervolle, entschieden wollende Frau, wird von keiner Sorge mehr bedrängt, als daß Dinge zu Tage kommen könnten, welche anstößig wären. Zwei Hefte Erotica und Priapeia hat sie sofort secretiert: sie sollen einem Geheimarchiv aufbehalten werden. Und mehrfach betonte sie, man möchte Männer zu Mitarbeitern wählen, deren Discretion man sicher wäre. Ich hatte von der Sache schon gehört und nahm schnell meine Resolution: ich gab ihr Recht. Sie würde unerschütterlich sein in diesem Punkte; sie wankend machen zu wollen, würde nichts nützen und mich, wenn ichs versuchte, verdächtig machen. Ich beteuerte ihr, daß ich kaum neugierig wäre nach jenen verbotenen Dingen. Da konnte sie denn nicht umhin, anzudeuten, daß doch künstlerisch gar bedeutende Sachen darunter wären. Ich bin überzeugt, ich würde auf dem Wege, ihr recht zu geben, mehr erreichen als durch Gegendemonstrationen. Hiermit also müssen Sie, müssen wir alle rechnen. Das Tagebuch darf in die Weimarer Ausgabe gewiß nicht aufgenommen werden3, und ich würde in einer solchen Sache mich ganz mit der Großherzogin identifizieren, die Sache auf mich nehmen, wie Bismarck die Wünsche des Kaisers auf sich nimmt, gleichviel ob er sie mißbilligt.4
Obwohl also manche Facetten des Goethe-Bildes fehlten und dieses viel homogener präsentiert wurde, als es der Quellenlage entsprochen hätte, hatten bereits die ersten Goethe-Forscher ihre liebe Not mit dem erwähnten schielenden Blick. Kurz nach der Jahrhundertwende, 1901, zog der bedeutende Goethe-Biograph Richard M. Meyer ein erstes Resümee: „Wer ist ›Goethe‹? eine Abstraktion, die den Dichter des ,Werther‘ und des ,Tasso‘ und der ,Pandora‘ in eine unmögliche Einheit bringt. Was aber sollen wir anderes thun? Mit den Milliarden von Einzeleindrücken, die auf uns losstürmen, können wir nicht rechnen. Es ist Nothwehr, daß wir sie auf große Durchschnittsziffern bringen.“5 Wenn wir uns über einhundert Jahre später immer noch fragen, wer Goethe war, so sprechen wir damit, damals wie heute, eine Frage nach, die er sich selbst am Ende seines Lebens gestellt hatte. Daher lohnt es sich, die Antwort zu hören, die er (vom Weimarer Prinzenerzieher Frédéric Soret nach einem Gespräch vom 17. Februar 1832, rund fünf Wochen vor Goethes Tod, auf Französisch aufgezeichnet) darauf gab:
Was bin ich selbst? Was habe ich getan? Ich habe alles, was ich gehört, beobachtet habe, gesammelt, benutzt. Meine Werke sind von Tausenden verschiedenen Individuen genährt, Unwissenden und Weisen, Geistreichen und Dummköpfen. Die Kindheit, das reife Alter, das Greisentum, alle haben mir ihre Gedanken, ihre Fähigkeiten, ihre Seinsart dargeboten, ich habe oft die Ernte gesammelt, die andere gesät hatten. Mein Werk ist das eines Kollektivwesens und trägt den Namen Goethe.6
Dies war bei ihm indes nicht erst eine Alterseinsicht. Bereits am 7. Mai 1781 schrieb er an den Schweizer Theologen Johann Caspar Lavater: „Ich heise Legion, du thust Vielen wohl wenn du mir wohlthust.“ (FA II 2, S. 348) In der Bibel, im Markus-Evangelium, antwortet der Teufel auf die Frage Jesu, wie er heiße: „Legion heiße ich, denn unser ist viel.“ (Markus 5, 9) Die identifikatorische Nennung des Teufelsnamens durch Goethe, sein Bekenntnis zu einer multiplen Identität und die damit verbundene Vorstellung dämonischer Besessenheit war eine Provokation des religiösen Adressaten, die heute auch ohne religiösen Hintergrund noch nachklingt und zuweilen eine verblüffende Aktualität beweist. In welchem Ausmaß und in wie elementarer Weise, das zeigten unlängst ausgerechnet neueste Erkenntnisse in der Genetik, gemäß denen sich die Wissenschaft von der Idee verabschieden müsse, dass das Genom ein zu Beginn des Lebens festgelegter, unveränderlicher Bauplan des Menschen sei. Vielmehr seien die Erbanlagen in ständigem Wandel begriffen. „Die Erkenntnislage wirft auch philosophische Grundfragen auf wie die nach der genetischen und somit biophysikalischen Identität des Menschen – und verlangt womöglich radikal andere Antworten.“7 Auf die Frage nach der biologischen Identität des Individuums erhalte man eine angeblich „bestürzende Antwort: Ich bin viele“.8 Bestürzend ist das im Hinblick auf Goethe nur dann, wenn man – wie allerdings die große Mehrzahl der Biographen – auf der Suche „nach einer bestimmenden Konstante im Lebensprozeß Goethes“9 , einem unverlierbaren Wesenskern ist. Um Goethes aus der poetischen Selbstbeobachtung gewonnene Einsicht in die multiple Struktur der Persönlichkeit für seine Biographie produktiv machen zu können, muss man sich indes von einem guten Teil seiner Selbststilisierungen und Leserlenkungen befreien und mit Goethe gegen Goethe argumentieren – mit dem multiplen Ich gegen den stabilen Identitätspolitiker.
Das bedeutet nun keineswegs, das andere Auge zu schließen und nur mehr heterogene Details wahrzunehmen. Wenn das Gesamtbild nicht mehr das eines einheitlichen Individuums, sondern eines „Kollektivwesens“ ist, kann nicht nur gezeigt werden, woraus sich dieses Wesen speist, welche Einflüsse es verarbeitet, welche Kontexte relevant sind. Vielmehr läuft der produktive Strom nicht nur aus der Vergangenheit und Gegenwart in das produktive kollektive Ich hinein, sondern auch wieder aus diesem hinaus in die Zukunft. Darauf soll in diesem Buch der Schwerpunkt liegen. Kindheit, Erwachsenenalter, Greisentum können in kollektiver Gestaltung und Ausprägung aus Goethes Werk entnommen werden. Da mit seinem Leben dasjenige von „Tausenden verschiedenen Individuen“ geschildert wird, lässt sich mit Hilfe dieser von ihm selbst gegebenen Antwort auf die Frage „Wer war Goethe?“ auch die zweite Einstiegsfrage beantworten, warum er für unsere Kultur noch immer bedeutsam sein könnte. Früher wurde damit eine unmittelbare Vorbildhaftigkeit Goethes für den Menschen schlechthin behauptet. Der Philosoph und Soziologe Georg Simmel etwa formulierte 1913: „Wir empfinden seine Entwicklung als die typisch menschliche – […] in gesteigerteren Maßen und klarerer Form zeichnet sich an ihm, in und unter all seinen Unvergleichlichkeiten, die Linie, der eigentlich jeder folgen würde, wenn er sozusagen seinem Menschentum rein überlassen wäre.“10 Von einer solchen Vorbildhaftigkeit der Entwicklung Goethes kann nicht mehr gesprochen werden, nicht nur deswegen, weil bereits Goethe selber wusste, dass niemand, auch er nicht, „seinem Menschentum rein überlassen“ ist. Goethes Leben und sein gestaltetes Leben im Werk können aber als Spiegel einer spezifisch modernen Individualität dienen und sind von ihrem Problemgehalt her und in ihren eher fragwürdigen Zügen noch für das begonnene 21. Jahrhundert repräsentativ. Wenn die heutige Genforschung zu der Erkenntnis gelangt: „Ich bin viele“, so bedeutet das: Jeder ist der Teufel, jeder ist Goethe. Die Rekonstruktion des Problemgehalts ermöglicht es, Goethes Werk als Krisenmanagement zu verstehen und sein Leben als Problemgeschichte der Moderne neu zu schreiben. Die Werke bearbeiten Probleme, die das Leben aufwirft, und zwar nicht nur Goethes Leben, sondern grundsätzlich und in Teilbereichen jedes Leben in der modernen Welt der Gegenwart. „Es gibt keine Individuen“, so notierte sich Friedrich Wilhelm Riemer, ein langjähriger Mitarbeiter, einen Ausspruch Goethes aus dem Jahr 1806. „Alle Individuen sind auch genera: nämlich dieses Individuum oder jenes, welches du willst, ist Repräsentant einer ganzen Gattung.“11
Im Unterschied zu älteren, vor allem in den 1910er und 20er Jahren entwickelten problemgeschichtlichen Verfahren geht es hier weniger um eine Darstellung der Auseinandersetzung mit den ewigen Grundfragen der Menschheit wie etwa Liebe oder Tod. Vielmehr geht es um lebensgeschichtliche Fragen, die im Zuge der gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse auftauchen und uns darum heute noch betreffen. Der Beginn von Goethes schriftstellerischer Wirksamkeit um 1770 fällt in eine Zeit umfassender Modernisierungsschübe, die sich auch sprachlich ausprägen: Begriffe, die über lange Zeit eine relativ stabile Bedeutung besaßen, verändern diese in vergleichsweise kurzer Zeit oder werden mehrdeutig. Erst seit jener Zeit ist Mehr- oder Vieldeutigkeit überhaupt ein relevantes Kriterium poetischer Texte, in früheren Jahrhunderten wäre das als Zumutung empfunden worden. Deshalb ist die Beschäftigung mit Goethe in vielerlei Hinsicht besonders ergiebig, und deswegen lassen sich historisches und gegenwärtiges Interesse an seiner Person und an seinem Werk unmittelbar verknüpfen.
Generationen von Leserinnen und Lesern Goethes ist es so ergangen, wie man es in Tischbeins Aquarell unmittelbar ins Bild gesetzt empfinden kann. Goethe lebte in vielen bürgerlichen Haushalten gleichsam zur Untermiete, man wusste, was er geschrieben hatte, und lebte damit. Doch eigentlich lebte man nicht mit ihm und seinen Werken, sondern mit den eigenen Vorstellungen, die man sich davon bildete, den Vermutungen, wie sein Gesicht wohl ausgesehen und was er draußen in der Welt erblickt habe, was seine Weltansicht in ganz wörtlichem Sinne gewesen sein mochte.12 Für heutige Leserinnen und Leser ist eine solche Intimität, die um ihre Fremdheit nicht weiß, ihrerseits fremd geworden. Nun ist es umgekehrt: Wir gehen zumeist von einer Situation der Fremdheit aus und wissen nicht um die Intimität. Vielleicht fühlt man sich inzwischen als ungebetener Gast und möchte sich diskret wieder aus dem Zimmer entfernen, weiß man doch gar nicht, wem man sich dort hinterrücks genähert hat. Dass wir tatsächlich aufgrund unserer gegenwärtigen kulturellen Situation die Welt noch immer – und gerade heute – mit den Augen jenes Unbekannten betrachten, unser Leben in vielen Zügen den Modellen seiner Lebensentwürfe folgt, erscheint völlig unglaubwürdig. Selbst der Germanistik ist das Bewusstsein darum, wie sehr sie noch heute methodisch bis in die Wissenschaftssprache hinein von diesem ihrem Gegenstand geprägt ist, weitgehend verloren gegangen. Diese Prägung resultiert daraus, dass sie als Wissenschaftsdisziplin im 19. Jahrhundert in wesentlichen Teilen aus der Goethe-Forschung hervorgegangen war und Goethe jahrzehntelang zu ihrem wichtigsten Forschungsgegenstand gemacht hatte. Unzählige Bücher wurden über Goethe geschrieben – über sein Leben, über seine Werke, über Leben und Werk. Unzählige Male wurde damit das unternommen, woran er selbst gescheitert war: Das Projekt, sein Leben zu erzählen, sollte das Zentrum seines gesamten Schaffens bilden, den Kern, um den herum sich sowohl seine Werke als auch sein Leben selbst gruppieren sollten, doch dieses Projekt wurde – mit guten Gründen – abgebrochen bzw. umgestaltet. Daher ist es an der Zeit, auch in der biographischen Darstellung, der Darstellung von Leben und Werk, eine Umgestaltung vorzunehmen. Es lohnt sich, im kühlen Zimmer zu verweilen und dem Fremden zuzuhören, der nur mit sich selbst zu sprechen scheint und uns dabei doch erzählt, was es draußen in der Welt, im Leben der Menschen, zu sehen gebe. Nicht nur von seinem Leben und von seinen Weltansichten wird man etwas erfahren, sondern aus seinen Lebensentwürfen manches über das Leben des modernen Menschen überhaupt. An Voraussetzungen braucht man dazu nicht mehr als die Fähigkeit, den Herzschlag zu spüren oder den eigenen Atem bewusst wahrzunehmen. Noch die kompliziertesten Strukturen des Lebens und der Welt werden von Goethe aus solchen elementaren Körpererfahrungen aufgebaut und immer wieder auf sie zurückbezogen.