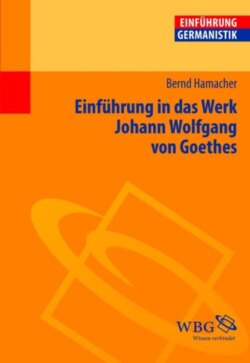Читать книгу Einführung in das Werk Johann Wolfgang von Goethes - Bernd Hamacher - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Die Goethe-Forschung und die Geschichte der Neueren deutschen Literaturwissenschaft
ОглавлениеBeginn der Goethe-Philologie
Die Entwicklung der Neueren deutschen Literaturwissenschaft ging mit der Erforschung des Goethe’schen Werks Hand in Hand. Im Laufe des 19. Jahrhunderts und dann verstärkt seit der Reichsgründung 1871 wurde die Germanistik als Universitätsdisziplin an immer mehr deutschen Universitäten etabliert. Zunächst wurde sie jedoch vor allem als Sprachwissenschaft betrieben, erste literaturwissenschaftliche Untersuchungen galten den Texten des deutschen Mittelalters. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden neuhochdeutsche Texte im selben Maße ‚wissenschaftsfähig‘ wie alt- und mittelhochdeutsche. Die Literaturgeschichten des 19. Jahrhunderts endeten mit Goethes Tod – für Heinrich Heine das „Ende der Kunstperiode“, das praktisch mit dem von dem Philosophen Hegel in seinen Berliner Ästhetikvorlesungen der 1820er Jahre konstatierten Ende der welthistorischen Rolle der Kunst zusammenfiel. Der Tod des letzten Enkels von Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1885 wirkte dann als Initialzündung für einen enormen institutionellen Aufschwung der Germanistik. Jahrzehntelang hatte die wissenschaftliche Welt darauf gewartet, dass Goethes Nachlass endlich zugänglich wurde. Dessen Aufarbeitung wurde als nationale Aufgabe gesehen. Im Weimar wurde das Goethe-Archiv als erstes deutsches Literaturarchiv gegründet, mit dem Auftrag durch die Großherzogin Sophie von Sachsen, eine historisch-kritische Werkausgabe zu erstellen, die erst nach dem Ersten Weltkrieg 1919 abgeschlossene Weimarer Ausgabe, die in vier Abteilungen (Werke, naturwissenschaftliche Schriften, Tagebücher, Briefe) 143 Bände umfasst und damit die bis heute immer noch vollständigste Goethe-Edition ist. Folgenreich war vor allem die Entscheidung, in Textgestalt und Werkanordnung Goethes Ausgabe letzter Hand (seit 1827, Nachtragsbände bis 1842) zu folgen, sich also an Goethes eigenen editorischen Entscheidungen zu orientieren, die jeweils letzten Fassungen der Texte als Maßstab zu nehmen und die Werke nicht chronologisch, sondern nach Gattungen zu ordnen (vgl. Nutt-Kofoth 2012). Einen anderen Weg hatte die Edition Der junge Goethe eingeschlagen, die noch vor der Öffnung des Nachlasses erstmals 1875 erschienen war und die Jugendwerke‘ Goethes bis 1776 in ihren ersten Druckfassungen in chronologischer Folge edierte. Die zweite Ausgabe durch Max Morris 1909–1912 konnte dann auch die nachgelassenen Manuskripte berücksichtigen und zog die zeitliche Grenze 1775 mit Goethes Übergang nach Weimar. Die jüngste, vierte Ausgabe dieser Edition (hg. v. Eibl/Jannidis/Willems) erschien 1998 als Hybrid-Edition mit CD-ROM. Der junge Goethe ist damit längst zum Markennamen geworden, mit der Konsequenz, dass die Forschung die Schwelle 1775 meist als Ende einer Werkphase betrachtet.
Orientierung an den Vorgaben Goethes
Die Frühphase der Goetheforschung war durch die vorherrschenden editorischen Aufgaben philologisch geprägt – mit der Folge, dass die „Goethe-Philologie“ aufgrund ihrer Kleinteiligkeit schon bald als subalterne Ausdrucksform eines Goethe-Kults verstanden wurde (vgl. Braitmaier 1892). Quellen, Vorlagen und Entstehungsbedingungen sollten so genau wie möglich rekonstruiert werden, um in der Epoche des Historismus die Texte aus ihrer Entstehung erklären zu können. Damit wollte man in der Methode der Literaturwissenschaft Goethes eigenem Wissenschaftsverständnis folgen: „Natur- und Kunstwerke lernt man nicht kennen wenn sie fertig sind; man muß sie im Entstehen aufhaschen, um sie einigermaßen zu begreifen“ (an Carl Friedrich Zelter, 4.8.1803; II 5, 368). Entscheidend für die frühen Germanisten wie Wilhelm Scherer war, dass mit dem genetischen Paradigma ein Anschluss an die aktuelle wissenschaftliche Leitdisziplin der Entwicklungsbiologie in Form des Darwinismus möglich schien. Die Folgen dieser programmatischen Vermischung von Objekt- und Metaebene sind in der Neugermanistik, die methodisch und institutionell aus der Goethe-Philologie entstand, bis heute zu spüren, am unmittelbarsten bei einzelnen Segmenten der wissenschaftlichen Terminologie wie etwa den Gattungsbegriffen (vgl. Kap. IV.1). Auch die wissenschaftstheoretische Gegenbewegung zum ‚Positivismus‘ seit den 1910er Jahren, die philosophisch bestimmte ‚Geistesgeschichte‘, berief sich auf Goethe, zum Beispiel auf sein Verfahren der Naturforschung, die sogenannte „Morphologie“, die allgemein als geisteswissenschaftliche Methode dienen sollte. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein verfuhr die Goethe-Forschung in ihrer programmatischen Ausrichtung wesentlich zirkulär, weil sie sich immer an den Vorgaben des Autors orientierte.
Biographik: Leben als Kunstwerk
Noch in einer weiteren Hinsicht blieb die früheste Goethe-Forschung für viele Jahrzehnte prägend: Der Schwerpunkt auf der Entstehungsgeschichte der Texte führte nicht nur zu einer vorwiegend biographischen Deutung der Werke; vielmehr rückte das Leben des Autors selbst als zentraler Gegenstand wissenschaftlicher Darstellung in den Brennpunkt des Interesses. Richard M. Meyer etwa urteilte 1895 in seiner preisgekrönten Goethe-Biographie: „als ein wundervoll organisiertes Ganzes steht dies Leben vor uns – das größte seiner Kunstwerke“ (Meyer 1895, 3). Die Biographieschreibung war damit von vornherein mehr als die historische Rekonstruktion von Lebenstatsachen. Vielmehr ging es um die Unterscheidung zweier Ebenen: des realen und des eigentlichen‘, höheren Lebens in der Abfolge der Werke. Noch 1999 erhielt die Thomas-Mann-Biographie von Hermann Kurzke den Untertitel „Das Leben als Kunstwerk“, womit vermutlich unbewusst Meyer zitiert wird, woran aber vor allem ersichtlich ist, dass die Kategorien der frühen Goethe-Biographik – die ihrerseits aus Goethes Autobiographik abgeleitet wurden – noch in der jüngsten wissenschaftlichen Biographieschreibung nachwirken.
Von der „Klassik-Legende“ zur „Neuen Gelehrsamkeit“
Ein wissenschaftlicher Traditionsbruch wurde erst im Gefolge der 68er-Bewegung mit der ‚Klassikerschelte‘ der 1970er Jahre und dem Versuch einer Destruktion der „Klassik-Legende“ (Grimm/Hermand 1971) initiiert. Zuvor, in der Nachkriegszeit, war die Goethe-Forschung wertkonservativ, ja restaurativ ausgerichtet gewesen: Die durch den Nationalsozialismus zerstörte Humanität sollte ebenso im Rekurs auf Goethe restituiert werden, wie man der Besinnung auf Goethes Sprache eine reinigende Wirkung zutraute (in der Begründung des Goethe-Wörterbuchs 1947). In den 1980er Jahren gelang eine erfolgreiche Revitalisierung der Klassiker und damit auch Goethes, wobei die vorangegangene Politisierung der Germanistik sich zunächst in sozialgeschichtlichen Untersuchungen niederschlug. Dominierend in den 1980er und 90er Jahren waren jedoch ideengeschichtliche Forschungen (wie etwa Schöne 1982, Schmidt 1985, als Vorläufer Zimmermann 1969/1979), von Karl Robert Mandelkow mit dem Etikett „Neue Gelehrsamkeit“ versehen (Mandelkow 2001, 223–233).
Synthesen
Seit dieser Zeit sind vollständige Synthesen endgültig nicht mehr möglich, wie die beiden umfangreichsten und wichtigsten Gesamtdarstellungen von Leben und Werk dokumentieren: Karl Otto Conradys in den 1980er Jahren erstmals erschienene sozialgeschichtliche Biographie (Conrady 2006) enthält eingehende Textinterpretationen, muss jedoch auf eine Auseinandersetzung mit der Forschung verzichten. Die Biographie von Nicholas Boyle (1995/1999), bei der die zu einer bestimmten Lebensphase gehörenden Texte jeweils im letzten Abschnitt eines historischen Kapitels interpretiert werden, erreicht aufgrund des enzyklopädischen Zuschnitts eine prinzipielle Grenze, jenseits derer sie kaum mehr in fortlaufender Lektüre, sondern nur mehr in kursorischem Nachschlagen rezipiert werden dürfte, und ist überdies nicht abgeschlossen. Knappere Gesamtdarstellungen versuchen eine Aktualisierung unter Konzentration auf repräsentative Aspekte (vgl. Tantillo 2010, Hamacher 2010a).
Neue Paradigmen und Perspektiven
Neuen literaturtheoretischen Paradigmen wie Diskursanalyse (vgl. Bolz 1981), Dekonstruktion oder Gender-Forschung (vgl. Herwig 2002) ist die Goethe-Forschung in ihrer Breite (verglichen etwa mit der Forschung zu Autoren wie Kleist oder Kafka) eher verhalten gefolgt, obwohl sich nach wie vor die Geschichte der Goethe-Forschung als repräsentativ für die Geschichte der Neueren deutschen Literaturwissenschaft generell schreiben ließe. Einen Innovationsschub mit zahlreichen Publikationen, zumeist Sammelbänden, brachte das Goethejahr 1999. Einen wichtigen Schwerpunkt in jüngster Zeit bilden Arbeiten, die die Austauschbeziehungen von Literatur und Wissenschaften untersuchen und Literatur als genuine Wissensform in der Moderne verstehen (vgl. etwa Schößler 2002, Brandstetter 2003). Für einen solchen Zugriff ist Goethes multidisziplinär angelegtes Gesamtwerk besonders ergiebig. Ein derartiges kultur- und wissensgeschichtliches Konzept steht inzwischen auch hinter dem noch nicht abgeschlossenen Goethe-Wörterbuch, dem einzigen deutschsprachigen Autorenwörterbuch. Die vielfältigen Beziehungen zwischen Werkphasen, Schaffensbereichen und Diskursen werden anhand von Goethes Wortgebrauch dokumentiert, so dass die Lexikographie in vielen Fällen schon aufgrund der Breite der Materialdarbietung zu einem wichtigen Korrektiv oft zu selektiv vorgehender Interpretationen wird.
Editionen
Editorisch ist die Situation bei Goethe überraschenderweise nicht völlig befriedigend (vgl. Nutt-Kofoth 2005). Die Weimarer Ausgabe als historisch-kritische Ausgabe ist textkritisch in mancherlei Hinsicht problematisch. Zur dritten und vierten Werkabteilung, den Tagebüchern und den Briefen, sind in den letzten Jahren neue, reichhaltig kommentierte historisch-kritische Ausgaben begonnen worden, die zweite Abteilung wurde durch die (sich nicht als historisch-kritisch verstehende) Leopoldina-Ausgabe (LA) der naturwissenschaftlichen Schriften abgelöst. Für die literarischen Werke fehlt eine moderne historisch-kritische Ausgabe. Die in der ehemaligen DDR begonnene Akademie-Ausgabe wurde aus ideologischen Gründen abgebrochen, einige Textbände sind erschienen, nicht aber die zugehörigen Apparatbände. Ende der 1990er Jahre wurden zwei Studienausgaben abgeschlossen, die in ihren vorzüglichen Kommentaren den damaligen Stand der Forschung dokumentieren und eine Synthese der „neuen Gelehrsamkeit“ bieten: die nach Gattungen angeordnete Frankfurter (mit einer zweiten Abteilung mit ausgewählten Briefen, Tagebucheinträgen und Gesprächsäußerungen als Lebensdokumentation) und die nach Schaffensphasen gegliederte Münchner Ausgabe. In beiden Editionen sind die Texte (mit Ausnahmen) nach den Vorgaben der Verlage orthographisch normalisiert. Editorische Innovationen sind derzeit vor allem von der digitalen historisch-kritischen Faust-Edition zu erwarten, mit der die Goethe-Philologie an ihre einstige editionswissenschaftliche Vorreiterrolle wird anknüpfen können.