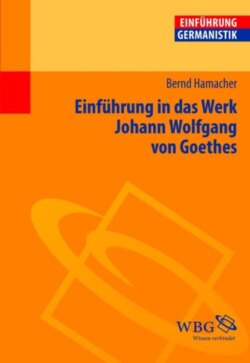Читать книгу Einführung in das Werk Johann Wolfgang von Goethes - Bernd Hamacher - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. Der Autor in seiner Zeit: Herkunft, Vita, Kontexte, Werkentwicklung
ОглавлениеHerkunft und Ausbildung
Johann Wolfgang Goethe hatte das Privileg, ohne finanzielle Sorgen aufzuwachsen. Er konnte (und musste) lange Zeit vom Vermögen seines Vaters Johann Caspar leben (vgl. Hopp 2010). Dessen Bildung und Erziehung bildete die Basis für den höchsten Aufstieg in der Ständehierarchie, der einem Nichtadeligen möglich war. 1748 heiratete Johann Caspar Goethe in die Führungselite der Freien Reichsstadt Frankfurt am Main ein. Seine so vielversprechend begonnene Karriere führte jedoch nicht zum Ziel, und er musste als Privatier vom ererbten Vermögen leben, aus dessen Zinserträgen die laufenden Haushaltskosten mühelos bestritten werden konnten. Der Lebenslauf von Johann Caspar Goethe zeigt, dass eine bürgerliche Karriere auch bei sorgfältiger Vorbereitung und unter günstigen Umständen kaum noch planbarwar. Die ersten Weichenstellungen für seinen Sohn Johann Wolfgang liefen allerdings, vor allem mit der Wahl des Studienortes Leipzig und des Studienfachs der Jurisprudenz, in die Richtung einer Imitation seines nicht von Erfolggekrönten Karrieremusters. Gleichwohl bildete die väterliche Lebensform die Voraussetzung dafür, dass Johann Wolfgang Goethe von Anfang an mit der Notwendigkeit konfrontiert war, sein Leben selbst gestalten zu müssen, um sich nicht wie sein Vater der Gefahr bürgerlicher Ziellosigkeit auszusetzen und sich auf ein Lebensmuster festzulegen, das sich im Übergang zur modernen bürgerlichen Erwerbsgesellschaft als überständig zu erweisen drohte. Das erkennbare Handlungsmuster sah so aus, dass er sich gegen das väterlicherseits vorgesehene Karriereprogramm ohne offene Rebellion durchzusetzen und gleichzeitig die Entlastung von materiellen Zwängen dankbar in Anspruch zu nehmen versuchte. Das daraus entwickelte Selbst- und Rollenmanagement wirkt aus heutiger Sicht modern, weist aber andererseits auf frühneuzeitliche Verhaltenslehren zurück, die auf ein flexibles, der jeweiligen Situation adäquates Verhalten abzielten. Daraus erklärt sich sowohl die renommistische Art seines Auftretens als junger Student in Leipzig als auch später seine selbstverständliche Bereitschaft zum Adelsdienst in Weimar.
Der Unterricht, den Goethe in seinem Elternhaus erhielt, war in seinen Inhalten umfassend, aber keineswegs ungewöhnlich; im Hinblick auf seine künftigen Fähigkeiten kann man jedoch im Nachhinein von einer glücklichen Konstellation sprechen. Der Schwerpunkt lag auf der religiösen Unterweisung und der Bibelkunde sowie auf den Sprachen: Latein, Griechisch, Französisch, Italienisch, Englisch, ferner auf eigenes Betreiben Hebräisch. Damit erhielt er als pädagogisches und kulturelles Kapital ein philologisches Handwerkszeug, das zu einer Bildungsform führte, die man gewöhnlich erst mit den Humboldt’schen Reformen und dem humanistischen Gymnasium zu Beginn des 19. Jahrhunderts verbindet. Hier lag die entscheidende Voraussetzung dafür, dass Goethe in den nächsten Jahrzehnten zur kulturellen ,Avantgarde‘ gehören oder diese sogar wesentlich prägen konnte. Ohne diese Schlüsselqualifikation, wie man heute sagen würde, wäre das flexible literarisch-kulturelle Rollenmanagement Goethes nicht möglich gewesen. So aber konnte er das jeweilige Milieu geradezu aufsaugen; das gilt für das reichsstädtische Frankfurt nicht weniger als danach für seine Studienorte, das galante Leipzig und die deutsch-französische Grenzstadt Straßburg. Die Zulassung zur Advokatur durch das Frankfurter Schöffengericht am 31. August 1771 ermöglichte ihm erstmals eigene Einkünfte, von denen er seinen Lebensunterhalt hätte bestreiten können, doch unterstützte ihn der beschäftigungslose Vater nun inoffiziell juristisch bei seinen Mandaten. Mit der Übersiedlung nach Weimar, der sich der Vater wohl weniger, wie oft vermutet, aus bürgerlichem Standesstolz als vielmehr aus einer realistischen Einschätzung der potentiell prekären Lage eines fürstlichen Favoriten widersetzte, vollzog Johann Wolfgang Goethe zwar im Alter von 26 Jahren den Schritt aus dem Elternhaus zum Erwachsenenleben, doch seine Jugend dauerte mehr oder weniger fort, insofern er nicht bürgerlich etabliert war und sich noch nicht aus eigenen Mitteln versorgen konnte. Nicht nur, dass ihm aufgrund der Männerkumpanei mit dem jüngeren Herzog Carl August unverantwortliches, spätpubertäres Verhalten vorgeworfen wurde (öffentlich durch Klopstock); auch auf widerstrebend und offenbar nur indirekt über die Mutter gewährte väterliche Zahlungen blieb er eine Zeitlang weiterhin angewiesen, zumal er – vor der Einführung des Urheberrechts – von dem ökonomischen Erfolg des Götz von Berlichingen und dann vor allem der Leiden des jungen Werthers nicht profitieren konnte. Damit zeigt sich bereits bei Goethe eine Problematik, die noch heute als teilweise repräsentativ für Nachkommen aus begüterten Bürgerhäusern bezeichnet werden kann: Das Aufwachsen ohne finanzielle Sorgen ermöglicht einerseits die Freiheit zur Selbstbestimmung und zum Selbstentwurf, gar zur Rebellion, führt aber andererseits zu oftmals besonders hartnäckigen und langwierigen Abhängigkeiten. Die Entlastung von der Notwendigkeit, frühzeitig den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu müssen, verhindert oder verzögert die Einschränkung der lebbaren Möglichkeiten zugunsten eines selbstverantwortlichen Lebensentwurfs. Als Schriftsteller war Goethe aufgrund dieser Ausgangskonstellation zu paradigmatischen Gestaltungen modernen Lebens in seinem Werk in der Lage (vgl. Hamacher 2010a). Durch die pekuniäre Absicherung seiner Jugend konnte Goethe eine zeitweise zumindest vom Habitus her geradezu pseudoaristokratische Existenz führen und auch als Schriftsteller zweigleisig fahren: auf dem Gleis von bürgerlichem Sturm und Drang und Empfindsamkeit, später dann der Klassik einerseits und als Hofdichter im Rahmen der aristokratischen Weimarer Festkultur (mit Singspielen, Maskenzügen und anderen Genres) andererseits.
Werkphasen: Jugend, Klassik, Spätwerk
Es scheint nahezu zwingend, Goethes erste Lebenshälfte, bis einschließlich seiner Rückkehr von der italienischen Reise, nach seinen Ortswechseln zu gliedern, mit den Fixpunkten Frankfurt, Leipzig, Frankfurt, Straßburg, Frankfurt, Weimar, Italien, Weimar. Nach der Rückkehr aus Italien 1788 hat Goethe seinen Wohnort Weimar bis an sein Lebensende nur noch für Reisen verlassen. Das topographische Ordnungsprinzip ist nicht nur deshalb so suggestiv, weil man sich damit in einem stabilen Rahmen bewegt – es scheint auch von der Sache her unmittelbar nahezuliegen, lassen sich doch jedem dieser Orte spezifische überindividuelle, allgemein kulturgeschichtliche Charakteristika zuordnen, die für Goethes Leben und Werk an diesen Orten jeweils eine entscheidende Rolle spielten: für Frankfurt die reichsstädtische, mittelalterliche und frühneuzeitliche Prägung, für Leipzig die galante, an Frankreich orientierte Kultur der Aufklärung und des Rokoko, für Straßburg die altdeutsche Volkskultur und die Gotik. Die zweite Lebenshälfte Goethes ist dagegen seit der Französischen Revolution eher von einer Opposition gegen die Zeitgeschichte dominiert, und daher fällt es schwer, sich von dem von der älteren Forschung geprägten dreiteiligen pyramidalen Modell zu lösen und die Jahre bis zur italienischen Reise anders denn als Aufstieg, die Italienreise nicht allein als Höhepunkt von Goethes Entwicklung, die lange Zeit danach nicht unter dem vorherrschenden Aspekt langsamen Abstiegs und der Isolierung zu sehen: der junge Goethe, der klassische Goethe, der alte Goethe. Insbesondere die Schwelle Weimar 1775 als Ende des Jugendwerks und des Sturm und Drangs wird meist stark betont – sei es pragmatisch (vgl. Valk 2012), sei es aber auch wertend (vgl. Blessin 2009).
Erstes Weimarer Jahrzehnt
Goethes erstes Weimarer Jahrzehnt wird im Hinblick auf den literarischen Ertrag meist negativ eingeschätzt, vor allen Dingen dadurch bedingt, dass die Bewertung vom Ende her, von der Flucht nach Italien 1786, vorgenommen wird. Man kann gewichtige Selbstaussagen Goethes dafür anführen, dass er an poetischer Unproduktivitat gelitten habe, durch höfische und amtliche ministeriale Geschäfte überhäuft gewesen sei (1782 wurde er geadelt und hatte dadurch die Spitze der Karriereleiter erreicht), dass das Verhältnis zu der Hofdame Charlotte von Stein zu einem immer bedrückenderen Problem geworden sei – und was der guten Gründe mehr sind, einen dunklen Hintergrund zu zeichnen, vor dem sich der italienische Himmel umso strahlender abheben kann. Literarisch gilt das erste Weimarer Jahrzehnt als Periode der Entwürfe und Fragmente, die Ausbeute erscheint auf den ersten Blick gering. Kein größeres Werk wurde abgeschlossen – keines der Dramen: nicht Egmont, nicht Iphigenie, nicht Tasso, geschweige denn Faust, den Goethe aus Frankfurt mitgebracht und dann über ein Jahrzehnt liegengelassen hatte; aber auch der zweite Roman, Wilhelm Meisters theatralische Sendung, an dem er kontinuierlich arbeitete, blieb unbeendet. Bedenkt man allerdings, dass die angebliche poetische ‚Neugeburt‘ Goethes in Italien zunächst kein neues größeres literarisches Projekt zeitigte, sondern lediglich die Umarbeitung und teilweise Fertigstellung dessen, was in Weimar begonnen worden war, so relativiert sich die Sicht, und man kann durchaus behaupten, dass das erste Weimarer Jahrzehnt an Produktivität der Zeit davor nur deshalb nachstand, weil die offiziellen Verpflichtungen in einem solchen Maße zugenommen hatten, dass die Ausführung mit der gestaltenden Einbildungskraft nicht mehr Schritt halten konnte. Grundsätzlich zeigt sich jedoch die gelungene Assimilierung Goethes an die aristokratische Kultur Weimars, den von der Herzoginmutter Anna Amalia initiierten ‚Musenhof‘, vor allem im Hinblick auf das Theater. Erkennbar wird die künstlerische Weiterentwicklung im Drama mit der Abwendung von Sturm und Drang und Empfindsamkeit, während die poetologische Selbstreflexion auf dem Gebiet der Lyrik nur einem kleinen Kreis bekannt wurde. Die amtliche Tätigkeit Goethes als Minister führte auch zu spannungsreichen Folgen auf literarischem Gebiet, wie sich etwa bei der Prosafassung der Iphigenie zeigt.
Italienische Reise, Französische Revolution und die Folgen
Literarisch erbrachte die italienische Reise zunächst die Fortführung und teilweise Beendigung von begonnenen Projekten. Die Kontinuität in der Entwicklung von der Empfindsamkeit zur Frühklassik lässt sich etwa bei der Entstehungsgeschichte der Iphigenie auf Tauris feststellen. Ästhetisch vollzog sich eine programmatische Hinwendung zur Antike, ablesbar an der Verwendung antikisierender Formen und mythologischer Stoffe sowie einer neuen, sinnlich-erotischen gegenüber der bisherigen eher enthusiastischspirituellen Liebeskonzeption – beides, antikisierende Form und antiker Gehalt, zusammengeführt beispielsweise in den Erotica Romana, den später so genannten Römischen Elegien. Vorherrschend war ferner die Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst in Theorie und Praxis, aber auch die Hinwendung zur Naturforschung wurde in Italien vorbereitet. Beides reflektiert Goethe schon vorab in seinem Reisetagebuch in Venedig am 5.10.1786:
Auf dieser Reise hoff ich will ich mein Gemüth über die schönen Künste beruhigen, ihr heilig Bild mir recht in die Seele prägen und zum stillen Genuß bewahren. Dann aber mich zu den Handwerckern wenden, und wenn ich zurückkomme, Chymie und Mechanik studiren. Denn die Zeit des Schönen ist vorüber nur die Noth und das strenge Bedürfniß erfordern unsre Tage. (GT I 1, 266)
Goethe verstand also selbst seine italienische Reise weniger als Beginn einer Epoche (der Klassik, von der dann erst im 19. Jahrhundert mit Bezug auf Goethe gesprochen wurde) denn als deren Abschluss. Das zeigt sich auch daran, dass er von Italien aus seine erste Gesamtausgabe initiierte, die als Goethe’s Schriften in acht Bänden von 1787–90 beim Verleger Göschen in Leipzig erschien. Nach seiner Rückkehr aus Italien fühlte sich Goethe isoliert – ästhetisch, weil er seine künstlerischen Erfahrungen der Weimarer Umgebung nur unzureichend vermitteln konnte, aber auch gesellschaftlich durch die 1788 begonnene Lebenspartnerschaft mit Christiane Vulpius. Der 1789 geborene Sohn August wurde erst 1801 legitimiert, 1806 fand schließlich die Hochzeit statt. Ein geradezu traumatisches Ereignis stellte für Goethe die Französische Revolution dar, an deren Folgen er sich jahrelang abarbeitete und mit der für ihn die „Zeit des Schönen“ in zentraler Hinsicht tatsächlich „vorüber“ war. Eklatant ist die veränderte Wahrnehmung Italiens bei seiner Reise nach Venedig 1790, wo er auf die Rückkehr von Herzogin Anna Amalia wartete, die er abholen sollte. Nun richtete sich der Blick nicht mehr auf die idealisierte Vergangenheit der Antike, sondern auf die negativ gesehene Gegenwart. Von August bis Oktober 1792 musste Goethe Herzog Carl August auf dem Frankreichfeldzug im ersten Koalitionskrieg gegen die französische Revolutionsarmee begleiten. Im Unterschied zu den meisten deutschen Künstlern und Intellektuellen gehörte Goethe zu den entschiedenen Revolutionsgegnern, was ihn allerdings in späteren Jahren vor Enttäuschungen über den Revolutionsverlauf bewahrte, so dass seine Äußerungen dann oft gemäßigter klingen als bei ehemaligen Revolutionsanhängern. Gegen den Nationalismus der antinapoleonischen Befreiungskriege war er weitgehend immun. Politisch war Goethe ein Anhänger des aufgeklärten Absolutismus und der Reformen von oben, befürwortete aber auch entschiedene obrigkeitliche Maßnahmen wie die Zensur (etwa gegen Professoren und Studenten der Universität Jena, für die er als Minister verantwortlich war). Die Einschätzung des politischen‘ Goethe ist in der Forschung besonders umstritten (vgl. Vaget2005).
Kulturpolitik in Zusammenarbeit mit Schiller
Durch die Zusammenarbeit mit Schiller fand Goethe ab 1794 aus seiner Isolation heraus. Nun entstand das, was später die ‚Weimarer Klassik‘ genannt wurde, als kultur- und literaturpolitisches Projekt (vgl. Barner/Läm-mert/Oellers 1984), zunächst in der Mitarbeit an Schillers Zeitschrift Die Horen, dann in Schillers Musenalmanachen mit der Publikation der Balladen und der polemischen Xenien. In Gesprächen und Briefen wirkte Schiller auf den Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre, die Weiterführung des Faust und andere Werke Goethes ein. Schillers Tod 1805 bedeutete für Goethe abermals einen epochalen Einschnitt, der zu einer (durch Krankheiten zusätzlich beförderten) grundsätzlichen Verdüsterung seiner Weltsicht führte. Ein Teil der älteren Forschung sah dies so, dass Goethe nach dem Ende des mit völkischem Vokabular als ‚Überfremdung‘ bezeichneten Einflusses Schillers zu seiner ursprünglichen ‚dämonischen‘ Weltanschauung zurückgekehrt sei (vgl. Pyritz 1962). Richtig ist allerdings, dass Goethes späteres Werk etwa seit den Wahlverwandtschaften mit klassizistischen Kategorien nicht mehr angemessen zu erfassen ist, was dazu führte, dass es von den Zeitgenossen immer weniger verstanden und erst im 20. Jahrhundert in seiner Modernität wiederentdeckt wurde. In seinem Stil kann man eine zunehmende Objektivierung, Verdichtung und Verknappung des Ausdrucks beobachten, besonders charakteristisch in den umfangreichen Spruchsammlungen zu unterschiedlichsten Themen, die vor allem in dem Altersroman Wilhelm Meisters Wanderjahre enthalten waren und in späteren Ausgaben unter dem Titel Maximen und Reflexionen bekannt wurden.
Projekte des Spätwerks
In Goethes späteren Jahren wurde der persönliche Austausch immer stärker durch umfangreiche briefliche Korrespondenzen ersetzt. 1814/15 brach er noch einmal zu zwei größeren Reisen in die Rhein- und Maingegenden auf, was zu einer gegenläufigen imaginären Orientreise (im West-östlichen Divan) einerseits und andererseits nach den Jahren eines rigorosen künstlerischen Klassizismus (etwa in der Zeitschrift Propyläen) zu einer Bereicherung seines Kunstverständnisses im Hinblick auf die deutsche Kunst des Mittelalters und daher auch zu einer Veränderung seines Verhältnisses zur Romantik führte. Der Ertrag der Reise wurde gewissermaßen archiviert, in den Heften Über Kunst und Altertum (1816–32). Neben das kunsthistorische trat in den späten 1810er und 20er Jahren noch ein weiteres, nämlich ein naturwissenschaftliches Zeitschriftenprojekt, die Hefte Zur Morphologie. Ein wichtiger Einschnitt im Hinblick auf seine praktische künstlerische Tätigkeit war die Niederlegung der Direktion des Weimarer Hoftheaters Mitte März 1817. Er hatte den Direktionsposten seit der Eröffnung 1791 innegehabt. Goethe zog sich in seinen späten Lebensjahren immer mehr zurück und beschäftigte sich mit seinen umfangreichen Sammlungen. Ab 1827 erschien dann sein Vermächtnis, die Ausgabe letzter Hand, 1828/29 seine Edition des Briefwechsels mit Schiller, die er seit 1823 vorbereitete. Goethe wurde sich selbst historisch und arbeitete an seinem Nachruhm. Nach seinem Tod 1832, der von den Zeitgenossen als Ende einer Epoche verstanden wurde, lebte sein Werk unter anderem mit der Publikation von Faust II und des vierten Bandes von Dichtung und Wahrheit weiter.