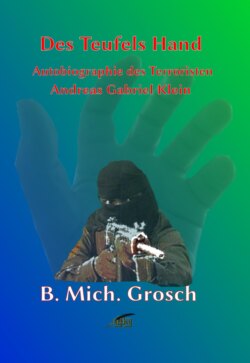Читать книгу Des Teufels Hand - Bernd Michael Grosch - Страница 5
Mein Grund war die Bekanntschaft mit der Nadel. –
ОглавлениеIch begann mit Morphiumampullen aus der Apotheke und war schon bald beim Heroin, welches zu jener Zeit noch äußerst sauber und nahezu rein, von amerikanischen Soldaten zu erstehen war.
Ohnehin noch nie ein starker Esser, vergaß ich jetzt manchmal für zwei Tage oder mehr, einfach etwas zu essen und verlor freilich rapide an Gewicht. Doch fühlte ich mich selbst tatsächlich wohl dabei.
In dieser Zeit meiner Lehre erfuhr ich zum ersten mal Etwas über andere Religionen. Ein Buch über Zen-Buddhismus in Japan kam mir – ich kann mich heute nicht mehr an das Wie erinnern – in die Hände.
Freudig erregt stellte ich fest, dass die Lehren des Buddha in etwa meinen eigenen Gedanken entsprachen.
Ich begann, mich in die südasiatischen Religionen zu vertiefen – und ein Entschluss reifte in mir.
– Ich wollte nach Indien gehen; eines Tages wollte ich dorthin.... Es schien mir das Land meiner langjährigen Träume und Phantasien. Ich verschlang alles, was ich an Lektüre über dieses südasiatische Land nur bekommen konnte. Goa galt außerdem als das Drogenparadies schlechthin.
Drogen und Glaube; wie gut passte dies doch zusammen !
Drogen waren mitnichten Mittel zur Betäubung; dies war der Alkohol, sowie die Einstellung der älteren Generation! Drogen waren dazu da, das Bewusstsein zu erweitern oder gegebenenfalls zu verändern.
`Rauschgift ́- welch alberner und herabsetzender Begriff ! Berauscht waren die Älteren und Eltern von den Hetzreden der Nazis; Gift war das erzwungene deutsche Erbe. Drogen sollten uns endgültig davon befreien ! Altes Denken überkommen; neue, friedvolle Wege gehen; endlich den Überfluss unserer Gesellschaft mit den ärmeren Nationen teilen; dies waren Ziele, für die Unsereiner bereit gewesen wäre, zu kämpfen auf die eine oder andere Weise.
Manche taten dies, indem sie sich auszogen, um nackt – als Flitzer – wie sie bald genannt wurden, durch Parks oder auch belebte Straßen zu laufen. Andere nahmen an Demonstrationen teil und prügelten sich mit der Polizei; wieder Andere nahmen gar die Waffe in die Hand, um mit dem Establishment auf blutige Weise aufzuräumen.
Bei uns Drogenleuten war Gewalt gegen Andere verpönt. Die einzige Gewalt, die wir kannten, war die gegen unsere eigenen Körper und gegen unser Leben und unsere Gesundheit.
Keiner von uns hatte die Sehnsucht, in einer solchen Welt sehr alt zu werden. Wir wussten, dass wir, die wir an der Nadel hingen, unsere Körper zerstörten und wir akzeptierten es.
- Mit dem eigenen Tod auf die Missstände der Gesellschaft aufmerksam machen, das war für Manchen von uns erwünschtes Märtyrertum.
Als Symbol für Gewalt galt nicht nur die Atombombe, die Leute wie mich in eine Endzeitstimmung versetzen wollte, sondern schlechthin alles, was in irgendeiner Weise mit `Atom ́ zusammenhing. – So wurden Atomkraftwerke verteufelt und gegen sie demonstriert –
und Proteste wurden nicht mehr nur mit Transparenten bekundet, sondern gewisse Gruppen wollten auch vor Gewalttaten nicht mehr zurückschrecken. Ich selbst war – damals noch – nicht dazu bereit.
Meine Lehre brach ich vorzeitig ab, arbeitete noch etwa ein halbes Jahr als Laborant in einem großen Chemieunternehmen und verließ dann, ohne Wissen meiner Eltern, im Januar 1973 Deutschland, um mir einen anderen Teil der Welt anzusehen und mein Traumziel Goa zu erreichen.
Mit dem Istanbul–Express fuhr ich direkt bis zu der türkischen Stadt am Bosporus, woselbst ich einige Tage verweilte, um dann wiederum mit der Eisenbahn weiter nach Malatya, im Osten der Türkei, weiterzufahren.
Ohne irgendwelche Kenntnisse des Englischen oder sonst einer Fremdsprache war ich aufgebrochen; mit winziger Reisekasse, doch voll-bepacktem Rucksack.
Die Türken erwiesen sich als überaus gastfreundlich und hilfsbereit und ich liebe dieses Volk noch heute dafür. – Ich blieb einige Tage zu Gast bei einer kurdischen Familie, deren Sohn ich im Zug von Istanbul nach Malatya kennengelernt hatte und der auch gerade aus Deutschland zurückgekehrt war, wo er als Gastarbeiter sein Geld verdiente. Er sprach ein recht gutes Deutsch.
Überhaupt fanden sich erstaunlich viele Türken, welche der deutschen Sprache mächtig waren.
Weiter ging es nach Persien – den heutigen Iran. – Noch war der Schah an der Macht; die Straßen waren hervorragend und noch das kleinste Dorf hatte einen mit bunten Lichterketten beleuchteten, mit Blumenrabatten angelegten Dorfplatz, auf welchem die Statue des Reza Pahlevi prunkte.
Man erkannte auf den ersten Blick, dass dies kein armseliges Entwicklungsland war. Benzin war spottbillig – und die Leute hatten Geld.
In Teheran sah man verschleierte Frauen neben ihren modernen, mini-berockten Landesschwestern.
Im `Amir–Kabir-Hotel' stieg ich ab; beliebtes Hippie-Ziel, so wie der `Pudding-Shop ́ in Istanbul Magnet für Meinesgleichen war.
An den persischen Grenzen strenge Drogenkontrollen; doch war man erst einmal im Land, konnte man in Apotheken verschwiegen Morphiumampullen deutschen Fabrikats erstehen.
Überhaupt gab es viele deutsche Waren in Persien. Deutsche Markenschuhe; fabrikneue Lastwagen mit dem bekannten Sternsymbol fuhren im Konvoi von West nach Ost.
Viele Perser sprachen französisch; weniger englisch; leider, da es mir so schwerer wurde, hier die ersten Englischkenntnisse zu erwerben.
Afghanistan. Die Karte vermerkte lediglich zwei Hauptrouten, auf welchen man nach Pakistan gelangen konnte. Ich nahm die kürzere, nördliche.
Wunderliche, bärtige, mit Flinten bewaffnete Männer, von welchen etliche mich an den `Räuber Hotzenplotz ́ aus meinen Kindertagen erinnern wollten.
Noch herrschte der König in Afghanistan, der jedoch noch im gleichen Jahr, ich glaube, September oder Oktober, ins Exil flüchten sollte.
Kabul gab sich in einem oder zwei Hotels westlich orientiert, ansonsten interessantestes Mittelalter.....
Es war eisig kalt und der Schnee lag hoch. Ich musste auf dem Markt Holz kaufen, um in meinem Hotelzimmer den Ofen heizen zu können. Einen weiß-gelblichen Hund, der mir mehrere hundert Meter weit hinterherlief, fütterte ich mit Brot und er folgte mir bis in den Innenhof des Hotels. – Dort trieb er sich dann weiter herum und wurde erneut von mir gefüttert. – Nach Einbruch der Dunkelheit öffnete ich die Zimmertür, welche nach jenem Innenhof lag, um nach meinem neugewonnenen Freund zu sehen und ihn ins warme Zimmer zu lassen.
Er war immer noch anwesend, doch mit ihm auch ein weiteres Dutzend streunender Straßenhunde.
Lachend ließ ich die ganze Bande ein und tatsächlich verhielten sie sich die ganze Nacht über mucksmäuschenstill. Hatte mein vierbeiniger Freund ihnen von dem verrückten Langhaarigen erzählt ?
Ich mochte das frischgebackene, dicke afghanische Fladenbrot, Nan genannt. Es war mit Sesamsamen bestreut und ich bestrich es mit Marmelade oder aß Schafskäse dazu.
Weiter ging es nach Pakistan. Dort waren Polizisten sowie Soldaten sehr freundlich und luden mich des Öfteren zu einem Glas Milchtee ein. In Peshawar lernte ich das`Hamam ́ kennen.
Da es in dem billigen Lodge, in welchem ich übernachtete, kein Badezimmer gab, war ich gezwungen, in ein öffentliches Badehaus zu gehen. Weit entfernt vom Standard eines türkischen Bades gleichen Namens, wurde man in eine kleine Kabine geführt, wo man gegen Bezahlung heißes und kaltes Wasser in einen großen Behälter geleitet bekam. Seife und Handtücher erhielt man gleichfalls.
In Lahore gab es gleich mehrere Anlaufstellen für Touristen meiner Kategorie. Ich mietete mich im `Happy-Inn ́ ein, auf dessen Flachdach allabendlich die mit Haschisch bestückte Wasserpfeife benutzt wurde. – Beim Hotel-Manager konnte man Haschisch oder auch Morphium bestellen – und bekam es dann aufs Zimmer geliefert.
Dort, in jenem Hotel, lernte ich auch das englische `Porridge ́ kennen und aß es jeden Morgen.
Pferde-Tongas waren die Taxis oder Rikschas in Lahore und mir taten die mageren, armseligen Pferdchen sehr leid, die anscheinend mehr von der Peitsche, als vom Futter lebten.
Vor meiner Abreise nach Indien bestellte ich beim geschäftstüchtigen Manager ein Kilogramm Haschisch zum Preis von zehn amerikanischen Dollar. Ich gedachte, dieses in Goa zu verkaufen und so meinen Aufenthalt im 'Gelobten Land' weiter zu finanzieren. Meine Geldmittel waren nun äußerst beschränkt, so dass dies eine willkommene Möglichkeit bot - zumal Touristen aus der anderen Richtung, welche sich also auf dem Heimwege befanden, berichteten, dass Haschisch in Goa bedeutend kostspieliger sei als in Pakistan. –
Der Grenzübergang nach Indien, welcher nur an ein oder zwei Tagen in der Woche geöffnet war, sei so überlastet, dass eingehende Kontrollen unmöglich seien und somit die Chancen gut stünden, unkontrolliert die Schmuggelware über die Grenze bringen zu können....
Das in eine Plastikfolie verpackte Haschisch bekam seinen Platz unterhalb des Bauchnabels in meiner Hose. – Es handelte sich dabei um vier gepresste Platten grünen, pakistanischen Haschischs, welches außerordentlich ölhaltig war. Dieser Umstand sollte später in Goa leider den Verkaufspreis empfindlich nach unten drücken.
Der Übergang in den indischen Punjab verlief tatsächlich ohne jegliches Problem und befreit konnte ich aufatmen.
Amritsar; Besuch im `Goldenen Tempel, ́ dem Heiligtum der Religionsgemeinschaft der `Sikh ́, welches viele Jahre später zu traurigem Ruhm gelangen sollte!
Nach zwei oder drei Tagen ging es weiter nach Delhi; von da aus nach Bombay. –
Diese Stadt war unbeschreiblich. Einerseits die imposanten Gebäude aus der britischen Kolonialzeit; andererseits ein unsägliches Konglomerat von Dreck, Lärm und Gestank ! Bettler mit verdrehten Gliedmaßen;
Hunde mit von der Eisenbahn abgefahrenen Beinstümpfen; frei im Taxi– und Busverkehr laufende Zebu-Rinder....
Wollte ich eine vielbefahrene Hauptstraße überqueren, so brauchte ich nur eine Kuh vor mir her über die Straße zu treiben; sofort stand der Verkehr still. Für mich alleine hätte man nicht gebremst.
Ich mochte weder die Stadt, noch die in ihr lebenden Menschen, was auch bis heute so geblieben ist.
Mit einem Küsten–Passagierschiff fuhr ich nach Panjim in Goa. Wir legten am Morgen in der goanischen Hauptstadt an und ich nahm einen Überlandbus nach Calangute. – Calangute war einer von drei oder vier Stränden, an welchen sich die Hippies und Globetrotter aus aller Welt trafen, um L.S.D.–Partys bei Vollmond zu feiern und ansonsten allen erdenklichen Drogen und Sonne und Meer zu frönen.
Für mich war Alles neu, exotisch und morphium–vernebelt angenehm–schön.
Ich mietete ein Häuschen am Strand, aß Opium, spritzte Morphium – dann wieder Heroin; verkaufte mein mitgebrachtes Haschisch zu leider niedrigerem Preis, als erhofft – und musste irgendwann beginnen, mitgebrachte Utensilien wie Fotoapparat, Kassettenrekorder, Ledergürtel und Ähnliches, zu verkaufen, um mich weiterhin zu finanzieren.
Mit der Zeit kam die Gewöhnung an das anfänglich Neue und Schöne und andere Dinge zogen mein Augenmerk auf sich. Diese waren weit weniger schön zu nennen.
Wir aus dem Westen waren dabei, eine Kultur zu zerstören. Nacktbaden, öffentlicher Sex am Strand; dies Alles widersprach der goanischen Denkungsart und würde, so meine Befürchtung, zu nichts Gutem führen.
Indische Touristen kamen von überall her, um die Nackten zu bestaunen – und ich begann, mich für das, was Meinesgleichen hier an den Tag legte, zu schämen....
Noch vor Ablauf meines Drei–Monats–Visums fuhr ich nach Bombay und bat beim Deutschen Konsulat um meine Rückführung nach Deutschland, welche auch bewilligt wurde.
Die Wartezeit auf den Flug verbrachte ich im ungeliebten Bombay, was mich nur in meinem Entschluss bestärkte: Nie wieder Indien! In Goa litt ich an Hepatitis; danach durch verschmutztes Brunnenwasser an der Ruhr; Alles in Allem keine allzu erfreulichen Erinnerungen also und ich freute mich allen Ernstes auf das saubere Deutschland. –
April. – Später Schnee und elend kalt. Ich stand bei Frankfurt auf der Autobahn, braungebrannt, die Haare bis in den Rücken reichend, nur mit einer dünnen indischen Leinenhose, ebensolchem, offenen Leibchen nebst Sandalen bekleidet und fror mir die Seele aus dem fast nur noch aus Haut und Knochen bestehenden Leibe.
Eine erstaunte, mitleidige Geschäftsfrau ließ mich in ihren Wagen einsteigen, um mich fast bis zu meinem gewünschten Ziel zu bringen.
Im Elternhaus erst einmal wieder aufgepäppelt, ließ ich auch, nach mehrtägigen Schweißausbrüchen, Magenkrämpfen und anderen Entzugserscheinungen, die Finger von der Spritze.
Ich suchte mir eine Arbeit als Lagerarbeiter, erneuerte eine frühere Beziehung zu einem Mädchen und blieb bis 1975 im Lande....
Meine Eltern fuhren in Urlaub und ich sollte sie begleiten, was mich allerdings in keinster Weise ansprechen wollte. Ich packte wieder meinen Schlaf– und Rucksack zusammen und machte mich heimlich auf, um nach Marokko zu gelangen.
In Marseille übernachtete ich mit einem Fremden in einem billigen Hotelzimmer und habe bis heute nur noch eine verschwommene Erinnerung an den Versuch dieses Fremden, meine Armbanduhr zu stehlen.-
Ich fuhr weiter nach Spanien und spürte irgendwann, dass irgendetwas mit mir nicht stimmte:
- Ich hatte niemals spanisch gelernt und glaubte dennoch, zu verstehen, was die Menschen sprachen. Nach ein oder zwei weiteren Tagen wurde ich von Wahnvorstellungen befallen und war mir sicher, dass die Menschen mich beschimpften. – Sah ich direkt in Deren Augen, so hörten sie mit den Beschimpfungen auf.
- In der Wartehalle eines Bahnhofes sitzend, hörte ich aus den Lautsprechern die Stimme des Teufels selbst – und ich kann versichern, dass ich weder zuvor noch später in meinem Leben eine solch hässliche, abstoßende und widerwärtige Stimme vernommen habe.....
Irgend etwas in mir wehrte sich dennoch gegen die Vorstellung, besessen zu sein und nach mehreren schlaflosen Nächten, in welchen ich von dieser und auch anderen Stimmen heimgesucht wurde, auch am Tage verließen sie mich nicht, beschloss ich, zurückzukehren und in Deutschland ärztliche Hilfe zu suchen.
Von diesem gleichen Moment an war ich frei von jenem mich unsäglich ängstigenden Phänomen und ich habe bis zum heutigen Tage noch keine befriedigende Erklärung dafür gefunden. –
Lange Zeit schon hatte ich keine Drogen mehr genommen und der Vorfall in jenem Hotelzimmer in Marseille fiel mir erst nach vielen Jahren wieder ein; doch bin ich mir auch heute noch nicht gewiss, ob man mir damals irgendein Mittel einbrachte, um mich zu berauben....
Ich kam zurück in die elterliche Wohnung, wusch alle meine Kleidung in der Waschmaschine und hing sie zum Trocknen auf den Dachboden.
Geld hatte ich keines mehr. – Nichtsdestotrotz entschloss ich mich, zurück nach Indien zu fahren.
... Erinnerung trübt sich mit der Zeit und vergessen war mein: `Nie wieder Indien ! ́
- Meine gewesene Freundin fuhr mich auf meine Bitte zum Autobahnzubringer einer benachbarten Stadt. Auf ihre Frage nach meinen finanziellen Mitteln, musste ich eingestehen, dass ich ohne auch nur einen Pfennig war. Sie erklärte mich für verrückt, gab mir alles Geld, was sie mit sich führte - es waren fünfzig Mark – und wies mich an, auf sie zu warten; sie wolle zur Bank fahren und Geld für mich abheben. Ich versprach dies jedoch nicht, sondern erklärte, dass ich, sollte sich eine Mitfahrgelegenheit ergeben, ich diese ergreifen und in jedes Fahrzeug, welches für mich anhielte, einsteigen würde.
Tatsächlich hielt bereits das dritte oder vierte Auto und ich lud meinen etwa 75 kg schweren Rucksack ein und war unterwegs...
Zuletzt hatte ich, nach meinem Job als Lagerarbeiter, als Gerüstbauer gearbeitet und war somit außerordentlich kräftig, so dass es mir möglich war, dieses doch nicht gerade geringe Gewicht auch über eine längere Strecke zu tragen.
-- Mit fünfzig Mark nach Indien. Man mag mich vielleicht für einen Spinner oder schlimmer noch – einen Lügner halten - doch hatte ich soviel Gepäck auch aus dem Grunde mitgenommen, um beispielsweise Jeans, welche in Indien, außer in Goa und Bombay, noch weitgehend unbekannt und nicht erhältlich waren, zu verkaufen. Außerdem befand sich ein Fotoapparat sowie eine ganze Sammlung von Ledergürteln in meinem Gepäck, welche ebenfalls zum Verkauf bestimmt waren.
`Made in Western Germany ́ war damals noch ein Zauberwort und ich war mir gewiss, mich so eine gute Weile über Wasser halten zu können. Dazu muss noch gesagt werden, dass zu jener Zeit Afghanistan das einzige Land auf dieser Route war, welches von Deutschen ein kostenpflichtiges Visum verlangte; alle anderen Länder waren frei und man bekam das kostenfreie Visum bei der Einreise in den Pass gestempelt.
Ich hatte die Absicht, diesmal Afghanistan zu umgehen und südlich davon direkt von Persien nach Pakistan zu reisen. – Somit würden für mich keine Extraunkosten entstehen. Doch gebe ich heute freilich zu : Es war eine Fahrt ins Ungewisse....
Nach dreieinhalb Wochen war, nach etlichen Wechseln der Mitfahrgelegenheiten, das Ziel erreicht. –
Drei Tage Goa; dann hatte ich die Nase wieder voll und machte mich auf nach Delhi.
Nach einiger Zeit in einem Hotel in Alt–Delhi schrieb ich meiner Freundin einen Brief und bat sie, mir das Geld für den Rückflug zu überweisen. –
Im gleichen Lodge lernte ich einen Sikh aus dem Punjab kennen, der auf Heimaturlaub zurück in sein Dorf wollte. Er arbeitete hier in Delhi als Taxifahrer. Der damals etwa fünfzigjährige Mann lud mich ein, mit ihm zu kommen und als sein Gast zu bleiben, bis mein Geld einträfe. – Bei der Bank in Delhi gab er seine Bankverbindung im Punjab an und wir machten uns auf den Weg.
Nach sechs angenehmen und interessanten Wochen in seinem Heim wurde mir unwohl bei dem Gedanken, seine Gastfreundschaft weiterhin in Anspruch zu nehmen; ich war zu der Überzeugung gelangt, dass das erwartete Geld nicht überwiesen war.
Gegen den Willen der Gastfamilie machte ich mich auf den Weg zur pakistanischen Grenze, um wieder als Anhalter den Rückweg anzutreten. ( Bei meinem nächsten Indienbesuch erfuhr ich dann, dass am gleichen Tage - ich war am Morgen aufgebrochen - am späten Vormittag auch das Geld eintraf. Mein Gastgeber erkundigte sich telefonisch an der Grenze nach mir, um zu erfahren, dass ich dieselbe bereits überschritten hatte. )
Wiederum benötigte ich dreieinhalb Wochen und wurde von einem kanadischen Pärchen, welches halbjährlich in Holland lebte, von kurz hinter Ankara, der türkischen Hauptstadt, bis in mein Heimatdorf mitgenommen.
(Das überwiesene Geld wurde von dem ehrlichen Sikh wieder zurückgeschickt.)
- Nach einem Jahr und drei Monaten war ich zum dritten mal unterwegs nach Indien. Diesmal sollte ich sechs Monate bleiben.
Ich kam mit dem Flugzeug und hatte 10 000 DM dabei, was damals für Indien sehr, sehr viel Geld war. Ich, der ich noch niemals ein sparsamer Mensch war, gab diese Summe in einem Zeitraum von knapp zweieinhalb Monaten aus.
Gut die Hälfte davon ging an Arme und Bedürftige – oder Solche, die vorgaben, bedürftig zu sein – und davon gab es in diesem Land schon immer mehr als genug.
Die andere Hälfte verbrauchte ich selbst; in Hotels, Varietés und mit Umherreisen.
Ich kam zuletzt nach Madhya–Pradesh in Zentral–Indien, wo es noch riesige Dschungelgebiete gab mit unterschiedlichen Eingeborenenstämmen. Trotz Abratens befreundeter Studenten in Jagdalpur, begab ich mich in das angeblich wildeste und rückständigste Gebiet Indiens, in welchem immer noch nackte Wilde jeden Eindringling mit Pfeilen beschießen sollten. –
Dies Letztere stellte sich als eines der vielen indischen Märchen heraus.
Die Mariah von Abuzmar schossen zwar tatsächlich noch mit Pfeil und Bogen, doch nur zum Zweck der Jagd auf Tiere.
- Aufgrund einer schweren Malaria musste ich dieses mich ansprechende Gebiet wieder verlassen.
In Raipur, im Heim eines Verwandten meiner Jagdalpur–Freunde, wurde ich gepflegt, doch weigerte ich mich strikt, Malaria–Medikamente einzunehmen. Ich war bereits vom Fieberwahn befallen und schrieb die Erkrankung irgendwelchen Geistern zu.
Es gelang mir dennoch, mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland zu gelangen, wo ich am nächsten Tag in ein Krankenhaus gebracht und auf einer Isolierstation behandelt wurde.
Zwei Beutel Blutplasma wurden unverzüglich verabreicht und ich sollte mindestens für sechs Wochen bleiben, doch dank der erstaunlichen Regenerationsfähigkeit meiner roten Blutkörperchen verließ ich die Klinik bereits nach zehn Tagen.
Es folgte wieder ein gutbezahlter Job, doch ich fühlte mich beengter, als je zuvor und begann zu trinken.
Tagsüber, bei der Arbeit, trank ich keinen Tropfen; jedoch nach Feierabend Zuhause, ich hatte bereits eine eigene Wohnung, trank ich gleich mehrere Whisky auf Eis. –
Innerhalb eines Jahres steigerte ich diese Menge auf eine ganze Flasche. Ich bemerkte eben noch rechtzeitig, dass ich im Begriff war, zum Alkoholiker zu werden und suchte einen Arzt auf, der mir Tabletten verschrieb. –
Ich ließ das Trinken komplett sein, warf meinen Job hin und flog - es war im Jahre 1977 – nach Karachi in Pakistan. Eine Nacht in einem feinen Hotel ( sogar mit Badewanne ) – dann ging es weiter nach Lahore.
- Lahore gefiel mir und ich blieb gleich zwei Wochen dort.
- Wieder weiter in den indischen Punjab, meinen Sikh–Freund besuchen, ein Geschenk übergeben und am nächsten Tage schon – mein Freund hatte einen Auslandsjob gefunden und musste auch weg – weiter nach Amritsar. Erneuter Besuch im Goldenen Tempel; zwei Tage später fuhr ich nach Nagpur, wo ich mich im Hotel `Skylark ́ einquartierte.
Dieses Hotel wurde von mehreren Sikh–Brüdern geführt, mit welchen ich bald Freundschaft schloss.
Abends ließ ich mich hin und wieder in ein Tanz–Varieté fahren, wo mir eines der Mädchen, Jaya, besonders gefiel. – Sie war nicht etwa ausnehmend hübsch, doch wirkte sie etwas scheu im Vergleich zu den anderen Tänzerinnen und dieser Umstand sprach mich an. Ich sah mir die Vorführung an, aß beispielsweise eine Suppe oder eine andere Kleinigkeit und trank ein Bier oder einen Saft.
- Von einem Schneider ließ ich mir zwei sogenannte Pyjama–Anzüge anfertigen, einer davon aus Seide und bezahlte dafür die lächerliche Summe von umgerechnet etwa fünfundzwanzig Mark.
Ich machte Abstecher nach Madras und Bangalore; letztere Stadt gefiel mir ausnehmend gut.
– Erstaunlich sauber und gepflegt für indische Verhältnisse; überall Blumenrabatte und Grün.
Man hatte nicht den Eindruck, sich in einer Großstadt zu befinden; es war eher, als käme man von einem ruhigen, friedlichen Ort in den nächsten. Rote Sandsteinbauten, Kühe mit großen Eutern auf den Straßen; freche Affen, die Einem beim Frühstück auf dem Hotelbalkon Gesellschaft leisten wollten und von mir selbstverständlich ihren Teil abbekamen.
- Madras gefiel mir weniger – genau gesagt - überhaupt nicht! Ich fuhr über Hyderabad zurück nach Nagpur und belegte wieder mein altes Zimmer im Skylark.
- Wie immer, war ich äußerst freigiebig. Das Fenster meines Zimmers lag zur ruhigeren Rückseite des Hotels, von wo aus etliche, ärmlich erscheinende Hütten zu erkennen waren, in welchen scheinbar unbemittelte Menschen ihr Dasein fristeten.
Eines Tages sah mich einer dieser vermeintlich Armen am offenen Fenster stehen und winkte zu mir herauf. Ich gab den Gruß zurück und warf einige Münzen hinunter, welche unverzüglich eingesammelt wurden.
Am Abend hörte ich von unten Rufe erschallen: „Bhaia, - Bhaia !“ Neugierig ging ich zum Fenster und sah eine Menschenmenge, welche sich unten versammelt hatte. Die Rufe galten mir und ich vermutete, dass auch sie gerne einige Münzen gehabt hätten.
Ich warf also mein gesamtes Wechselgeld zum Fenster hinaus, doch reichte dieses nicht für Alle und die Rufe erschollen weiter.
In der Ansicht, diese Armen gehörten zu einer verschworenen Gemeinschaft und würden ohnehin alles brüderlich teilen, warf ich zwei Hundertrupienscheine den Münzen hinterher und musste zu meiner großen Enttäuschung feststellen, dass es sich bei der Menge keineswegs um `Brüder und Schwestern ́ handelte. – Die Zwei, welche das Glück hatten, die Scheine zu ergattern, machten sich, verfolgt vom Rest, schleunigst aus dem Staube.
– Ich hatte meine Lektion gelernt und ließ mir nun jeden Nachmittag an der Rezeption Geld wechseln, um genügend Münzen zu besitzen, welche ich aus dem Fenster werfen konnte....
Es sprach sich schnell herum, dass ein Zimmer des Hotels von einem verrückten Ausländer bewohnt wurde, welcher nicht wusste, wohin mit seinem Geld.
- Eines Tages pochte es an der Zimmertür; ein Mann mit einem Stethoskop um seinen Hals stand draußen und drückte mir wortlos ein Stück Papier in die Hand. Es war in englischer Sprache beschrieben und gab kund, dass jener Mann sich in der unglücklichen Lage befände, seine Tochter verheiraten zu müssen und darum dringend mehrereHunderttausend Rupien benötige!
Dies war nun selbst für meinen Geschmack zu unverschämt – und ich geleitete den Habgierigen nach Unten, wo er sich schleunigst verdrückte.
Mein Freund an der Rezeption, welcher der Meinung gewesen, ich sei erkrankt und habe einen Arzt bestellt, hatte diesen Finanzexperten nach Oben gelassen. – Er machte mir, wie auch schon zuvor, Vorhaltungen über meine Freigiebigkeit; ich solle nicht auf jeden Betrüger oder angeblich Armen hereinfallen, andernfalls ich bald ohne Mittel dastünde. –
Ich wusste selbst, wie recht er hatte, doch fiel es mir außerordentlich schwer - nein, war es mir unmöglich – am Elend vorüberzugehen, ohne meine Tasche zu öffnen.
- Meine Mutter hatte des Öfteren erzählt, dass ich bereits als Kind Alles und Jedes bereitwilligst auf Verlangen weggegeben hätte.
– Wurde ich etwa im Spaß von einem Erwachsenen um ein eben erst vom Kaufmann erhaltenes Bonbon angegangen, so hätte ich dieses süße Geschenk ohne Zögern dem Betreffenden entgegengehalten.
– Auch in der Jugendzeit konnte ich sehr wohl die falschen Freunde von den andern unterscheiden; -doch fiel es mir zeitlebens schwer, Nein zu sagen.
- So fuhr ich denn nun fort, meine Münzen aus dem Fenster zu werfen und wollte der guten Ratschläge meiner Sikh–Freunde nicht achten....
Ein Anglo–Inder war Manager des Hotel–Restaurants; Dieser nahm mich eines Tages mit nach Hause, um mich seiner Familie vorzustellen. Vater sowie Großvater waren früher bei der Eisenbahn beschäftigt. Die Eisenbahn schien überhaupt eine Domäne der Anglo–Inder zu sein und sie waren sichtlich stolz darauf.
Dies schloss. ich auch aus den Reden anderer Anglo’s, welche in dieser Siedlung lebten. –
Irgendwann kam nun dieser Manager, er hieß Rodney, zu mir und erzählte mir im Vertrauen, dass er sich hier im Hotel aus bestimmten Gründen nicht mehr wohl fühle und darum ein eigenes Geschäft, in welchem er gebackenen und gebratenen Fisch verkaufen würde, eröffnen wolle.
Ein solches Geschäft sei eine Goldgrube in Nagpur, doch bräuchte er dafür zehntausend Rupien und er bat mich um diese Summe, mit dem Versprechen, mich an dem Geschäft zu beteiligen. – Wir wussten Beide, dass ich wohl nie mehr nach Nagpur zurückkäme; dennoch gab ich ihm die gewünschte Summe. – Später erfuhr ich, dass er sich damit seine Wohnung neu eingerichtet hatte.
- Der Abschied von den Skylark–Sikhs fiel nicht leicht, doch ich musste und wollte weiter nach Madhya–Pradesh. Dort gedachte ich für Immer zu bleiben, denn im dortigen Dschungel hatte ich mich wohl gefühlt.
Ich hatte diesmal aus Deutschland zwei Medizinflaschen mit `Resochin-Tabletten' mitgebracht, damit nicht abermals solches Unheil mich heimsuchen sollte, wie es beim vorigen Mal der Fall gewesen.
- Ich glaubte mich somit gewappnet und machte mich auf den Weg nach Raipur. Dort besuchte ich jene Familie, welche mich damals in ihrem Haus gepflegt hatte. – Ich hatte auch für sie einige Kleinigkeiten mitgebracht, über welche sie sich sehr freuten, obwohl es sich, nach europäischen Verhältnissen, um nichts übermäßig Kostspieliges handelte.
Am Tag darauf ging es weiter nach Jagdalpur, wo ich meine Studentenfreunde alle wieder traf.
Drei Wochen blieb ich auf ihr Drängen; viel länger, als geplant, doch dann fuhr ich endlich mit dem Überlandbus über Narainpur nach Chhotte Dongar, der letzten Inder-Bastion vor den bewaldeten Bergen der Mariah’s.
Chhotte Dongar war ein winziges Nest mit einer Schule, einem Spital und einem Büro des Rangers, welcher hier die Polizeigewalt innehatte.
- Nicht in den Bergen von Abuzmar ließ ich mich letztendlich nieder; sondern man führte mich sechs Kilometer in entgegengesetzter Richtung in ein Gond–Muria–Dorf mit Namen Umagaon, wo man mir eine Lehmhütte zur Verfügung stellte.
Ich blieb etwa vier oder sechs Wochen im eigentlichen Dorf, dann ließ ich mir, an der mir zusagendsten Stelle des Flusses, eine eigene Hütte bauen.
Die Dorfleute waren gegen diesen meinen Umzug, da sie der Ansicht waren, es sei dort zu gefährlich für eine einzelne Person. Schließlich waren es mehr als zwei Kilometer bis zum Dorf und es gab Raubkatzen, Bären und Wölfe; doch war ich deshalb nicht übermäßig beunruhigt.
Die Wälder waren wildreich und bisher hatte noch kein Tiger ein Rind oder eine Ziege gerissen.
Kojoten oder Schakale vergriffen sich wohl an Geflügel, doch stellten sie keine ernstliche Gefahr für den Menschen dar.
– Unter den Eingeborenen fühlte ich mich wohl; sie waren anders als die Inder – stellten nicht so viele und dumme Fragen wie Jene; waren intelligent und wissbegierig.
Mit der Zeit lernte ich, dass auch in dieses scheinbare Paradies bereits der verdorbene Apfel gefallen war. Inder von außerhalb, wie Lehrer, Arzt, Ranger oder auch Händler, diese durchweg Bengali’s, sahen überheblich auf die Eingeborenen herab, obwohl gerade sie, meines Erachtens, am wenigsten Grund oder Recht dazu hatten.
Die Gond hatten einst die Herrschaft über das ganze Land inne und stehen nach offizieller Lesart im Ruf einer frühen Hochkultur. Als dann arische Stämme in Indien einfielen, wurden die Gond in die Dschungel zurückgedrängt, wo sie über die Jahrtausende ihre einstige Kultur verloren.
– Als sie vor nicht ganz vierzig Jahren in diesem Gebiet wiederentdeckt wurden, waren sie unbekleidet und lebten als Jäger und Sammler. Lediglich Hirse bauten sie mittels Brandrodung an; hatten von Pflügearbeit keine Ahnung.
Ich geriet in Streit mit Händlern und Lehrern, ob ihrer schnöden Versuche, die Eingeborenen zu übervorteilen. Mein Bild der Inder wurde ein erdenklich schlechtes und ich war froh, dass ich relativ wenig mit ihnen zu tun hatte.
Noch viele Gond und noch mehr Mariah konnten Banknoten nicht nach ihrem Wert beurteilen, oder errechnen, wieviel Wechselgeld ihnen zustand, so dass sie stets in schamlosester Weise betrogen wurden.
Medikamente, Spenden der westlichen Welt und dazu gedacht, kostenlos abgegeben zu werden, wurden verkauft. Hatte Jemand kein Geld, so bekam er keine medizinische Versorgung.
Milchpulver, welches für Schulkinder bestimmt war, wurde ebenfalls nicht an die wahren Empfänger ausgegeben.
Diese Dinge waren ein ständiges Ärgernis für mich und ich wandte viel Zeit auf, um Eingeborene bei ihren Gängen zu begleiten und nach dem Rechten zu sehen.
Vorhaltungen und Appelle an Gerechtigkeit waren nutzlos; nur Drohungen konnten diese angeblich den Eingeborenen überlegenen Betrüger einschüchtern.
Drei Sprachen hatte ich zu erlernen, da Englisch hier weitgehend unbekannt war. Es gab in Chhotte Dongar einen Lehrer aus Benares, der an diese Schule strafversetzt war; er war der Einzige, der des Englischen mächtig war und nur mit ihm konnte ich mich zuweilen in dieser Sprache unterhalten.
Die Gond–Muria sprachen Gondi und die Allermeisten von ihnen auch das am meisten verbreitete Halbi, welches von den unterschiedlichsten Völkergruppen in der Region gesprochen wurde.
Die dritte Sprache war die offizielle Landessprache in Madhya–Pradesh und ist auch die im nördlichen Indien am weitesten verbreitete Sprache: Das Hindi.
Ich lernte von den Gond und da ich alleine war und Niemanden hatte, mit dem ich mich in Englisch oder gar Deutsch hätte unterhalten können, lernte ich ziemlich rasch.
Nach etwa vier Monaten konnte ich mich schon recht gut in allen drei Sprachen unterhalten, wenn ich auch hin und wieder einige Begriffe durcheinander brachte.
Gondi und noch mehr das einigermaßen verwandte Mariah sind sehr melodische Sprachen und es machte mir Freude, mich darin zu üben.
Machte ich einen Fehler, lachten meine Lehrmeister herzlich und wiesen mich dieserart auf den Faux Pas hin.
Kamen Eingeborene ins Inderdorf, so lachten sie niemals, sondern zeigten unbewegte Mienen; auch dies für mich ein Zeichen, dass sie mich akzeptiert hatten; denn waren wir unter uns, so ließen sie alle Scheu beiseite und wir hatten viel Spaß miteinander.
Die Inder hielten es nicht für nötig, Gondi zu lernen; sie dünkten sich ja die Überlegenen, also konnten die Anderen gefälligst ihre Sprache lernen.....
So lebten die Gruppen nebeneinander, statt miteinander – und es schien mir nur eine Frage der Zeit, da selbst Dieses nicht mehr möglich sein würde.
Zuhause trug ich den gleichen Lendenschurz wie die Gond; hatte die gleiche Frisur und lernte von ihnen. Schließlich waren sie in diesen Wäldern Zuhause und kannten sich somit besser aus, als irgendein Zugewanderter.
Auf meinen Fußsohlen hatte sich längst die nötige Hornhaut gebildet, so dass ich mich im Dschungel barfuß bewegen konnte wie jeder Andere auch. Ich pflanzte Gemüse zum eigenen Verbrauch und hielt mir eine Hühnerschar.
Abwechselnd hatte ich verschiedene Tiere des Waldes, welche verletzt waren, in Pflege; so etwa eine Eule, einen Papagei und viele mehr, die ich nach ihrer Genesung wieder der Freiheit überantwortete.
Oft war ich unterwegs, um Bärinnen mit ihren Jungen zu beobachten und ich wollte Stunden des Tages mit Schwimmen und Herumplanschen im klaren, tiefen Wasser des Flusses verbringen.
– Der Umgang mit der Axt war mir selbstverständlich geworden – und auch das Schießen mit dem Bambus-Bogen und gefiederten Pfeilen hatte ich gelernt. –
Bereits über ein Jahr befand ich mich nun hier am Orte, als eines Tages ein Fremder in Begleitung eines Halba’s aus Chhotte Dongar auftauchte. – Der Fremde hatte im etwa vierhundertfünfzig Kilometer von hier entfernten Raipur von mir sprechen hören und war eigens gekommen, um mit mir ein gewisses Problem zu erörtern.
Der Halba–Führer wurde zurück nach Dongar geschickt, nachdem ich dem Fremden versichert hatte, dass er einen Begleiter für den Rückweg vom nahen Dorf bekäme. – Tatsächlich jedoch hatte der Fremde vor Dritten mit seinem Anliegen nicht herausrücken wollen und mir dies auch durch Zeichen zu verstehen gegeben. – Ich war gespannt, was denn Geheimnisvolles er mir zu eröffnen habe.
Der Fremde bat mich, ihn Gautam zu nennen, erklärte jedoch gleichzeitig, dass dies nicht sein wahrer Name sei.
Im Nordosten Indiens, wo seine Heimat sei, wäre das gleiche Problem zu verzeichnen, mit welchem auch die Menschen hierzulande zu kämpfen hätten; doch würde dort bereits Etwas unternommen.
Ihm sei zu Ohren gekommen, dass ich mich für die Einheimischen hier einsetze und er sei in der Hoffnung gekommen, dass ich bereit sei, mit ihm und seinen Leuten gemeinsam zu kämpfen.
Zu diesem Zwecke sei es notwendig, dass ich für eine begrenzte Zeit mit ihm käme und mich an Ort und Stelle informierte über die Art und Weise ihres Kampfes.
Es sei dies nicht nur ein lokales Problem; sondern überall in diesem Lande herrsche Ungerechtigkeit und Ungleichheit.
Das Kastenwesen sei auf dem Papier schon seit 1947 abgeschafft, doch tatsächlich beschränke sich dies auch rein auf das Papier. Dazu kämen Polizei–Übergriffe sowie Korruption und Willkür, gegen welche der Einzelne machtlos sei. Ich solle mir überlegen, ob ich tatsächlich in einem Lande leben wolle, in welchem von Menschenrechten nicht wirklich gesprochen werden könne.
Gautam nannte mir einen Termin. zu welchem er wieder in Raipur zu tun hätte und gab mir die Adresse eines Hotels, in dem ich ihn über den Zeitraum von zwei Tagen um die Mittagszeit treffen könne. – Ich solle an der Rezeption nach Gautam fragen.
Der Termin war in etwa drei Wochen und dieser Zeitraum sollte mir zum Nachdenken genügen. Ich sollte mich im Falle meines Kommens auf eine Abwesenheit von mindestens vier Monaten einrichten.
Wir tranken zusammen gewürzten Milchtee; danach begleitete ich ihn nach Umagaon, wo ich einen Jungen bat, ihn zurück nach Chhotte Dongar zu bringen.
Gautam wollte diese Nacht im dortigen Government–Resthouse, dem Dak–Bungalow, verbringen und morgen in der Frühe mit dem Bus zurückfahren.
Ich hing eigenen Gedanken nach. Mit allem, was Gautam gesagt hatte, war ich prinzipiell einverstanden; doch war ich mir auch der Tatsache bewusst, dass der Kampf, von welchem er gesprochen hatte, nicht allein mit Worten geführt würde.
So befand ich mich im Zwiespalt; was sollte ich tun ? Nie war ich ein gewaltbereiter Mensch; ich glaubte an Überzeugung durch Vorbild und Reden, doch war auch mir nicht entgangen, dass dies bei diesem Menschenschlag nichts fruchtete......