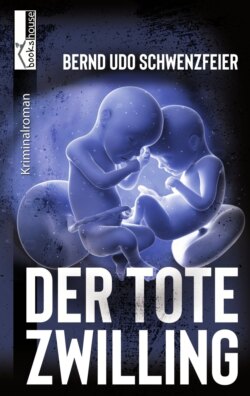Читать книгу Der tote Zwilling - Bernd Udo Schwenzfeier - Страница 10
Оглавление2.
Montag, 14. Juli 1980
Ost-Berlin/DDR, Friedrichshain, Kinzigstr. 20 a, Gartenhaus, 3. Stock links, Wohnung von Christa Schubert
Christa spürte erneut einen heftigen Krampf im Unterleib. Bereits seit den Morgenstunden waren sie in immer kürzer werdenden Abständen aufgetreten und hatten an Intensität zugenommen. Beunruhigend war, dass der letzte erst vor rund zehn Minuten abgeklungen war. Was sollte sie nur tun? Dr. Emmerich anrufen und ihn um Rat fragen? Der würde sie sicher wieder nur mit Vorwürfen überhäufen und sagen: »Frau Schubert, trinken Sie nicht so viel Alkohol, und vor allem rauchen Sie nicht in der Schwangerschaft. Schonen Sie sich! Eine Zwillingsschwangerschaft ist schließlich kein Pappenstiel. Das müssten Sie doch als dreifache Mutter mittlerweile längst wissen. Legen Sie sich hin und entspannen Sie sich.«
Sie mochte diesen Quacksalber nicht sonderlich, aber was sollte sie jetzt tun? Schmerztabletten nehmen? In ihrem Zustand? Nein, das war nicht die Lösung. Sie musste mit Medikamenten äußerst vorsichtig sein, weil sie schon bei ihrer letzten Schwangerschaft 1977 mit ihrem Sohn Michael einige Komplikationen zu überstehen hatte. Aber gab es eine Alternative? Sie brauchte nicht lange zu überlegen. Sie musste unbedingt noch heute in die Praxis, um sich untersuchen zu lassen. Nur er konnte die Ursache der Schmerzen herausfinden. Dr. Emmerich war der einzige Frauenarzt weit und breit, und seine Praxis war bequem zu Fuß in etwa zehn Minuten zu erreichen. Sie seufzte tief auf und legte sich auf ihre Couch, schob sich zur Entlastung noch ein Kissen unter die Beine, schloss die Augen und versuchte, sich zu entspannen.
Aber die innere Unruhe ließ nicht nach, weil sie ganz tief in ihrem Innern längst ahnte, dass das keine x-beliebigen Magen- oder Darmkrämpfe, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach Wehen waren, die ihr jetzt bereits im sechsten Monat so schwer zu schaffen machten. Durch ihre drei vorherigen Schwangerschaften war sie erfahren genug, um die Situation richtig einschätzen zu können. Je länger sie darüber nachdachte, umso mehr lösten sich ihre Zweifel in Luft auf, dass sie sich irren könnte. Immer wieder diese Zwillinge. Verdammt, sie machten also schon wieder Ärger. Dabei hatte sie die Schwangerschaft von Anfang an nicht gewollt und sich bald entschlossen, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Aber dann wurde sie von ihrer Familie, allen voran ihre Mutter, überredet, es nicht zu tun. Alle versprachen ihr vollmundig Unterstützung in allen Lebenslagen, und ihre Mutter hatte sie in den Arm genommen und ihr mit dem Spruch Mut gemacht: »Wo drei Mäuler satt werden, wird auch ein viertes satt.«
Als sie aber in der 19. Schwangerschaftswoche erfuhr, dass sie Zwillinge erwartete, war der Schock gewaltig. Wie sollte sie das alles nur schaffen, als alleinerziehende Mutter fünf Kinder zu versorgen, ohne Mann und ohne Beruf? Und das Geld vom Sozialamt reichte vorn und hinten nicht. Eine Abtreibung kam nicht mehr infrage, dazu war es längst zu spät. Sie erinnerte sich, dass sie damals mit Dr. Emmerich lange über das Thema gesprochen hatte. Was sollte nur aus ihr werden? Sie kam schon jetzt mit ihren drei Kindern kaum noch dazu, abends auszugehen, sich mal zu amüsieren und ihre Jugend zu genießen. Damit war es ein für alle Mal vorbei. Das konnte sie sich endgültig abschminken. Stattdessen musste sie tagsüber ihre Kinder versorgen und abends den Babysitter spielen, während ihre Freundinnen ausgingen und das Leben genossen. Dabei war sie doch erst sechsundzwanzig Jahre alt. Sie sah gut aus, und an Männern hatte es ihr nie gemangelt. Aber sie war immer wieder an die Falschen geraten. Schicke Kerle waren darunter gewesen, besonders der Letzte, der sie geschwängert hatte. Ein junger NVA-Soldat mit Namen Mike, den sie letzten Silvester auf einer Party bei Freunden kennengelernt hatte. Bei der Erinnerung an seine Küsse und neugierigen Hände überzog ein Lächeln ihr Gesicht. Er war ein verdammt guter Liebhaber gewesen, und die Nummer mit ihm sensationell. Dummerweise hatte sie die Pille vergessen, und weder er noch sie hatten ein Kondom zur Hand. Aber das war für kein Hindernis, jetzt und sofort ihr Verlangen aufeinander zu stillen. Wie Ertrinkende hatten sie sich aneinandergeklammert und sich gegenseitig die Kleider vom Leib gerissen. Die Schuld für ihre Hemmungslosigkeit gab sie später dem vielen Alkohol, den sie während der Feier über alle Maßen getrunken hatte. Ohne jeden Skrupel hatte sie mit ihm geschlafen. Nicht einmal an seinen Nachnamen konnte sie sich später erinnern. Seit diesem Tag hatte sie ihn nicht mehr wiedergesehen, und auch er hatte sich nicht gemeldet. Sie seufzte tief auf. Sie war doch noch so jung. Sollte das Leben nur noch aus Windeln waschen, Essen kochen und Kinder hüten bestehen? Ihre Schwangerschaft hatte sich verheerend auf ihre einst so schlanke und attraktive Figur ausgewirkt. Sie war ungewöhnlich dick geworden, ihre Beine stark geschwollen, und von ihrer Schönheit war nicht viel übrig geblieben. Auch verlief diese Schwangerschaft anders als die anderen drei. Sie hatte immer wieder gesundheitliche Probleme und saß ständig bei Dr. Emmerich im Wartezimmer. Abends lag sie in ihrem Bett und durchwanderte das Tal der Tränen. Und so gab sie den Zwillingen die Schuld an ihrem schlechten gesundheitlichen und psychischen Zustand und ihrer künftigen finanziellen Notlage. Aber mit Jammern und Erinnerungen an bessere Zeiten war es nicht getan. Sie versuchte, die düsteren Gedanken in die hinterste Ecke ihres Gehirns zu verbannen. Die Babys konnten schließlich nichts dafür, und sie war eine Rabenmutter, diesen unschuldigen Wesen irgendeine Schuld zuzuschreiben.
Ihre Hoffnung auf Rückgang der Schmerzen blieb nur ein frommer Wunsch, denn die Realität war unerbittlich und ließ sich nicht verdrängen. Die nächste Schmerzwelle kündigte sich an. Wenige Minuten später brach die nächste Wehe unvermittelt über sie herein. Die Schmerzen waren jetzt noch heftiger. Sie schrie laut auf, umklammerte mit beiden Händen hilflos ihren geschwollenen Leib und begriff augenblicklich, dass sie unbedingt ärztliche Hilfe benötigte. Allein würde sie es nicht mehr schaffen, denn der Weg zu Dr. Emmerich war in ihrem jetzigen Zustand unerreichbar weit. Wenn sie schon nicht zu ihm in die Praxis gehen konnte, musste sie wenigstens anrufen und sich Rat holen, was jetzt zu tun war.
Sie ließ sich zurückfallen, verharrte bewegungslos in dieser Lage und schloss erschöpft die Augen. Aber die Ruhe war nur trügerisch. Wie von der Tarantel gestochen fuhr sie zusammen, als sie bemerkte, dass es zwischen ihren Beinen unvermittelt nass wurde. Der Schreck, der ihr durch ihre Glieder fuhr und unbarmherzig in ihr Bewusstsein drang, war ungeheuer groß. Sie hatte nicht etwa unter sich gemacht. Das war kein Urin, der an ihren Oberschenkeln herunterlief, das war Fruchtwasser. Aber sie war doch erst in der 26. Woche? Was war in ihrem Bauch nur geschehen? Sofort meldete sich ihr schlechtes Gewissen. Ihr fielen die Worte ihres Arztes ein, der sie immer wieder ermahnt hatte, solider zu leben und nicht so viel zu trinken. Die Angst vor möglichen Komplikationen wurde immer größer, und sie musste alle Kraft aufbringen, um nicht völlig durchzudrehen und den Kopf zu verlieren. Sie würde eine Frühgeburt erleiden, das war so sicher wie das Amen in der Kirche und wahrscheinlich ein oder sogar beide Babys verlieren. Und ihr wurde in diesem Moment bewusst, dass auch ihr Leben in großer Gefahr war. Sie griff sich verzweifelt an den Kopf, schrie ihre Angst heraus. Weinkrämpfe erfassten sie. Nach einer Phase der Hilflosigkeit riss sie sich zusammen und griff nach dem auf dem Couchtisch stehenden Telefon.
Hastig wählte sie die Nummer der Praxis.
Die Schwester stellte gleich zu Dr. Emmerich durch. Ohne sie zu unterbrechen, hörte er sich ihre Beschwerden an und antwortete ruhig und professionell. »Frau Schubert, behalten Sie bitte die Ruhe. Sie kommen jetzt nicht in meine Praxis, sondern rufen sofort die Feuerwehr. Als Grund geben Sie Komplikationen in der 26. Schwangerschaftswoche an und berufen sich auf mich. Legen Sie sich eine Windel zwischen ihre Schenkel und bleiben Sie bis zum Eintreffen des Notarztes liegen. Unmittelbare Gefahr für Ihre Babys droht meines Erachtens nicht. Bleiben Sie liegen und warten Sie auf den Notarzt! Haben wir uns verstanden?«
»Ja, Herr Doktor«, erwiderte sie ergeben.
»Gut, dann werde ich in der Zwischenzeit mit dem St. Franziskus-Krankenhaus in Friedrichshain Verbindung aufnehmen und Ihr Erscheinen ankündigen. Ich kenne den leitenden Oberarzt, Dr. Westhoven. Er wird sich um Sie kümmern. Ich wünsche Ihnen alles Gute.«
Damit war das Notwendige gesagt und sie legte etwas beruhigter den Hörer auf die Gabel.
Aber was geschah in der Zwischenzeit mit ihren Kindern, die ahnungslos im Kinderzimmer spielten? Ihre acht, sechs und dreijährigen Sprösslinge konnte sie doch nicht allein lassen. Wer sollte für sie sorgen? Hastig griff sie zum Telefon. Sie musste unbedingt ihre Mutter anrufen, die nicht allzu weit in der Boxhagener Straße wohnte, und sie um Hilfe bitten. Was sollte sie tun, wenn ihre Mutter nicht zu Hause war? Ein Panikgefühl erfasste sie, aber ihre Sorge war unbegründet, denn schon nach dem zweiten Klingelton meldete sie sich, als wenn sie auf ihren Anruf gewartet hätte. Sie sprudelte förmlich über und berichtete ihrer Mutter atemlos von ihrer Malaise.
»Ja, Christa, natürlich komme ich zu dir, aber es wird ein Weilchen dauern. Ich muss erst das Fahrrad aus dem Keller holen. Geh doch in der Zwischenzeit zu Frau Kluge und bitte sie, solange auf die Kinder aufzupassen, bis ich da bin.«
»Danke, Mutti, danke …«, erwiderte sie atemlos. »Ja, ich werde gleich zu Frau Kluge gehen.«
Ihre Nachbarin stellte sich sofort als Babysitterin zur Verfügung. Sie mochte Christa trotz ihres fragwürdigen Lebenswandels. Die Kinder wuchsen ohne ihre Väter auf, und nun war sie schon wieder schwanger. Wo sollte das nur hinführen? Diese Gedanken hatte Christa ihr häufiger vom Gesicht abgelesen, dennoch hatten sie einen guten Kontakt, und wann immer es nötig wurde, griff Frau Kluge ihr hilfreich unter die Arme. Dankbar fiel Christa ihr um den Hals. »Ich mache es wieder gut, Frau Kluge, das verspreche ich Ihnen. Ich werde einen schönen Topfkuchen backen, und dann trinken wir auf meinem Balkon Kaffee. Versprochen!«
Sie hatte sich gerade wieder auf die Couch gelegt, als sie die Sirene der Feuerwehr hörte. Wenig später hörte sie schwere Schritte auf der Treppe, dann klingelte es. Mühsam erhob sie sich und schleppte sich zur Tür. Der Notarzt und zwei Sanitäter mit einer Trage in den Händen standen vor ihr.
Während der Fahrt im Krankenwagen zum nahe gelegenen St. Franziskus-Krankenhaus in der Landsberger Allee ebbten die Schmerzen ab. Vor der Geburtsklinik erwarteten Christa zwei Pfleger mit einem Krankenstuhl und schoben sie in ein Untersuchungszimmer. Für einen Augenblick war sie allein. Was würde in den nächsten Stunden mit ihr geschehen?«, fragte sie sich mit bangem Herzen.
Obwohl sie bereits im Krankenhaus war, kroch langsam wieder die Angst in ihr hoch, nicht nur ihren Babys könnte etwas passieren. Zu weiteren Überlegungen kam sie nicht, denn unvermittelt wurde die Tür geöffnet.
»Frau Schubert, ich bin Schwester Bärbel. Der Doktor kommt sofort. Bis zu seinem Eintreffen werde ich schon mal Ihre Personalien aufnehmen. Nennen Sie mir bitte Ihren vollständigen Namen, Ihren Familienstand, Anzahl Ihrer Kinder, Beruf und Arbeitsstelle. Ihre Anschrift Kinzigstr. 20 a stimmt noch?«
»Ja, Schwester. Ich bin am 18. April 1954 in Berlin geboren, habe drei Kinder, Siegfried ist acht Jahre alt, Manuela sechs Jahre und Michael drei Jahre. Verheiratet bin ich nicht.«
»Dann sind die Kinder also unehelich. Wer ist denn der Vater?«
»Da gibt es drei Väter.«
»Was?«
»Sie haben richtig gehört.« Sie wurde langsam sauer. Was wollte der Weißkittel von ihr? Den Moralapostel spielen? Das fehlte noch. Es ging jetzt um ihre ungeborenen Kinder und um sie. »Und, Schwester? Haben Sie damit ein Problem? Sind die Namen der Väter für meinen jetzigen Zustand von Bedeutung?«
»Nein, nein«, beeilte sich die Schwester zu antworten. »Das ist es nicht, es ist nur recht ungewöhnlich.« Sie schüttelte den Kopf, notierte pikiert die Angaben in ein Formular und sah sie mit einem lauernden Blick an. »Wie heißt denn der Vater ihres jetzigen Kindes?«
»Das weiß ich nicht. Ich kenne nur seinen Vornamen. Das Jugendamt ist gerade dabei, seinen Nachnamen zu ermitteln.«
Schwester Bärbel sah sie mit offenem Mund an und schüttelte ungläubig den Kopf. »Nun gut, das ist ja eigentlich auch Ihre Sache. Dann schreibe ich in die Spalte eben ‚unbekannt‘. Nun zu Ihrem Beruf und Ihrer Arbeitsstelle. Können Sie dazu Angaben machen?«
»Sicher, Schwester!« Für einen Augenblick vergaß sie ihren Zustand und wo sie gerade war. Es machte ihr mit einem Mal Spaß, die Schwester zu provozieren. Sie hatte nichts zu verlieren. Die Sachbearbeiterin von der Sozialfürsorge hatte sie sich schon oft genug zur Brust genommen und ihren Lebensstil kritisiert. Und auch beim Jugendamt galt sie als problematischer Fall. Na und, was soll’s? Sie hatte nicht vor, etwas zu verändern. Sie bekam regelmäßig Geld vom Amt und Alimente von zwei Vätern. Es war nicht viel, aber sie kam gerade so über die Runden. Und wenn das Geld nicht reichte, steckte ihr ihre Mutter gelegentlich etwas zu. Warum sollte sie also arbeiten gehen und nach Feierabend auch noch drei Kinder versorgen? Das würde über ihre Kräfte gehen. Warum wollte das keiner verstehen? Und ein bisschen leben und amüsieren wollte sie sich auch noch. »Ich habe eine Lehre als Monteurin in einem Metallkombinat in Adlershof begonnen, nach der ersten Schwangerschaft die Ausbildung aber abgebrochen. Ich war dann die ganze Zeit arbeitslos, und zuletzt habe ich als Aushilfskellnerin in einem Gartenlokal in Schmöckwitz gearbeitet. Kindererziehen und dann noch arbeiten war mir einfach zu viel. Das habe ich nicht unter einen Hut gekriegt.«
Schwester Bärbel sah sie konsterniert an. »Das ist aber nicht gerade im Sinne unserer sozialistischen Werteordnung und der offiziellen Linie der SED, liebe Frau Schubert. Jeder Werktätige hat auch Verpflichtungen unserem Staat gegenüber. Aber gut, jeder muss selbst sehen, welchen Platz er in unserem Staat einnimmt«, erwiderte sie spitz.
»Sie haben recht, Schwester, das ist ganz allein meine Sache. Wo bleibt bitte der Arzt? Meine Wehen beginnen gleich wieder«, log sie, um das unerquickliche Gespräch endlich zu beenden.
In diesem Moment öffnete sich die Tür und der Doktor trat ein. Er war groß und schlank, hatte dunkle, etwas stechende Augen und einen akkurat geschnittenen Oberlippenbart. »Hallo Frau Schubert, ich bin Dr. Westhoven und werde Sie jetzt untersuchen. Machen Sie sich bitte frei«, forderte er sie auf, während er zum Patientenblatt griff und es mit schnellem Blick überflog. Kommentarlos legte er es beiseite und warf der Schwester einen vielsagenden Blick zu, den sie wortlos nickend erwiderte.
Trotz dieses kleinen Zwischenspiels legte Christa unbeeindruckt die mit gelblicher Flüssigkeit getränkte Babywindel zur Seite.
Die Untersuchung dauerte nicht lange. Nachdem Dr. Westhoven das Ultraschallgerät ausgeschaltet hatte, beugte er sich zu ihr. »Tja, Frau Schubert, bei Ihnen ist die Fruchtblase geplatzt, und nicht nur das. Ihr Muttermund hat sich bereits um etwa vier cm geöffnet. Hinzu kommt, dass Sie eine Entzündung im Genitaltrakt haben. Wie ich aus dem Gespräch mit Dr. Emmerich erfahren habe, sind sie in der 26. Woche. Wir müssen bei Ihrem Zustand sofort die Geburt einleiten, um das Leben Ihrer Zwillinge nicht zu gefährden. Eine normale Geburt wird es nicht werden, weil die Plazenta auch noch den Geburtsweg für die beiden Föten versperrt. Deshalb werden wir einen Kaiserschnitt machen müssen, um die Babys zu holen. Das heißt, wir müssen Sie operieren.«
Sie nickte ergeben. »Ja, Herr Dokter, tun Sie das! Je eher, desto besser.«
Der Arzt nickte. »Sorge bereitet mir Ihre Entzündung im Genitaltrakt. Ich habe bereits einen Abstrich vorgenommen. Sie entsteht gewöhnlich durch Übertragung beim Geschlechtsverkehr. Ich muss Sie deshalb fragen: Hatten Sie in letzter Zeit ungeschützten Verkehr?«
Sie wurde vor Verlegenheit rot bis unter die Haarspitzen. Das war ja peinlich. O Gott, was sollte sie nur sagen? Vormachen konnte sie dem Arzt nichts, der war zu clever. Was blieb ihr also anders übrig, als die Wahrheit zu sagen? Sie wandte verschämt ihren Blick ab und starrte an die Wand. »Ja, Herr Doktor, es stimmt. Ich hatte vor etwa drei Wochen einen guten Freund zu mir nach Hause eingeladen, und wir haben ein bisschen zu viel getrunken. Da ist es halt passiert. Ich wollte, dass er ein Kondom benutzt, aber er hatte keins bei sich. Dann haben wir es eben so gemacht.«
»Frau Schubert, das ist es ja gerade. Ich muss Ihnen leider vorwerfen, dass Sie sich ihren Föten gegenüber verantwortungslos verhalten haben, denn diese Entzündung ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Urheber für Ihre Frühgeburt. Ich meine dabei nicht den Verkehr an sich, sondern dass Sie ihn ungeschützt zugelassen und dass Sie sogar noch in dieser späten Schwangerschaftsphase Alkohol getrunken haben. Das war doch kein Einzelfall, oder?«
Sie sah ihn zerknirscht an. »Ich habe viele Fehler gemacht und mich nicht wie eine fürsorgliche Mutter verhalten.« Sie zuckte bedauernd mit den Schultern und versuchte, sich so gut es ging zu rechtfertigen. »Vielleicht lag es daran, dass ich die Schwangerschaft von Anfang an nicht wollte. Als ich erfuhr, dass ich schwanger bin, dachte ich sofort an Abtreibung. Ich habe doch schon drei Kinder, und dann auch noch von verschiedenen Vätern. Wegen der Kinder kann ich nicht arbeiten gehen. Ich schaffe das im Augenblick nicht. Unseren Lebensunterhalt bestreitet die Sozialfürsorge, und dann muss ich mir auch noch überall vorwerfen lassen, dass ich ein Sozialschmarotzer wäre. Die familiären Verhältnisse sind einfach zu chaotisch. Meine Mutter hat mich letztendlich dazu überredet, einen Schwangerschaftsabbruch nicht vorzunehmen. So ist meine Lage, Herr Doktor.«
Doktor Westhoven nickte der Schwester zu und wandte sich wieder an Christa. »Frau Schubert, das ist hier nicht der richtige Platz und vor allem nicht der richtige Zeitpunkt, um Ihre Lebenssituation auf den Prüfstand zu stellen. Ich will nur, dass die Geburt reibungslos verläuft und dass Sie und Ihre Babys keinen Schaden nehmen. Das ist jetzt das Wichtigste. Alles andere ist erst einmal zweitrangig.« Der Arzt wechselte mit der Schwester erneut einen vielsagenden Blick. »Schwester, ich muss noch einmal dringend telefonieren und die üblichen Formalitäten erledigen. Bereiten Sie die Patientin inzwischen für die OP vor. Er wandte sich an Christa. »Sie sind doch mit einem Kaiserschnitt einverstanden?«
»Aber ja, Herr Doktor«, erwiderte Christa ergeben.
»Gut, Frau Schubert, dann unterschreiben Sie noch das Formular. Wir sehen wir uns im OP. Alles Gute für Sie.«
Christa erwachte. Schemenhaft sah sie eine Schwester neben sich. Alles war noch in dichten Nebel gehüllt. Einen Augenblick lang wusste sie nicht, wo sie war, aber dann kam die Erinnerung zurück. Es war vorbei, die Geburt hatte sie endlich hinter sich, und sie lebte. Ein ungeheures Glücksgefühl durchströmte sie. Jemand rief ihren Namen.
»Unterschreiben Sie bitte das Formular, Frau Schubert«, forderte eine Frauenstimme neben ihr. Ihr wurde ein Kugelschreiber in die Hand gedrückt und ihre Hand zu einer Stelle auf dem Formular geführt. »Hier, bitte!«
»Warum denn das, Schwester?«, fragte sie noch halb benommen.
»Ach, das ist nur eine Formalität, nichts von Bedeutung. Dient nur der Verwaltung.«
»Ach so«, sagte Christa beruhigt. Sie war nicht in der Lage, die Schrift auf dem Papier zu entziffern. Die Buchstaben verschwammen vor ihren Augen. Mit krakeliger Schrift schrieb sie ihren Namenszug auf das Papier und sank erschöpft auf ihr Lager zurück. »Schwester, wo sind meine Babys?«, fragte sie voller Unruhe, drehte den Kopf. Sie erkannte Schwester Bärbel, die ihr aber die Antwort schuldig blieb und sie nur schweigend mit unbeweglichem, fast starrem, Gesichtsausdruck ansah. »Wo sind sie?«, wiederholte sie ungeduldig.
Die Schwester wich der Beantwortung ihrer Frage erneut aus. »Dr. Westhoven kommt sofort. Er wird mit Ihnen alles besprechen.«
»Was will er denn mit mir besprechen?«
»Gedulden Sie sich bitte noch einen Augenblick, bis der Doktor kommt.«
Nach schier endloser Zeit öffnete sich die Tür, und der Arzt trat in den Aufwachraum. Er zeigte ein besorgtes Gesicht, zog einen Stuhl zu ihrem Bett heran, setzte sich, ergriff ihre Hände und sah ihr ins Gesicht.
Schlagartig erfasste sie eine innere Unruhe. Sie spürte, dass irgendetwas mit ihren Zwillingen nicht in Ordnung war. Die Spannung in ihr nahm merklich zu und verwandelte sich langsam in Angst.
»Frau Schubert …« Dr. Westhoven machte eine kleine Pause. »Ich muss Ihnen eine traurige Nachricht überbringen. Sie müssen jetzt sehr stark sein. Einer Ihrer Zwillinge hat es leider nicht geschafft. Es war ein Junge, und seine Atmung hat versagt. Die Lunge war einfach noch zu schwach. Der Kleine ist kurz nach der Geburt gestorben. Mit einem Gewicht von knapp 1100 Gramm war er nicht lebensfähig. Es tut mir und allen an der Geburt beteiligten Ärzten und Schwestern sehr leid«, sagte er bedauernd und tätschelte tröstend ihre Hände.
Sie sah ihn ungläubig an. Hatte sie richtig gehört? Einer ihrer Zwillinge hatte die Geburt nicht überlebt? Sie durchlitt ein Wechselbad der Gefühle. Tiefe Trauer, aber auch eine winzige Spur der Erleichterung wechselten sich ab. Trotz aller Zwiespältigkeit, die in ihr war, traf sie der Verlust dennoch unvermittelt heftig, mehr, als sie es je vermutet hätte. Für einen Augenblick vergaß sie die ungewollte Schwangerschaft, die ganzen Strapazen während der vergangenen sechs Monate und die für sie vor der Operation düstere Lebensprognose, künftig mit fünf Kindern und ohne einen Ehemann klarzukommen. Sie war nur noch eine verzweifelte Mutter, die von dem Schmerz über den Verlust eines ihrer Babys übermannt wurde. Ein heftiger Weinkrampf erfasste sie, und sie drehte tränenüberströmt ihr Gesicht zur Seite.
»Und wie geht es meinem anderen Baby?«, fragte Christa mit banger Stimme, nachdem sich einigermaßen beruhigt hatte. Sie wagte nicht, dem Arzt ins Gesicht zu schauen.
»Es ist ebenfalls ein Junge, und es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er befindet sich im Brutkasten. Soweit wir feststellen konnten, arbeiten alle Organe normal. Aber er ist noch sehr schwach. Bei einem Gewicht von knapp 1300 Gramm auch nicht weiter verwunderlich. Sie können nachher zu ihm.«
Sie nickte dankbar. »Wenigstens einer hat es geschafft. Herr Doktor, ich möchte noch einmal mein totes Baby sehen und mich wenigstens von ihm verabschieden.«
Der Arzt schüttelte den Kopf. »Das wird leider nicht mehr gehen, Frau Schubert.«
»Warum denn nicht?«
»Weil es nicht mehr hier ist?«
»Wieso? Ich … ich verstehe nicht.«
»Ich kann Ihnen das erklären.«
»Wo ist es denn jetzt? Ich habe ein Recht, es zu sehen, Herr Doktor«, sagte sie mit Nachdruck. Dabei konnte sie nicht verhindern, dass ihr Tränen die Wangen hinunterliefen.
»Im Prinzip schon, aber nicht in diesem Fall.«
»Wieso?«
»Weil Sie bereits schriftlich zugestimmt haben, dass das Neugeborene zu wissenschaftlichen Zwecken untersucht werden kann, um die in der DDR leider noch immer herrschende hohe Säuglingssterblichkeit zu verringern. Sein kleiner Leichnam ist bereits auf dem Weg zur Charité.«
»Das muss ein Irrtum sein«, stieß sie erregt hervor. »Ich habe nichts unterschrieben.«
Doktor Westhoven hob abwehrend die Hände. »Doch, doch, liebe Frau Schubert, Sie haben es getan. Bitte beruhigen Sie sich. Wenn Sie es nicht glauben, zeigen wir es Ihnen.« Ohne eine Antwort abzuwarten, wandte er sich Schwester Bärbel zu. »Schwester, holen Sie bitte das Formular und legen Sie es Frau Schubert vor.«
»Sofort, Herr Doktor.« Sie eilte hinaus und kehrte wenig später mit einem Formular in der Hand zurück. »Hier, sehen Sie. Sie haben einer zur Verfügungsstellung ihres toten Säuglings zu wissenschaftlichen Zwecken zugestimmt.«
Ungläubig blickte Christa auf das Formular und auf ihre Unterschrift. Es war zweifellos ihre. Da gab es nicht zu deuteln. Aber Teufel noch mal, wie kam sie auf das Formular? Sie konnte sich nicht im Entferntesten daran erinnern, irgendetwas unterschrieben zu haben. »Wann soll ich das denn unterschrieben haben?«, fragte sie voller Argwohn.
»Aber Frau Schubert … Im Aufwachraum natürlich. Sie waren hellwach, und der Doktor war sogar Zeuge«, wiegelte Schwester Bärbel ab.
»Das stimmt nicht. Ich habe nichts unterschrieben«, protestierte Christa.
»Und wie kommt dann Ihre Unterschrift auf das Formular?«, fragte Doktor Westhoven mit vorwurfsvollem Unterton in der Stimme, »oder bestreiten Sie etwa, dass es Ihre ist?«
»Nein, nein, das nicht. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich hätte einer Untersuchung meines toten Babys niemals zugestimmt. Ich will nicht, dass es in alle Einzelteile zerschnitten wird.«
»Das tut mir sehr leid, aber dazu ist es jetzt zu spät. Sie hätten einer Untersuchung im Übrigen nicht zuzustimmen brauchen. Ihnen wäre durch eine Weigerung kein Nachteil entstanden. Es ist alles freiwillig geschehen. Aber mit Ihrer großherzigen Tat ersparen Sie vielleicht einer ganzen Reihe von Müttern gleiches Leid. So müssen Sie es auch einmal sehen. Das alles geschieht zum Wohle unserer sozialistischen Volksgemeinschaft«, dozierte Dr. Westhoven und vermied es, ihr in die Augen zu schauen.
Christa sah ein, dass die Fakten gegen sie sprachen. Enttäuscht ließ sie den Kopf sinken. Ihr Widerstand erlahmte, doch dann kehrten Erinnerungsfetzen zurück. Wie durch dichten Nebel sah sie plötzlich eine Schwester neben sich, die ihr einen Stift in die Hand drückte und sie zu einer Schreibunterlage führte. Sie atmete tief durch. Nun war sie sich sicher, dass ihr Protest berechtigt war. Sie hatten ihre Benommenheit skrupellos ausgenutzt, um an eine Babyleiche heranzukommen. Das war ein abgekartetes Spiel, dem sie nichts entgegensetzen konnte. Resignierend gab sie auf. »Wahrscheinlich habe ich das in der Aufregung vergessen.«
»Liebe Frau Schubert, so wird es sein. Aber jetzt kümmern Sie sich lieber mit vollem Einsatz um ihren anderen kleinen Sohn. Der braucht Ihre ganze Liebe und Fürsorge. Ich muss mich jetzt leider von Ihnen verabschieden. Andere Frauen im Kreißsaal brauchen dringend meine Hilfe«, sagte der Doktor und gab ihr die Hand. »Ich wünsche Ihnen und Ihrem Sohn alles Gute. Haben Sie sich schon einen Namen für ihn ausgedacht?«
Christa nickte erstickt. »Ja, er soll Andreas heißen.«
»Hübscher Name …« Doktor Westhoven nickte ihr noch einmal aufmunternd zu, tätschelte ihre Schulter und verließ eilig das Zimmer.
Schwester Bärbel trat an ihr Bett und tätschelte ihr die Hand. »Mein Beileid«, sagte sie. »Ich weiß, dass es sehr schwer für Sie ist, aber ich habe hier etwas, das Ihnen vielleicht neuen Mut geben könnte.«
Unter Tränen sah Christa zu ihr auf. Was wollte diese falsche Schlange noch von ihr?
Die Schwester reichte ihr einen Zettel. »Ich habe Kontakt mit dem Jugendamt aufgenommen. Ihnen ist es gelungen, den Vater Ihrer Babys zu ermitteln. Nehmen Sie Kontakt zu ihm auf, vielleicht haben Sie zwar einen Sohn verloren, gewinnen dafür aber einen Vater.«
Das war zu viel für Christa. Sie brach in haltloses Schluchzen aus. Wie sollte ein blöder Kerl ihr das Kind ersetzen? Was dachte sich diese dumme Kuh? Sie grub ihr Gesicht in die Kissen, damit sie nicht mehr hören musste, was die Schwester ihr noch über alleinstehende Frauen mit vier Kindern und deren Chancen im Leben predigte …