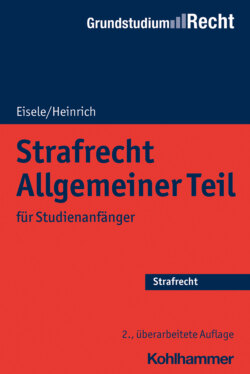Читать книгу Strafrecht Allgemeiner Teil - Bernd Heinrich - Страница 88
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDefinition
Bedingter Vorsatz liegt vor, wenn der Täter mit der Möglichkeit der Tatbestandserfüllung rechnet (Wissenselement) und den Erfolg billigend in Kauf nimmt bzw. sich mit ihm abfindet oder ihm das weitere Geschehen gleichgültig ist (Wollenselement). Der Täter muss sich also sagen: „Na wenn schon“.
Definition
Bewusste Fahrlässigkeit ist anzunehmen, wenn der Täter zwar mit der Möglichkeit der Tatbestandserfüllung rechnet (Wissenselement), dabei aber auf das Ausbleiben des Erfolges vertraut (Wollenselement). Der Täter muss sich also sagen: „Hoffentlich passiert nichts“.
Bsp.: Anton schlägt Bruno eine Bierflasche über den Kopf und will ihn dabei an sich nur erheblich verletzen und nicht töten. Dennoch stirbt Bruno an den Folgen des Schlages. – Sofern Anton damit rechnete, dass sein Schlag tödlich sein könnte, und er trotzdem meinte, dann hätte Bruno eben „Pech“ gehabt, nahm er den Erfolg wenigstens billigend in Kauf und handelte mit bedingtem Vorsatz.
V.Besondere Erscheinungsformen des Vorsatzes
192Im Folgenden sollen noch vier besondere Erscheinungsformen des Vorsatzes vorgestellt und auf deren rechtliche Behandlung eingegangen werden.
1.Dolus generalis
193 Definition
Unter einem dolus generalis (Generalvorsatz) versteht man eine Situation, in der der Täter mit seinem Handeln zwar insgesamt ein bestimmtes Ziel verfolgt, bei den konkreten Einzelhandlungen aber ein vorsätzliches Verhalten nicht festzustellen ist.
Eine solche Situation kommt insbesondere bei mehraktigen Geschehensabläufen vor, bei denen der Täter davon ausgeht, den Erfolg bereits nach dem ersten Akt erreicht zu haben, während er ihn erst (unbewusst) beim zweiten Akt verwirklicht.
Bsp.: Anton will Bruno durch einen Beilhieb töten. Nachdem er ihn niedergeschlagen hat, beseitigt er die (vermeintliche) Leiche Brunos dadurch, dass er sie in eine Jauchegrube wirft. Tatsächlich hatte Anton den Bruno aber durch den Beilhieb lediglich schwer verletzt. Brunos Tod tritt nunmehr dadurch ein, dass er in der Jauchegrube ertrinkt. Damit hat Anton nicht gerechnet, er ging vielmehr davon aus, dass Bruno zu diesem Zeitpunkt bereits tot war. – Hier liegt der objektive Tatbestand eines Totschlags durch das Versenken in der Jauchegrube vor. Durch dieses Verhalten hat Anton den Bruno getötet. Da er jedoch davon ausging, dass Bruno zu diesem Zeitpunkt bereits tot war, fehlte ihm ein entsprechender Vorsatz.
194Es ist heute gefestigte Ansicht, dass ein vorsätzliches Verhalten stets zum Zeitpunkt der dem Täter vorgeworfenen Handlung vorliegen muss. Es ist also eine zeitliche Kongruenz erforderlich (sog. „Simultaneitätsprinzip“), was sich aus § 16 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 8 StGB ergibt. Die früher anerkannte Rechtsfigur des dolus generalis, die einen Gesamtvorsatz im Hinblick auf einen bestimmten Geschehensablauf ausreichen lässt, ist insoweit heute überholt. Man löst das Problem inzwischen überwiegend dadurch, dass man an die erste Handlung (hier: den Beilhieb) anknüpft und darauf abstellt, ob der Täter einem wesentlichen oder einem unwesentlichen Irrtum über den Kausalverlauf unterlag. Da es sich insoweit aber um ein Irrtumsproblem handelt, soll die Frage erst im Zusammenhang mit der Irrtumslehre erörtert werden.76
2.Dolus subsequens
195 Definition
Unter einem dolus subsequens versteht man die nachträgliche Billigung einer zuvor unvorsätzlich verwirklichten Tat.
Diese nachträgliche Billigung ist unbeachtlich, da der Vorsatz stets zum Zeitpunkt der Tat, d. h. dann, wenn der Täter die Ausführungshandlung vornimmt, vorhanden sein muss (Simultaneitätsprinzip).
Bsp.: Anton sitzt an einem Berghang und wirft Steine ins Tal. Ohne dass er dies gewollt hat, löst sich dadurch eine Steinlawine, die den Spaziergänger Bruno unter sich begräbt. Anton ist entsetzt und begibt sich zur Unfallstelle, wo er Bruno tot vorfindet. Als er jedoch erkennt, dass es sich bei dem Toten um Bruno handelt, freut er sich, denn dieser war sein Nebenbuhler, dem er schon seit langem nach dem Leben trachtete. – Hier hat Anton zwar den objektiven Tatbestand des Totschlags, § 212 StGB, erfüllt, da er durch sein Handeln Brunos Tod kausal und zurechenbar herbeiführte. Zum Zeitpunkt des Steinwurfs fehlte ihm jedoch der Tötungsvorsatz, da er mit einem solchen Verlauf nicht rechnete. Die spätere Billigung des tödlichen Erfolges kann diesen fehlenden Vorsatz zum Zeitpunkt der Tat nicht nachträglich begründen. Es liegt lediglich eine fahrlässige Tötung, § 222 StGB, vor.
3.Dolus antecedens
196 Definition
Von einem dolus antecedens spricht man, wenn der Vorsatz, den der Täter ursprünglich hatte, zum Tatzeitpunkt nicht mehr aktuell ist.
Auch in dieser Konstellation ist der (frühere) Vorsatz unbeachtlich, der Täter kann also nicht wegen eines vorsätzlich begangenen Delikts bestraft werden.
Bsp.: Anton will Bruno töten. Er steckt zu Hause eine Pistole in seine Manteltasche und macht sich auf den Weg. Als er Bruno in der Bahnhofsgaststätte trifft, kommt es jedoch zu einem versöhnlichen Gespräch. Bei der abschließenden freundschaftlichen Umarmung löst sich versehentlich ein Schuss. Bruno wird getroffen und tödlich verletzt. – Obwohl Anton zum Zeitpunkt des Verlassens der Wohnung Tötungsvorsatz besaß (allerdings zur Tat noch nicht unmittelbar angesetzt hatte), liegt dieser Vorsatz zum Tatzeitpunkt nicht mehr vor. Daher scheidet ein Totschlag, § 212 StGB, im vorliegenden Fall aus. Es kommt lediglich eine fahrlässige Tötung, § 222 StGB, in Betracht.
197Ein unbeachtlicher dolus antecedens liegt allerdings nur dann vor, wenn der Vorsatz zum Handlungszeitpunkt nicht mehr aktuell ist. Nicht ausreichend ist es, dass der Vorsatz zwischen der Handlung und dem Erfolgseintritt wegfällt.
Bsp.: Anton überfällt Bruno, um ihn auszurauben. Dabei schlägt er mit bedingtem Tötungsvorsatz auf ihn ein. Nach der Entwendung der Beute wird Anton verhaftet. Nun hofft er, dass der schwer verletzte und inzwischen in einem Krankenhaus liegende Bruno überleben werde. Dennoch stirbt Bruno drei Tage später an den Folgen der Schläge. – Hier ist Anton (neben §§ 249, 250, 251 StGB) auch wegen vollendeten Mordes (aus Habgier, § 211 StGB) zu bestrafen. Dass er zum Zeitpunkt des Todeseintritts diesen nicht mehr wollte, ist unbeachtlich.
4.Dolus alternativus
198 Definition
Unter einem dolus alternativus versteht man einen Vorsatz, der gleichzeitig die Verwirklichung mehrerer Tatbestände umfasst, wobei jedoch nur eine der in Erwägung gezogenen Taten verwirklicht werden kann.
Dieser Vorsatz wird hinsichtlich der tatsächlich eingetretenen Rechtsgutsverletzung wie ein „normaler“ Vorsatz behandelt.
Bsp.: Anton schießt mit der letzten sich in seinem Gewehr befindenden Kugel auf eine Gruppe von Spaziergängern, die ihre teuren Dressurhunde ausführen. Dabei ist es ihm gleichgültig, ob er einen Menschen oder einen Hund trifft und tödlich verletzt. – Trifft er einen Menschen, so ist er wegen Totschlags, § 212 StGB, zu bestrafen. Trifft er einen Hund, dann liegt eine vorsätzliche Sachbeschädigung, § 303 StGB, vor.
199Fraglich ist hier lediglich, ob darüber hinaus auch eine (Versuchs-)Strafbarkeit im Hinblick auf die nicht getroffenen Objekte vorliegt. Dagegen spricht, dass der Täter nur ein Objekt treffen wollte und er eben dieses Ziel auch erreichte. Dafür spricht, dass sonst gegebenenfalls der schwerere Straftatbestand mit der höheren Strafdrohung (hier: der Totschlag, § 212 StGB) nicht zur Anwendung kommen könnte. Letztlich ist hier nach der „Wertigkeit“ der Objekte zu differenzieren: Sind die anvisierten Objekte allesamt tatbestandlich gleichwertig (z. B.: mehrere Menschen), liegt eine vollendete Tat vor, auf die sich auch der Vorsatz bezieht. Hinsichtlich der nicht getroffenen Objekte ist kein Versuch anzunehmen, der Vorsatz ist insoweit „verbraucht“. Sind die Objekte jedoch tatbestandlich ungleichwertig (z. B. Mensch und Hund), so ist weiter zu differenzieren: Verletzt der Täter das höherwertige Rechtsgut (tötet er also einen Menschen), bleibt es beim einfachen Vorsatzdelikt. Daneben kommt kein Versuch (einer Sachbeschädigung) in Frage, denn ansonsten würde der Täter, der auf zwei Menschen zielt, besser stehen als der, der auf einen Menschen und ein Tier zielt. Verletzt der Täter hingegen das geringerwertige Rechtsgut (tötet er also einen Hund), so liegt hinsichtlich dieses Rechtsguts ein vorsätzliches Vollendungsdelikt vor. Daneben tritt jedoch noch ein Versuch in Bezug auf die Verletzung des höherwertigen Rechtsguts (hier des Menschen). Der Täter hat hier also sowohl eine vollendete Sachbeschädigung, § 303 StGB, als auch einen versuchten Totschlag, §§ 212, 22 StGB, begangen.77 Trifft er gar nicht, bleibt es beim versuchten Totschlag, §§ 212, 22 StGB, da es sich hierbei um das schwerere Delikt handelt.
200Abzugrenzen ist der dolus alternativus allerdings vom dolus cumulativus: Rechnet der Täter damit, dass seine Handlung auch mehrere Tatbestände gleichzeitig verwirklichen könnte (Bsp.: Die abgegebene Kugel könnte mehrere Menschen verletzen), dann begeht er tateinheitlich mehrere Versuchs- bzw. Vollendungstaten.
Literaturhinweise
Geppert, Zur Abgrenzung von Vorsatz und bewußter Fahrlässigkeit, insbesondere bei Tötungsdelikten, JURA 2001, 55 (eingehende Darstellung der prüfungsrelevanten Fallgruppe anhand von Beispielen aus der Rechtsprechung); Henn, Der subjektive Tatbestand der Straftat – Teil 1: Der Vorsatzbegriff, JA 2008, 699 (verständlicher Überblick mit Hinweisen zur Klausurbearbeitung); Nicolai, Die Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit in der Strafrechtsklausur, JA 2019, 31 (umfassende klausurorientierte Darstellung des „Standardproblems“); Otto, Der Vorsatz, JURA 1996, 468 (vertiefender Überblick); Rönnau, Grundwissen – Strafrecht: Vorsatz, JuS 2010, 675 (kurze Übersicht mit Hinweisen zur Fallbearbeitung); Satzger, Der Vorsatz – einmal näher betrachtet, JURA 2008, 112 (verständliche, studierendengerechte Einführung)
Schramm, Die Reise nach Bangkok, JuS 1994, 405 (allgemein prüfungsrelevante Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit)
BGHSt 7, 363 – Lederriemen (bedingter Vorsatz); BGHSt 16, 1 – Fahrkarte (Anforderungen an die Bereicherungsabsicht beim Betrug); BGHSt 36, 1 – AIDS (Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit); BGH NStZ 1984, 19 – Zufahren (Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit)