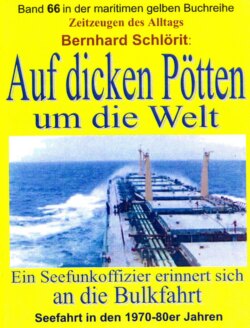Читать книгу Auf dicken Pötten um die Welt - Bernhard Schlörit - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorbemerkungen des Autors:
ОглавлениеSeefahrt in den 1970er und 80er Jahren. Damals trug die deutsche Handelsflotte ihren Namen noch zu Recht, nicht nur der Reeder war ein so genannter „Bundesbürger“, auch die Mehrzahl der Besatzungsmitglieder hatte einen deutschen Pass in der Tasche. Ein großer Teil der Schiffe führte Schwarz-Rot-Gold am Flaggenstock, Leben und Arbeiten an Bord verliefen noch in jenen zum Teil recht traditionellen Bahnen, die deutsche Seeleute seit Generationen kannten. Und der Seemannsberuf hatte zu dieser Zeit noch seinen festen Platz im Bewusstsein vieler Küstenbewohner und auch im Bewusstsein vieler Landratten aus südlicheren Gefilden der Bundesrepublik. Eine Epoche, die dann in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre zügig zu Ende gehen sollte. Die Globalisierung schwemmte in kurzer Zeit die gewachsenen Traditionen hinweg, Schiffe deutscher Reeder sind heute ganz überwiegend unter fremder Flagge und mit ausländischer Crew unterwegs. Nur die hin und wieder gerne mal abgegriffenen Subventionen für die Branche sind noch deutschen Ursprungs…
Seemann. Das war der allgemeine Begriff für jene Mitmenschen, die sich beruflich der See verschrieben hatten. Dabei handelte es sich eigentlich um eine ganze Palette von Berufen, die für den Betrieb eines Seeschiffes benötigt wurden. Kapitäne und nautische Offiziere, zuständig für Schiffsführung, Ladung und Navigation, Schiffsingenieure, verantwortlich für den Betrieb der Antriebsanlage. Matrosen und Decksleute, angeleitet vom Bootsmann, in der Maschine Motorenwärter und Motorenhelfer, geführt vom Lagerhalter, dem „Storekeeper“.
Es gab Köche und Stewards, die für das leibliche Wohl und den Komfort der Besatzung sorgten. Jawohl, damals interessierte man sich auch noch für den Komfort der Besatzung, monatelange Reisen mussten ja nicht zwangsläufig auf dem Niveau eines Überlebenstrainings ertragen werden.
Dank des technischen Fortschritts gab es weitere Spezialisten an Bord. Schiffselektriker, die mit der Bändigung der ausufernden E-Technik und Elektronik alle Hände voll zu tun hatten. Ja, und auch solche Exoten wie die Funkoffiziere gab es in jener Zeit noch. In den Augen ihrer Bordkollegen oft etwas merkwürdige Vögel, die hoch oben in ihrer Funkbude kauerten und in einer schnellen Folge kurzer und langer Töne eine lesbare Nachricht erkannten. Und mit Hilfe ihrer Morsetasten aus genannten Tönen selbst solche Nachrichten erstellten und versandten.
Nun, ich war einer dieser Gesellen, die seinerzeit noch auf den Schiffen die Verbindung zum Land und zu anderen Seefahrzeugen sicherstellten. Mittels Morsetelegrafie, Funkfernschreibbetrieb und Funktelefonie sorgten wir für die Erreichbarkeit der Schiffe. Außerdem waren wir die „Purser“ auf den Frachtschiffen, Verwalter und Zahlmeister, zuständig für die Behördenabfertigung in den Häfen, verantwortlich für Heuer- und Proviantabrechnungen und vieles mehr.
Auch wenn in den Erzählungen von der See der Spaßfaktor immer etwas überhöht dargestellt wird, so war es letztlich die Arbeit, die den seemännischen Alltag bestimmte. Offiziere im Wachdienst, Mannschaften teilweise ebenfalls, im Übrigen aber mit der permanenten Pflege und Wartung des Dampfers befasst. Maloche und Monotonie. Matrosen, die in südlicher Hitze tagelang an der Rostmaschine ackerten, Maschinenleute, die bei Höllentemperaturen an ihrem Diesel werkelten. Und dann im Hafen Stunden mit Kolbenziehen und anderen Reparaturarbeiten verbrachten, die im Fahrbetrieb nicht möglich waren. Für viele Seeleute eine Plackerei über Tage, Wochen, Monate. Dabei nehme ich mich als Funker ausdrücklich aus, wir „Sparkys“ in unserer klimatisierten Funkbude hatten noch ein vergleichsweise gutes Leben. Es liegt in der menschlichen Natur, dass man immer glaubt, das „härtere“ Los in der Arbeitswelt gezogen zu haben als der Kollege nebenan, diesem Irrglauben unterlag ich nicht. Die Tätigkeiten eines Matrosen sind nicht vergleichbar mit der Beanspruchung eines Stewards, ein Koch arbeitet mit anderen Belastungen als ein Storekeeper, das Arbeitsprofil eines dritten Ingenieurs ist ein anderes als das des etwa gleich hoch bezahlten Funkoffiziers. Aber Seeleute waren wir alle, vereint in dieser Arbeitswelt Schiff teilten wir die gleichen Sorgen und Nöte sowie auch die Freuden und Abenteuer, die die damalige Seefahrt noch mit sich brachte. „Seemann“ war letztlich nicht nur ein Beruf. Wer die Seefahrt wählte, wählte eine von der Norm stark abweichende Lebensform. Diese Erläuterungen mögen einem seefahrtsfernen Leser nützlich sein, wenn er sich die nachfolgenden Schilderungen zu Gemüte führt.
In meinem ersten Buch „Hast du mal einen Sturm erlebt?“ habe ich mich detailliert über meinen seemännischen Werdegang und meine erste große Fahrt als Funkoffizier ausgelassen. Etliche, früher selbst auf See tätige Leser ließen mir Anregungen und Kommentare zuteil werden. Darunter war auch der Satz „Mich würde interessieren, was der Autor über seine Erfahrungen in der Bulkfahrt zu berichten weiß“. Zunächst schenkte ich dieser Aussage wenig Beachtung, ich hatte damals meine Erlebnisse in der Kühlschifffahrt zum Themenschwerpunkt gewählt. Aber irgendwie legte sich diese Bemerkung in meinem Hinterkopf ab, und eines Tages kam sie mir wieder in den Sinn. Warum sollte ich eigentlich nicht mal die von mir erlebte Geschichte über die Bulkfahrt niederschreiben? In meinem Seefahrtbuch sind neben einigen Stückgutfrachtern, Kühl- und Containerschiffen immerhin auch vier dieser Massengutfrachter vermerkt, auf denen ich fuhr. Auf zweien dieser dicken Pötte kam ich sogar zweimal zum Einsatz, ich habe also einen nicht unerheblichen Anteil meiner Gesamtfahrtzeit auf solchen großen Schlorren verbracht. Und da gibt es ’ne Menge zu erzählen…
Bei den Seeleuten war die Massengutfahrt auf solchen Bulkcarriern nicht gerade die bevorzugte Form der Seefahrt. Dazu muss man wissen, dass es bei den Sailors eine gewisse Beliebtheitsskala gibt, die verschiedenen Schiffskategorien betreffend. Schiffe sind nun mal so unterschiedlich wie die Menschen, die darauf fuhren. Landratten denken bei Seeschifffahrt zuerst an „Traumschiffe“, diverse TV-Sendungen bewirken wohl nachhaltig eine ausgeprägte Affinität zu Passagierschiffen. Nun, es gibt Seeleute, die diese Vorliebe zu den „Musikdampfern“ durchaus teilen, für diese Kollegen gibt`s nichts Schöneres, als auf einem solchen schwimmenden Hotel zu arbeiten. Seeleute auf Frachtern sind für solche Maaten eine niedere Kaste, die Proleten der See. Für uns Frachterfahrer (und ich war ein Eingefleischter) sind die Passagierkutscher wiederum nichts anderes als bedauernswerte Verirrte, die auf einem schwimmenden Urlaubsbetrieb den lieben langen Tag ihre Uniformen spazieren tragen dürfen und dann noch als Eintänzer für leicht ranzige Passageusen herhalten müssen. Man sieht, auch Seeleute pflegen mit Wonne ihre Vorurteile.
Aber auch für uns Frachterfahrer gab es unterschiedliche Präferenzen. Stückgutschiffe in der Linienfahrt waren lange Zeit das Größte, besonders wenn die Route längs der so genannten Seemannsparadiese führte, Südamerika, Karibik, Ostasien. Dieser Schiffstyp wich aber in den späten Siebzigern und der Zeit danach fast vollständig dem Containerschiff. Dann entschied das Fahrtgebiet noch mehr, ob man diese Fahrt mochte oder auch nicht. Grundsätzlich aber gilt, dass die Containerschifffahrt dem Seemannsberuf sehr viel Attraktivität genommen hat.
Die neu gebauten Container-Terminals entstanden häufig außerhalb der Hafenstädte, mit der ständigen Verbesserung der Umschlagtechnik minimierten sich die Liegezeiten. Diese Entwicklung steckte aber in meiner Fahrtzeit noch in den Anfängen, in den Achtzigern lagen die Containerfrachter in manchen Drittwelthäfen noch Tage.
Kühlschiffe in der Fruchtfahrt waren recht beliebt, die Fahrt zu den mittelamerikanischen Bananenstaaten, oft mit wechselnden Lade- und Löschhäfen, bot damals noch jede Menge Abwechslung ganz nach dem Herzen der Seeleute.
Eine Besonderheit waren die „Fischdampfer“. In dem geschilderten Zeitabschnitt noch ein florierender Wirtschaftszweig, ist die deutsche Hochseefischerei heute fast auf Null geschrumpft. Und wir Frachter-Piepels konnten uns überhaupt nicht vorstellen, warum man überhaupt auf so einem Kahn anheuert. Wochenlang auf See, dann ging’s zurück in den Heimathafen. Und die Heuer bestimmte maßgeblich der Versteigerungserlös dieser stinkenden Biester, die man in endloser Maloche an Bord gezerrt hatte. Nee, danke!
Aber die Bulkfahrt? Was darf die Landratte darunter verstehen? Nun, um es mal zu vereinfachen, die Bulkcarrier transportieren alles, was man lose ins Schiff schütten kann: Eisenerz genauso wie Kohle, Getreide aller Art, Bauxit, Phosphat, Tapioka, ja, und auch das Öl gehört dazu. Obwohl Tanker innerhalb der Massengutfahrt eine eigene Kategorie bilden.
Was nahezu alle Massengutfrachter eint, ist die schiere Größe. Dicke Pötte eben. Großes Schiff bedeutet viel Ladung und damit geringere Transportkosten per Tonne. Also wurden diese Kästen in den letzten vierzig Jahren immer größer, erst mit einer gewissen Frachtmenge rechnet sich der Betrieb dieser Giganten. Im Laufe der Zeit bildeten sich einige Größenkategorien heraus. Da gibt es die Handysize Bulker, Schiffe bis 40.000 tons Ladevermögen, die sehr flexibel einsetzbar sind, aber eben auch nur für „kleinere“ Ladungskontingente in Frage kommen. Oder die Panamax-Bulker, die ihren Beinamen der Eigenschaft verdanken, mal eben noch durch den Panamakanal zu passen. Die haben mit ca. 32 Metern Breite das maximale Maß für die Befahrung der Kanal-Schleusen, gute 80.000 tons Ladung sind im Bereich des Möglichen. Und dann gibt es Capesize-Bulker, die ganz fetten Zarochel, mit 100.000 tons und mehr im Bauch. Inzwischen sind schon die ersten Gurken mit 400.000 tons Ladekapazität unterwegs.
Was machte diese Kähne bei vielen Janmaaten so unbeliebt? Zunächst mal: Die Dinger sind langsam. Kühl- oder Containerfrachter rauschen mit 20 und mehr Knoten zu ihren Bestimmungshäfen, ein Bulkie röchelt mit gemächlichen 13 oder 14 Knoten daher. Oder auch mal weniger, wenn der Charterer „most economic speed“ anordnet. Das bedeutet bei entsprechendem Fahrtgebiet lange Seetörns. Dann die Häfen. Eisenerz wird nun mal nicht in einem innerstädtischen Hafen verladen, in Sichtweite vom Rotlichtviertel. Erzladehäfen sind abgelegene Anlagen, weit vom Schuss. Und die Löschhäfen nach wochenlanger Überfahrt sehen keinen Deut besser aus. Man möge sich mal den Botlek-Hafen in Rotterdam anschauen, 30 Kilometer vor der Stadt. Wenn man aus diesen Häfen ausläuft, stehen keine winkenden Chicas am Ufer wie in den Bananenhäfen Zentralamerikas. Kohle in Norfolk / Virginia zu laden und dann in Fos sur mer (ein Drecksnest an der französischen Mittelmeerküste) wieder zu löschen, ist nicht halb so prickelnd wie eine Hafennacht in Buenaventura oder in Santos.
Es gibt noch eine unschöne Begleiterscheinung der Bulkfahrt. Bedingt durch lange Seezeiten und den Mangel an attraktiven Ports war die mentale Belastung der Crew deutlich höher als bei abwechslungsreicher Linienfahrt. Klarer formuliert: Ein Sailor auf einem Bulkie hatte ein spürbar höheres Risiko als ein Linienfahrer, nach einigen Monaten auf See mit einer gepflegten Vollmeise nach Hause zurückzukehren. Mehr als einmal wurde ich Zeuge von Ausrastern und sonstigen abstrusen Verhaltensauffälligkeiten. Teilweise war`s erheiternd (für die nicht betroffenen Zuschauer), teilweise schon nicht mehr. Und das schloss alle Dienstgrade mit ein, vom Alten bis runter zum Messesteward. Auf diesen Trips war man permanent vom Lagerkoller bedroht.
Meine persönlichen Erfahrungen mit der Massengutfahrt sind durchwachsen. Einige Reisen waren öde, sterbenslangweilig und die angelaufenen Häfen zum Abgewöhnen. Auf diese Reisen werde ich hier gar nicht näher eingehen, dann täten`s auch zweihundert leere Buchseiten. Andere Trips stellten sich überraschend als „Traumtrips“ heraus, üppige Liegezeiten und in nächster Nähe genau das „Unterhaltungsangebot“, das Hein Seemann so schätzt. Also das exakte Gegenteil von den oben geschilderten negativen Seiten der Bulkfahrt.
In diesem Buch will ich über meine Dienstzeit auf zweien dieser Dickschiffe erzählen. Von der „PROPONTIS“, einem Panamax-Bulker der Reederei Laeisz. Eine für die damalige Zeit typische Tramp-Reise mit wechselnden Zielen und Ladungen, wochenlangen Überfahrten, aber auch üppigen Liegezeiten in gar nicht mal unattraktiven Häfen. Und von der „SAXONIA“, einem etwa gleich großen OBO-Carrier der Reederei Ahrenkiel. Ein Schiff, das sowohl für Öltransporte als auch für trockene Massengutladung eingesetzt werden konnte. Die SAXONIA findet sich zweimal in meinem Seefahrtbuch, ich habe rund 11 Monate auf diesem Schiff gelebt und gearbeitet. Und dabei viele schräge Dinge erlebt, die mir selbst in der Wiedergabe noch unglaublich vorkommen. Dieses Schiff hatte innerhalb der Reederei Chr. F. Ahrenkiel schnell den Ruf einer „schwimmenden Katastrophe“, zahlreiche Kollegen weigerten sich bei Anfrage der Personalabteilung strikt, auf dem Zossen einzusteigen. Technisch war der Kahn ein einziges Desaster, sowohl die Maschine als auch die sonstigen Anlagen und Einrichtungen waren exzessiv pannengeplagt. Darüber hinaus spielten sich auf dem Dampfer immer wieder menschliche Dramen ab, ein Kapitän ruinierte beinahe seine Ehe, ein anderer versoff auf diesem Schiff seine Karriere.
Mit gutem Grund wird also der Leser hier wenige „echte“ Namen der agierenden Kollegen finden. Überhaupt erzähle ich einige der Vorkommnisse nur, weil die handelnden Personen in diesen Fällen nicht mehr unter den Lebenden weilen. Und viele Namen damaliger Seeleute sind mir einfach nicht mehr erinnerlich, auch aus diesem Grund habe ich fiktive Namen verwendet.
Wenn ein Seemann aus der Fahrt berichtet, tauchen auch häufig die deftigen Begleiterscheinungen der Seefahrt auf. Immer wieder einmal kam es zu alkoholischen Exzessen mit manchmal fatalen Folgen für die Betroffenen. Zog es die Janmaaten an Land, zog es sie manchmal auch zum Weibe hin. Unternehmungen, die in schönster Regelmäßigkeit in den Armen einer Hafennutte endeten. Oder auch nicht, wenn widrige Umstände dem entgegen wirkten. Klischees, mag der eine oder andere Leser denken. Ja, Klischees, aber die hatten durchaus ihren wahren Kern.
Zu dem Thema Hafennutten noch ein Wort: Die Begegnungen mit solchen Damen nahmen in meinem ersten Buch breiten Raum ein. Die Bananenfahrt nach Mittel- und Südamerika brachte es nun einmal mit sich, dass es in den dortigen kleinen Hafenstädtchen häufig zu solchen Kontakten kam. Etliche Leser zogen daraus den Schluss, dass sich Seeleute grundsätzlich durch die Puffs der Häfen vögelten und die Arbeit so nebenbei erledigten. Falsch. In bestimmten Fahrtgebieten herrschte gewissermaßen ein Überangebot williger und auch exotisch reizvoller Damen, das von einem Großteil, aber nicht von allen Besatzungsmitgliedern, freudig wahrgenommen wurde. In anderen Fahrtgebieten war das nicht der Fall, und die Sailors verbrachten ihre Monate an Bord in mönchischer Enthaltsamkeit. Früher und heute ist es aber zutreffend, dass die Triebabfuhr eines Seemannes in Fahrt fast ausschließlich mit Prostituierten stattfand. Und, das soll hier nicht unerwähnt bleiben, etliche Janmaaten versagten sich diese „Freuden“. Teilweise, weil sie in der Heimat glücklich liiert waren, aber auch aus Angst vor Ansteckungen oder einfach aus grundsätzlichen Überlegungen heraus. Hin und wieder gab es an Bord auch mal einen Moralisten, der empört den Zeigefinger hob. Und dann in allen Decks brüllendes Gelächter auslöste. In der Masse gingen wir Seeleute locker mit diesem Thema um.
Erzählen werde ich nun die folgende Geschichte so, wie ich sie auch verbal rüberbringen würde, unter teilweiser Nutzung unserer damals üblichen Bordsprache. Das schließt einen gewissen rustikalen Ton mit ein, wenn der Seemann zum Vögeln an Land ging, dann gedachte er zu vögeln. Und nicht zu kopulieren. Wer dies nicht lesen möchte, ist mit der Lektüre eines verträumten Heimatromanes besser bedient, da bleiben ihm solche Zumutungen erspart.
Die schon erwähnten langen Seetörns auf den Bulkern führten bei mir zu einer gesteigerten Schreibfreudigkeit, was Briefe in die Heimat betrifft. Daher liegen mir gerade zu den Fahrtzeiten auf diesen beiden Schiffen besonders viele meiner Schilderungen und detaillierte Berichte vor, die ich damals meinem Freundeskreis übermittelte. Danke an Christa und Willi, die mir mein früheres Geschreibsel wieder zur Verfügung stellten. Danke an die Kapitäne Klaus Bergmann und Hermann Ehlers, die als junge Offiziersanwärter mit mir auf diversen Pötten fuhren und mir besonders im nautisch / technischen Bereich Detailfragen beantworteten, die mir nicht mehr so genau erinnerlich sind. Danke an meinen Funkerkollegen Jürgen Coprian, der, selbst Verfasser zahlreicher Bücher über seine Seefahrtserlebnisse, letztlich den Anstoß dafür gab, dass ich meine Erinnerungen niederschrieb. Und meiner Inge danke ich für ihre Leidensfähigkeit, mit der sie das wochenlange Abtauchen des lieben Gatten in seine Seefahrtserinnerungen ertrug. Während der Niederschrift eines solchen Buches ist man ja kaum noch ansprechbar und auch sonst für nichts Sinnvolles mehr zu gebrauchen… Also, noch mehr Gelaber zur Einleitung braucht ’s nun wirklich nicht.
Ich begebe mich auf eine Zeitreise in den Februar 1978. Die Reederei Laeisz hat meinen zweimonatigen Urlaub mittels eines Telefonanrufes abrupt beendet und mich nach Rotterdam beordert. Und dort soll ich auf MS PROPONTIS einsteigen.
Auf dicken Pötten um die Welt
– Ein Funkoffizier erinnert sich an die Bulkfahrt –