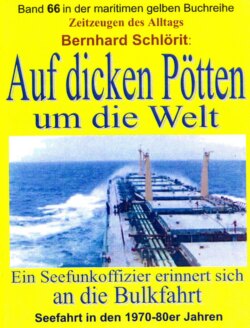Читать книгу Auf dicken Pötten um die Welt - Bernhard Schlörit - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Eisenerz und „Yellow Corn“
ОглавлениеEs ist früher Nachmittag, als meine Linienmaschine auf Amsterdam-Schiphol landet. Freunde hatten mich am Morgen nach Frankfurt zum Flughafen gebracht, nach dem „Check in“ tranken wir noch ein letztes Bier zusammen, und damit war mein Urlaub zu Ende. So, und jetzt stehe ich in der Ankunftshalle in Amsterdam und kann zusehen, wie ich zum Schiff gelange. Nach zwei Einsätzen auf Kühlschiffen hatte das „Mutterhaus“ in Hamburg beschlossen, dem Funker Schlörit mal `ne andere Art der Seefahrt nahe zu bringen. Auf mich wartete einer der beiden Massengutfrachter der Reederei F. Laeisz, die PROPONTIS. Ein Bulkie wie aus dem Bilderbuch: 255 Meter lang, knapp über 32 Meter breit, 80.000 Tonnen Tragfähigkeit, 43.476 BRT. Die kleinen Bananenjäger, auf denen ich in meiner noch recht kurzen Funkerlaufbahn bisher gewirkt hatte, sahen neben diesem Schlorren wie Faltboote aus.
Aber zunächst mal muss ich den Kahn finden. Am Telefon hatte mir Frau Schibinsky, die fürsorgliche Personalsachbearbeiterin der Reederei Laeisz, lediglich den Liegeplatz mitgeteilt.
Vom Amsterdamer Airport gibt`s `ne Busverbindung zum zentralen Busbahnhof Rotterdam. Nach einigem Hin und Her gelange ich zum Bus. Gurke eine Stunde mit zwei Dutzend Mitpassagieren über holländische Schnellstraßen. In Rotterdam fange ich mir ein Taxi ein. „Zum Botlekhafen bitte!“ Bei der Nennung des Fahrtzieles wird der Taxipilot saufreundlich, bietet mir umgehend seine Zigaretten und den Beifahrersitz an und zeigt jenes bei Taxlern übliche Verhalten, wenn sie einen Großauftrag erhalten. Es folgt ein Taxi-Ritt von 45 Minuten. Rotterdam bleibt im Nebel zurück, und eine ganze Weile geht es vorbei an Industriebetrieben, Öltanks, Raffinerien. Dann Kohle- und Erzhalden, Berge von Kali und sonstigem Dreck.
Schließlich landen wir an einem riesigen Hafenbecken. An den Kais etliche Dickschiffe, die von gigantischen Portalkränen mit Greifern entladen werden. Und mitten in diesem Hafenbecken, an Bojen vertäut, liegt ein schwimmender Koloss.
Die PROPONTIS. Mann, was für ein Brocken. Endlos lang, keinerlei Masten oder sonstiges Geschirr an Deck, schwarzer Rumpf, weiß gestrichene Aufbauten, der riesige Schornstein laeisz-typisch in fahlem Gelb.
Aber wie komme ich jetzt da rüber? Der Taxifahrer trägt die Lösung dieses Problems im besten Holländer-Deutsch vor: „Musst du mit die kleine Bout faare!“
An einem Anleger, Liegeplatz mehrerer kleiner Barkassen, setzt er mich ab. Und schon quakt mich einer der Barkassenführer an, der ist von unserer Agentur beauftragt worden, die über den ganzen Tag eintreffenden Neuanmusterer zur PROPONTIS zu schippern. Na also, dann ist ja für Alles gesorgt. Minuten später tuckert das „kleine Bout“ mit Sparks, seinem Koffer und seiner Reisetasche los in Richtung Dampfer. Näher am Schiff fällt mir zunächst die Riesensauerei ins Auge, die den Kahn einhüllt. Auf der Backbordseite haben zwei große Pontons festgemacht, auf diesen Plattformen stehen hohe, mehrgeschossige Aufbauten mit mehreren Treppenaufgängen. Von den Türmen hängen an Auslegern verbaute gewaltige Rüssel in den geöffneten Luken der PROPONTIS. So genannte Saugheber. Und über den Luken steht eine weiße Staubwolke, dieser Staub hüllt auch das ganze Schiff ein, der Schlorren sieht aus wie gepudert. Und da die nebligen Februarnächte nun mal viel Feuchtigkeit mit sich bringen, hat sich die Staubschicht inzwischen zu einem flächendeckenden weißen Schleim verwandelt. Was für einen Dreck haben die denn transportiert? An der dem Schiff abgewandten Seite der Pontons liegt ein Binnenschiff, der weiße Mist wird direkt von meinem neuen Pott in diesen Rheinfrachter umgeladen. Na, das kann ja noch `ne Weile dauern, der Tiefgang der PROPONTIS signalisiert mir, dass man gerade erst mit den Löscharbeiten begonnen hat.
So, und jetzt kommt der sportliche Teil meines Dienstantrittes. Auf das Deck des Dampfers gelange ich nur über die gefühlten Dutzend Treppen der Ponton-Türme. Ich bin mit guten 25 kg Gepäck unterwegs, Koffer, Reisetasche und noch `ne Umhängetasche, die ich mit in der Flugzeugkabine hatte. Das in jenen Jahren übliche Limit für Fluggepäck war für Seeleute etwas erhöht worden, wir durften bis zu 30 kg einchecken, die normalsterbliche Landratte musste mit 20 kg auf Reisen gehen. Deshalb war auch unser beruflicher Status auf den Tickets vermerkt. Eines der wenigen Privilegien, die dem „Seemann in Transit“ zugebilligt wurden. Fluchend aste ich mit meinen Plünnen die Eisentreppen hoch, schon nach zwei Treppen schwitze ich wie ein verdammter Sauna-Freak, Februarkälte hin oder her. Und erreiche nach etlichen Minuten Klettertour und einigen Schritten über eine kleine Gangway das Deck meines neuen Arbeitsplatzes. Nähere mich den Aufbauten, dort lungern ein paar Crewmitglieder herum, die meiner Klettertour grinsend zugeschaut hatten. „Hallo Sparks, auch mal wieder unterwegs?“ – Hä? – Jetzt erkenne ich ihn. Vor mir steht Bootsmann Willy Möller, mit dem war ich einige Zeit auf meinem letzten Dampfer unterwegs, dem Bananenjäger „PERSIMMON“. Origineller Typ, auf den Laeisz-Dampfern kennt man ihn nur unter dem Namen „Schweine-Willy“. Den hat er sich eingehandelt, als er mal in dem ecuadorianischen Hafen Puerto Bolivar versuchte, auf einer Sau reitend zum Schiff zu gelangen. Und damit kenne ich schon mal zumindest einen der Piepels hier auf dem Kahn.
Stellt sich gleich als Vorteil heraus, Schweine-Willy weist umgehend einen der Gilbie-Matrosen an, mein Gepäck hoch zur Funkerkammer zu schleppen. Als der gerade zupacken will, stürzt sich plötzlich ein Köter auf meinen Koffer. So ein halbhoher Mischling, drei Sorten Hund in einem Fell. Der fletscht die Zähne wie bekloppt und versucht, sich in meinen Samsonite zu verbeißen. Willy schnappt sich ungerührt den Fiffi im Nacken und hält das knurrende Vieh fest, bis der Gilbie mit meinem Gepäck in den Aufbauten verschwindet. Dann lässt er den Hund los, und der ist sofort ganz friedlich. „Was war denn das für `ne Nummer?“ frage ich. „Och“, meint Willy, „das ist Jackie, unser Bordhund. Ganz verträglicher Köter, aber wenn der `nen Koffer sieht, dreht der durch. Der ist schon `ne ganze Weile an Bord, einer aus der Crew hat sich dann immer um ihn gekümmert und ihn in seiner Kammer pennen lassen. Und wenn dann Koffer in der Gegend rum stehen, war kurz danach Herrchen weg. Jetzt hat das Vieh `ne Kofferallergie!“ Kopfschüttelnd gehe ich weiter ins Deckshaus.
Drinnen ist es erstens warm und zweitens sauber, der weiße Schlamm da draußen ist nur im untersten Deck noch zu sehen, dort haben sie große Papierbahnen in den Gängen ausgelegt.
Um mich herum typische Schiffs-Atmosphäre, gedämpftes Brummeln aus dem Maschinenraum, summende Lüfter. Alles viel großzügiger und weitläufiger als auf den Bananenjägern, die ich bisher kenne. Ich steige einen Niedergang nach dem anderen hoch, im zweiten Deck steht plötzlich eine Gestalt vor mir, Uniformjacke, vier Streifen, Glatze und Schnauzbart. Sieh mal guck, der Reiseleiter. Gegenseitige Vorstellung, Höflichkeitsfloskeln.
Ich denke: `Ob ich mit dem klar komme?’. Er denkt: `Hoffentlich beherrscht der seinen Job`. Ich kann zwar keine Gedanken lesen, dürfte aber mit meiner Vermutung ziemlich richtig liegen.
Weiter auf dem Weg nach oben, Funkstationen sind in aller Regel unterm Dach juchhe, oft sogar auf dem Brückendeck. Ist hier allerdings nicht der Fall, eins unter der Brücke, auf dem vierten Deck, Backbordseite achtern, finde ich meinen neuen Arbeitsplatz. Dort sitzt mein Kollege, sein Gepäck steht schon im Gang, und er zeigt diesen unverschämt fröhlichen Gesichtsausdruck, den Hein Seemann nur bei der Begrüßung seines Ablösers aufsetzt.
Kurzes Händeschütteln. Dann legt sich der Kollege gleich mächtig ins Zeug und fängt an, mir die Funkstation zu erklären. Ist auch angebracht, diese Ausstattung kenne ich nämlich nicht. Auf meinem ersten Kahn, der PEKARI, war ich noch mit einer uralten Anlage unterwegs, leistungsschwach und ziemlich antiquiert. Danach fuhr ich auf der PERSIMMON zunächst mit dem gleichen Dampfradio los, erhielt aber während eines kurzen Werftaufenthaltes in Hamburg einen neuen SSB-Sender, zwar nur mit 400 W Leistung, aber immerhin. Und jetzt stehe ich hier in einer Funkstation vom Allerfeinsten.
Vor mir der Sender ST1400, in dieser Zeit ein Spitzenmodell. 1.200 W im A1-Betrieb, 1.500 W bei SSB-Telefonie. Supermoderner Haupt-Empfänger, aber als Zweitempfänger noch die alte Regenbogenkiste Siemens E566. Ja, und ein Fernschreiber ist ebenfalls Bestandteil der Anlage, zum ersten Mal fahre ich nun mit einer Funktelex-Maschine. Super. Ich denke mal, die Zeit mühsamer nächtlicher Verbindungsversuche mit schwächster Leistung dürfte für mich vorbei sein.
Dann noch Einweisung in die Verwaltungs-Angelegenheiten. Bis zu den Monatsabrechnungen habe ich noch Zeit, ich kann alles ruhig angehen lassen. Nach `ner guten Stunde Frage- und Antwortespiel bin ich weitgehend im Bilde. Der Dampfer soll noch `ne ganze Weile hier liegen, man rechnet mit zwei Wochen Löschzeit. Für mich ausreichend Gelegenheit, mich gründlich mittels der technischen Unterlagen mit der Station vertraut zu machen.
„Was habt ihr eigentlich hier für `nen Shit geladen, der Kahn sieht ja aus wie ein explodierter Mehlsack?“ – „Das ist Tapioka. Wird aus Maniokwurzeln gewonnen, ist unheimlich kohlehydrathaltig und wird in riesigen Mengen importiert. Dient zur Futtermittelherstellung und wird auch in der Lebensmittelindustrie verwendet!“ – „Und woher kommt ihr?“ – „Thailand. Eine irre Geschichte, wir lagen drei Wochen vor Ko Sichang, so 80 Kilometer südlich von Bangkok. Hunderte von Thaiarbeitern luden das Zeug nach dem Ameisenprinzip, die bilden `ne Menschenkette zu den Luken und schütten Tapioka aus Säcken in die Räume. Die Maaten hatten fast alle `ne Thai-Mieze auf der Kammer, an Deck brutzelten any many Garküchen, das war ein Traum. Du hattest Thailand-Urlaub, ohne einen Fuß von Bord zu setzen!“ – Donnerwetter, da wäre ich gerne dabei gewesen. „Und wo geht der Dampfer als Nächstes hin?“ – „Ist noch nicht entschieden. Wir sind jetzt mit Abschluss dieser Reise aus dem Euroscan-Pool ausgeschieden und nun hat `ne belgische Firma den Kahn gechartert, BOSIMAR heißen die. Die haben aber noch keine Reise-Order zugestellt!“
Damit verabschiedet sich mein Kollege, von jetzt an bin ich „in Charge“. Und nehme nun mein kleines Reich in Besitz.
„Mensch Sparky, du hier und nicht in Hollywood?“ Ich fahre in meinem Drehstuhl herum. „Ja, leck mich doch… Herbie, alte Socke, was machst du den hier?“ – „Nach was sieht`s denn aus? Ich soll hier mitfahren und aufpassen, dass du nicht mit den Fingern isst und keine kleinen Mädels belästigst!“ Vor mir steht Herbie, seinerzeit 2. Offizier auf der PEKARI und mit mir etliche Male in den übelsten Spelunken Mittelamerikas versackt. Das ist ja `ne Überraschung. Vorteile hat es schon, wenn man bei einer kleinen, aber feinen Reederei fährt. Acht Dampfer betreibt Laeisz unter deutscher Flagge, da trifft man auf dem dritten Schiff schon jede Menge bekannter Gesichter.
Herbie ist seit gestern an Bord und hat die Lage bereits sondiert. Und sogleich legt er los: „Mein lieber Schwan, auf dem Zossen geht was ab. Sodom und Gonorrhöe, kann ich nur sagen!“ – „Wieso, was läuft denn hier?“ Und was ich dann höre, wirft mich fast vom Stuhl.
Beim Einlaufen vor eineinhalb Tagen war die Stimmung total versaut. Der Chiefmate, also der 1. Offizier, war auf See seines Dienstes enthoben und gesackt worden. Grund: fortgesetzte Trunkenheit. Dem ging ein Eintrag bezüglich der Sauferei im Schiffstagebuch voraus. Chiefmate entdeckt den Eintrag… und feuerte das komplette Tagebuch über die Kante. Anschließend fristlose Kündigung. Dem Bootsmann wurde zum Einlaufen gekündigt. Grund: der versuchte, noch mehr zu schlucken als der Chiefmate. Deshalb war Schweine-Willy seit gestern als Ersatz an Bord. Der Koch soff ebenfalls wie ein Loch und war schon in Thailand entsorgt worden. Krankheitshalber. Von da an waren sie nur noch mit `nem Kochsmaaten unterwegs, der war aber kein Meister seines Fachs.
Während der vierwöchigen Reise von Ko Sichang nach Rotterdam waren offene Aggressionen ausgebrochen, es kam zu Arbeitsniederlegungen.
Eine maßgebliche Rolle bei dieser Tragikkomödie kam Frau M. zu, einer Stewardess. Normalerweise fahren bei Laeisz Gilbertesen als Stewards, jene Südseeinsulaner, die schon seit Jahren bei dieser Reederei als Matrosen, Motorenhelfer oder eben auch Messbüddels eingesetzt werden. Frau M. erhielt den Job, weil sie mit einem ebenfalls an Bord eingesetzten deutschen Matrosen verlobt war und so mitfahren konnte. Nach einigen Wochen entdeckte die Lady aber wohlwollend, dass auch noch andere Rüden an Bord zur Verfügung standen, und schon begann ein fröhliches Treiben in fremden Kojen. Der deutsche Matrose sagte sich wutschnaubend von der Dame los und ignorierte sie dann weitestgehend. Irgendwann kam auch besagter Chiefmate bei der Lady mal zum Zuge, wurde aber später umgehend gegen Luki O`Brian ausgetauscht, einen britisch/gilbertesischen Decksmann. Von da an ging Chiefmate in Wogen von Alkohol unter. Selbstverständlich verhängte der Alte einen Alkoholstop für den Ersten, der war aber trotzdem täglich blau. Wohlmeinende Unterstützer, darunter der inzwischen gesackte Bootsmann, versorgten ihn zunächst weiter mit Stoff. Kleine Anekdote am Rande: In einem Kompass auf der Brücke wurde genau in dieser Zeit eine Verfärbung der Kompassflüssigkeit festgestellt, einer Alkohollösung. Und schon verbreitete sich auf dem ganzen Dampfer das Gerücht, der Chiefmate habe den Kompass leer gesoffen und die Lösung durch Wasser ersetzt. War natürlich Stuss hoch drei, aber die Story hielt sich hartnäckig und wochenlang.
„Die Sache ist noch lange nicht ausgestanden!“, meint Herbie, „Inzwischen werden bei der Reederei `ne ganze Menge Fragen gestellt. Schätze, da rollen noch mehr Köpfe!“
Wir unterhielten uns noch `ne ganze Weile. Mit Herbie hatte ich schon mal einen brauchbaren Kumpel an Bord. Und wenn wir in zwei Wochen auslaufen würden, wäre bestimmt `ne ganz andere Crew hier im Einsatz. Abends, in der Koje, ziehe ich noch mal ein gedankliches Fazit. Nun war ich also auf einem Bulkie eingestiegen. An Bord jede Menge Suffköppe, die man gerade gefeuert hatte oder noch feuern wird. Eine Stewardess mit ausgeprägtem Juckreiz im Unterleib. Und ein bekloppter Bordhund mit Kofferallergie. Schauen wir mal, wie das hier weiter geht…
Eineinhalb Wochen später. Wir liegen immer noch im Botlek-Hafen. Das Löschen der Tapioka-Ladung ist eine verdammt langwierige Geschichte, alles geht in die schon erwähnten Binnenschiffe und das zieht sich. Inzwischen sieht `s an Deck noch wüster aus, überall dieser verdammte weiße Dreck. Nach dem Auslaufen wird die Decksgang ganz schön zu tun haben, um den Kahn wieder sauber zu kriegen.
In dieser Woche hat sich Einiges getan. Die rührige Dame mit dem unruhigen Unterleib hat selbst abgemustert. Als Abschiedsvorstellung schleppte sie ihren Lover Luki O’Brian noch zum Generalkonsulat nach Amsterdam und wollte den dort ehelichen. Unter denkbar schlechten Voraussetzungen, es fehlten beider Geburtsurkunden, die in dieser Zeit noch verbindliche Aufgebotsfrist war nicht eingehalten worden, eigentlich legten die nur ihre Reisepässe vor. Der Konsul schickte sie umgehend vor die Tür, man sei schließlich nicht in Las Vegas. Lucky Luki tauchte am nächsten Tag wieder alleine an Bord auf, die Hochzeit sei zunächst mal verschoben.
Der harte Kern der alten Crew ist inzwischen vollständig abgelöst worden, die Ereignisse an Bord haben doch einigen Wind in Hamburg ausgelöst. Und auch der Kapitän wurde von Bord genommen. Der neue Alte, Kapitän Behneke, genießt bei den Leuten, die ihn bereits kennen, einen guten Ruf, er gilt als kollegial und soll die Dinge nicht so verbissen sehen. Schauen wir mal.
Einmal war ich in dieser Zeit an Land. Ich hatte mich einigen Maschinenleuten angeschlossen, zu viert war die Taxifahrt halbwegs erschwinglich. Natürlich landeten wir im „Katendrecht“, dem Rotlichtviertel Rotterdams. War aber ein Schuss in den Ofen, der Abend verlief äußerst trist. Wir zogen durch ein paar schmuddelige Bars, hockten trübsinnig auf zerschlissenen Barhockern und trafen überwiegend auf Damen fossilienhaften Alters, deren Gesichter unter dicken Schichten von Farbe oder Glasur kaum zu erkennen waren. Führten blödsinnige Dialoge, so etwa: „Na, Süßer, bist `de mit dem Schiff hier?“ – „Nee, mit `nem Zeppelin!“ – „Gibst `de einen aus?“ – Seh ich aus wie beknackt?“ Wir waren froh, als wir morgens gegen zwei Uhr wieder an Bord waren. Rausgeschmissenes Geld.
In drei Tagen sollen wir eigentlich auslaufen. Der Charterer hat sich aber noch nicht über die Route ausgelassen, kein Schwanz weiß, wo wir eigentlich hinfahren sollen. Oder wie es der Gilbertesen-Steward in etwas schrägem Englisch rüberbringt: „Nobody knows, what way!“
Und dann, einen Tag später, liegt die Reise-Order auf dem Tisch. Der Alte verkündet in der Messe die frohe Botschaft: Ballast-Reise nach Westafrika, wir sollen Lower Buchanan in Liberia ansteuern. Dort wird Eisenerz geladen, anschließend geht’s rüber nach Philadelphia, US-Bundesstaat Pennsylvania. Hätte schlimmer kommen können…
Von links: der Alte, der Chief, Norbert „Edler von Schwaben“, ein Assi,
NOA Hermann und Schweine-Willy
Mittags Smalltalk in der Offiziersmesse. Keiner der Jungs war schon mal in Buchanan gewesen, also Neuland für alle Piepels an Bord. „Sind über 3.300 Seemeilen!“, verkündet Herbie. „Der Charterer hat 13 Knoten Speed vorgegeben, da dödeln wir so knappe 11 Tage auf See rum, bis wir dort sind!“ 13 Knoten. Auf den Bananenjägern heizten wir meistens mit 20 oder 21 Knoten übern Teich. Eisenerz ist kein eiliges Frachtgut. Ist schließlich nicht von Fäulnis bedroht, im Gegensatz zu Bananen. Na ja, unser fetter Bulker war eh nicht so schnell. Wenn man alles aus der 17.000 PS starken Antriebsanlage rauskitzelte, waren 15,5 Knoten drinn. Und bei dieser Geschwindigkeit wurden dann täglich locker 40 Tonnen Schweröl verbrannt…
Über eine Woche später. Fast zwei Drittel der Seereise sind bewältigt, Zeit für ein erstes Resümee. Es hat dann tatsächlich zwei Wochen gedauert, bis die komplette Tapiokafracht gelöscht war. Inzwischen war eine stattliche Anzahl von kleinen Binnenfrachtern rheinaufwärts und sonst wo unterwegs, um dieses Zeug an seine Bestimmungsorte in Mitteleuropa zu transportieren. Mit dem Auslaufen begann das große Cleaning-Manöver für die Decksgang, der komplett versaute Dampfer musste gereinigt werden. Ebenfalls die riesigen Laderäume. Insgesamt neun dieser Räume gibt es auf dem Schiff, groß wie Kathedralen. Tagelang war Schweine-Willy mit seiner Matrosentruppe im Einsatz, um die Rückstände dieser Ladung wieder vom Deck und aus den Luken zu kriegen.
Von einem Irrglauben werde ich schon kurz nach dem Passieren des englischen Kanals geheilt. Ich hatte mir eingebildet, dass so ein dicker Schlorren wohl kaum allzu spürbar ins Wackeln gerät, wenn die See mal unruhig wird. Und die ist unruhig, Ende Februar bläst es ganz stramm in der Biskaya. Wir fahren in Ballast, die Ballasttanks sind mit Wasser befüllt, um die Kiste stabil zu halten. 30.000 Tonnen Ballastwasser, verteilt auf Doppelboden- und Wingtanks sowie Luke 5. Aber der Bock rollt wie wahnsinnig. Merke: dickes Schiff ist nicht gleich ruhige Fahrt.
Ich selbst freue mich nach wie vor über meine höchst leistungsfähige Funkstation. Ganz schnell stecke ich wieder in meiner täglichen Arbeitsroutine, den immer gleichen Tätigkeiten in der Funkbude. Regelmäßig nehme ich die für das befahrene Seegebiet ausgestrahlten Wetterberichte auf. Auch unsere Nautiker auf der Brücke erstellen fortlaufend Berichte mit Wetterbeobachtungen, die ich dann sende. Unser Beitrag zur Erstellung großräumiger Wetterprognosen. Ich nehme täglich eine Funkpresse auf, die Crew will schließlich auch verfolgen, was in der Welt dort draußen gerade Sache ist. Konstant höre ich die Sammelanrufe von Norddeichradio ab, um so zeitnah wie möglich für das Schiff eingehende Nachrichten zu empfangen. In gewissen Zeitabständen sende ich Positionsmeldungen und ETAs für Charterer und Reederei, berechnete Ankunftszeiten. Über acht Stunden täglich überwache ich die Not- und Anruffrequenz 500 kHz. Ich schreibe nautische Warnmeldungen mit, die auf Unregelmäßigkeiten im befahrenen Seegebiet hinweisen. Vertriebene Fahrwassertonnen, defekte Leuchtfeuer und dergleichen. Hin und wieder erscheint ein Besatzungsmitglied und will nach Hause telefonieren. Funker-Alltag. Und hier kann man auch fast immer und überall telefonieren, mit einem Einseitenband-Sender, der mit 1.500 Watt in den Äther bläst, ist das überhaupt kein Problem. Jedenfalls nicht auf unserer Route. Und mit diesem sehr leistungsfähigen Equipment bin ich nun auch häufiger Teilnehmer bei der „Quasselwelle“.
Quasselwelle? Nun, das waren Frequenzen, auf denen seit den 1970er Jahren deutsche Seefunkstellen untereinander kommunizierten. Die meistgenutzte Frequenz war 16.587,1 kHz, alle vier Stunden, von 00:00 Uhr UTC an gerechnet, trafen sich die Sparkys auf dieser Welle zum Klönschnack. Manchmal nur, um zu tratschen. Manchmal auch, um wertvolle Informationen auszutauschen. In diesen Jahren setzten sich die leistungsstarken Sendeanlagen mit Einseitenbandbetrieb flächendeckend durch, problemlos ließen sich auch große Distanzen per Sprechfunk überbrücken. Besonders nützlich wurde die Quasselwelle, wenn man in entlegenen Seegebieten (z. B. Südpazifik) auch mit starken Sendern Schwierigkeiten hatte, nach Norddeichradio durchzukommen. Günstiger positionierte Schiffe übernahmen dann Nachrichten und gaben sie weiter, man half sich gegenseitig.
Und dann habe ich ja nun auch Telex an Bord. Gibt’s 1978 weiß Gott nicht auf jedem Kahn. Die Verkehrsabwicklung ist noch etwas umständlich, ich rufe zunächst Norddeich erst mal im Telegrafie-Betrieb und melde das Telex an. Nach entsprechendem Frequenzwechsel ruft mich dann die Küstenfunkstelle im Fernschreib-Modus, der Sender beginnt in der Slave-Funktion zu arbeiten. Das Fernschreiben habe ich bereits auf einem Lochstreifen vorgefertigt und starte die Übermittlung. Feine Sache, auch größeres Textvolumen geht nun problemlos über den Äther. Lohnt sich ohnehin nur bei längeren Botschaften, Telexe werden nach Zeit abgerechnet, Telegramme nach Anzahl der Wörter. Aber ein gewisser Prozentsatz des Nachrichtenaufkommens läuft nun über den Fernschreiber, die Morsetaste wurde nicht mehr bei jeder Message verwendet. Und dieses Verfahren sollte in den folgenden Jahren immer mehr ausgebaut werden, in den Achtzigern wurde auch die Verbindungsaufnahme automatisiert. Das Ende der Morsetelegrafie zog langsam, aber stetig, am Horizont herauf.
Eines Nachmittags schalte ich mich auf die Quasselwelle: „Delta Alpha Alpha Delta, hier ist die PROPONTIS, Delta Alpha Delta Yankee, war schon mal einer in Lower Buchanan?“ DAAD war der allgemeine Sammelanfruf für alle deutschen Schiffe, DADY war das Unterscheidungssignal der PROPONTIS, mein Rufzeichen.
Und schon antwortet ein Kollege, Funker auf einem Bulkie der Flensburger Reederei Jakob. „War letztes Jahr dort, was wollen Sie denn wissen, Herr Kollege?“ – „Wie sieht’s denn da mit der Einklarierung aus, gibt’s irgendwas zu beachten, das vom Standard abweicht?“ – „Nun ja, das ist halt afrikanischer Standard. Die sind korrupt bis auf die Knochen, die schleppen an Präsenten von Bord, was sie kriegen können. Und die Beamten sind auch noch arrogant bis zum Geht nicht mehr. Gib so `nem schwatten Deibel `ne Uniform, und du findest den nich` wieder, so hoch schwebt der über dir rum!“ Na ja, hätte ich mir denken können, generell gab es bei der Seefahrt die Theorie, dass mit den landestypischen Temperaturen auch die Korruption steigt. Durch zahlreiche Reisen nach Zentralamerika bin ich auf diesem Gebiet schon ziemlich abgehärtet.
In den beiden Wochen der Rotterdamer Liegezeit und den vergangenen Tagen auf See hatte auch die zum größten Teil neue Crew zueinander gefunden. Schon einen Tag nach Auslaufen steht der Alte in der Tür der Funkbude, zwei Buddels Holstenbier in der Hand. „So, Funker, nu` machen wir ma` `ne kleine Dienstbesprechung!“ Wir lenzen die Buddels und schnacken. Und zwar über alles Mögliche, aber nix Dienstliches. Mit dem war ein gutes Auskommen, das roch ich.
Dann ist da der Chief. Leiter des Maschinenbetriebes, gut über 60 Jahre alt und über alle Probleme dieser Welt erhaben. Die Ruhe in Person. „Ich seh` die Rente schon an der Kimm, was soll mich noch jucken?“ ist eines seiner Lieblings-Bonmots.
Auf diesem Kahn haben sie keinen Storekeeper, sondern einen SBM. Steht für Schiffsbetriebsmeister, aber im Prinzip füllt er die Rolle des „Stories“ aus. Der stammt aus der Gegend von Stuttgart und stellte sich selbst als „Norbert, Edler von Schwaben“ vor. Selbsternannter Landadel gewissermaßen. Ja, und irgendwie ergibt sich schon nach kurzer Zeit, dass dieser Personenkreis, also der Alte, der Chief, der SBM und meine Wenigkeit so alle zwei Tage mal zu `ner abendlichen Arbeitssitzung zusammentreffen. Bier auf der Back, und dann wird fröhlich drauf los gelabert. Jedes Thema erlaubt, nur nix dienstliches.
Der Alte ist ein Geschichtsexperte. Nicht Geschichten, sondern Geschichte. Südlich der Biskaya waren wir schon mit den Staufern durch, westlich Gibraltar beschäftigten wir uns mit den Hunnenfeldzügen, und jetzt sind gerade die Merowinger dran. Total verblüfft war ich, als ich ihm einmal von der alten, aus der Zeit der Karolinger stammenden Basilika erzählte, die sich in meinem Odenwälder Heimatort befindet. „Kenn ich!“, war die Antwort. Und dann schilderte er das Bauwerk so detailliert, als ob der den Bauplan gezeichnet hätte.
Das elende Gerolle endet mit dem Erreichen wärmerer Gewässer. Auf unserem Weg nach Süden passieren wir die Kanaren. An Backbord die Küste Marokkos. Später zur gleichen Seite Mauretanien. Ruhige See, Sonnenschein von „Sunrise“ bis „Sunset“. Und ich habe noch einen unschlagbaren Vorteil gegenüber der kompletten restlichen Crew. Direkt neben meiner Funkbude führt eine Tür aufs Palaverdeck und geradewegs zum Swimmingpool. Und auf diesem Schiff trägt der seinen Namen zu Recht, in dem Ding kann man schon ein paar Schwimmzüge machen, bevor man wieder am Beckenrand landet. Auf den Kühlschiffen hatten wir da eher so `ne Art modifiziertes Fußwaschbecken. Ich habe also ein Appartement mit Pool im Garten. Oder so ähnlich.
In der Nähe der Kanaren leiste ich mir einen eklatanten Verstoß gegen die Funkvorschriften. Und zwar mit Ansage. Gunter, einer meiner alten Kumpels zuhause, ist schon seit vielen Jahren als Funkamateur aktiv. Im letzten Urlaub nach einigen Bieren haben wir beschlossen, irgendwann mal einen Funkkontakt, ein so genanntes QSO, zwischen Schiff und Amateurfunkstelle zu fahren. Das ist verboten, Seefunkstellen dürfen nur in den für den Seefunk vorgesehenen Frequenzbereichen und nur mit am Seefunk beteiligten Stationen kommunizieren. Das Gleiche gilt sinngemäß für Amateurstationen. Unsere Empfänger sind aber durchstimmbar, ich verwende ein sonst nirgendwo verwendetes Phantasie-Rufzeichen und eine freie Arbeitsfrequenz im 16-MHz-Band. Gunter arbeitet im nahe liegenden Amateurband. Den Zeitpunkt kündige ich durch ein kurzes verschleiertesTelegramm via Norddeichradio an.
Und dann fetzen wir auf der Taste los, die Verständigung ist gut und in Gunters Radio-Shack hocken etliche meiner Spezis und folgen der Veranstaltung mit großen Augen. Vorschriften sind auch dazu da, dass man sie gelegentlich mal ignoriert. Oder?
Mauretanien haben wir gerade hinter uns gelassen, irgendwo hinter der Kimm ist der Senegal, da legt uns der Decksschlosser ein dickes Ei. Vielmehr legt er sich selbst eins. Es ist Sonntag, Teile der Decksgang sind zur Arbeit eingeteilt. Sind prima zuschlagspflichtige Überstunden und daher sehr beliebt. Man nennt das „Zutörnen“. Timmi, wie der Schlosser traditionell genannt wird, hat sich aber am Samstagabend gewaltig einen geballert. So richtig bis „Land unter“. Zur Arbeitseinteilung am Sonntagmorgen tritt er zwar an, kann allerdings kaum aus den Augen gucken. Sieht aus wie ein frisch gevögeltes Eichhörnchen. Tja, und dann ist er verschwunden. Irgendwann wird er aber vermisst, alle Mann suchen Timmi. Keine Spur von dem Typen, der ganze Dampfer wird abgegrast. No Timmi in sight. Die Fahndung geht weiter, völlig ergebnislos. Jetzt ist der Alte aber auf höchster Alarmstufe, alles deutet darauf hin, dass Timmi in seinem Suff über die Kante gegangen ist. Mann über Bord, so mit das Übelste, was einem Seemann zustoßen kann. Der Chiefmate kreuzt bei mir auf, in Kürze wird man wenden und mit der Suche beginnen. Und für mich heißt das, dass nun eine Dringlichkeitsmeldung zu senden ist. Auf der Not- und Anruffrequenz 500 kHz erfolgt dann ein Funkspruch etwa mit dem Inhalt: XXX XXX XXX DE DADY DADY DADY MV/PROPONTIS/ DADY REPORT MAN OVERBOARD BETWEEN POS ………… AND POS …….SHIPS IN VICINITY PLS KEEP SHARP LOOKOUT AND ASSIST IF POSSIBLE. Die vor dem Funkspruch gesendete Dreiergruppe XXX signalisiert höchste Dringlichkeitsstufe unterhalb eines SOS. Schiffe in der Umgebung würden sich der Suche anschließen, unter Umständen über einen längeren Zeitraum. Erst, wenn nach menschlichem Ermessen kein Überleben mehr möglich ist, würde man die Suchaktion abbrechen. Na bravo, jetzt war dicke Luft im Karton.
Ich schreibe schon mal den Meldungstext und werfe den Sender an. Die Positionen des Suchstreifens würde man mir gleich von der Brücke übermitteln, die kann ich dann noch einfügen. Sitze da und warte.
Draußen im Gang plötzlich Stimmengewirr. Entfernt höre ich: „Wir haben ihn!“ Ich raus aus der Station, Herbie läuft mir über den Weg. „Wo war der denn? – „Du glaubst das nicht. Seine Kammer haben wir schon zweimal kontrolliert, und eben guckt der Alte selbst noch mal rein, da kommt unter der Koje ein Arm vor. Der Blödmann hat sich zum Pennen einfach verpisst und damit ihn keiner stört, unter die Koje gelegt!“ Wir sind alle stocksauer auf Timmi, aber auch verdammt froh. Timmi hat danach ein verflucht unangenehmes Vieraugengespräch mit dem Alten. Der Alte ist sonst ein absolut ruhiger Vertreter, aber jetzt hört man ihn über zwei Decks, trotz geschlossener Office-Tür. Timmi bekommt eine detaillierte Aufrechnung präsentiert, was ihn ein Wendemanöver mit anschließender stunden- oder auch tagelanger Suche gekostet hätte. Ölverbrauch, Charterausfall etc, etc. Da ist der komplette Dampfer in Aufruhr, und dann kriecht dieser Döspaddel unter der Koje hervor. Erleichtert zerknülle ich die vorbereitete Dringlichkeitsmeldung und schmeiße sie in den Papierkorb.
Timmi backt in den folgenden Tagen dann sehr kleine Brötchen, der ist zunächst mal der unauffälligste Mitarbeiter an Bord. Aber der Alte gebärdet sich nicht nachtragend, und schnell wächst Gras über die Sache. Im Übrigen hat Timmi auf dieser Reise die Funktion des Bordhund-Beauftragten übernommen, Jackie hat in seiner Kammer Asyl gefunden und wird von ihm umsorgt.
Tiere an Bord waren nicht unproblematisch, viele Kapitäne lehnten es strikt ab, irgendein „Maskottchen“ an Bord zu nehmen. Meist handelte es sich ja um Hunde, die einem Janmaaten beim Landgang zugelaufen waren und dann aus einer sentimentalen Tierliebe heraus an Bord geschleppt wurden. Bei den Besatzungen erfreute sich das Vieh dann großer Beliebtheit und wurde verhätschelt und verwöhnt. Trotzdem war die Sache umstritten, eine artgerechte Haltung war das für die Köter nun einmal nicht, der Hund war nur auf Kunststoffböden und an Deck auf Eisenplatten unterwegs, bekam die Essensreste der Crew und war mit ständig wechselnden Bezugspersonen konfrontiert. In einigen Häfen reagierten die Behörden sehr kritisch auf Tiere, besonders die Briten mit ihrer pathologischen Angst vor Einschleppung der Tollwut verfügten in solchen Fällen strikte Auflagen.
Timmi mit Jackie, unserem Bordköter
Jackie, unser kofferallergischer Bordköter, hatte in Rotterdam zu allem Überfluss auch noch Konkurrenz bekommen. Kurz nach dem Auslaufen wurde die Anwesenheit einer Katze an Deck festgestellt. Die war wohl von einem der Binnenschiffe desertiert und über die Saugheber-Plattform an Bord gelangt. Und schon wird die Katze ebenfalls mit versorgt, fürsorgliche Maaten legen Futter an Deck aus und garantieren so ihr Überleben. Die erste Begegnung zwischen Hund und Katze verläuft sensationell. Ich stehe vormittags mit dem dritten Steuermann auf der Brücke und schaue über das endlose Deck vor uns, da erspäht Jackie, die gerade längs der Steuerbordseite ihren Morgenspaziergang absolviert, das Katzenvieh. Jackie haut sofort Vollgas rein und hetzt hinter der Katze her. Steuerbord zum Vorschiff und Backbord wieder zurück. Dann zwischen den Luken durch, eine Verfolgungsjagd wie im Trickfilm. Schließlich flüchtet sich die Katze unter das kleine Arbeitsboot, das in Kopflage an Deck fixiert ist, ein kleiner Kahn, der für gelegentliche Arbeiten an der Wasserlinie verwendet wird. Die Katze passt mal gerade so durch den kleinen Spalt zwischen Decksplatten und Bootsrand, Jackie nicht. Der blöde Köter versucht aber trotzdem, sich da rein zu zwängen, und das war ein Fehler. Während dieses Manövers war Jackie ziemlich hilflos, und unter dem Boot, wir können es nur vermuten, holt die Katze mörderisch aus und haut Jackie die Krallen auf die Schnauze. Wir schließen das aus der Art und Weise, wie der Hund beide Hinterbeine in die Luft wirft und dann völlig verstört einen Rückzieher macht. Von diesem Tag an begegnet unser Hund der Katze äußerst hochachtungsvoll. Kommt ihm bei seinen Spaziergängen das Katzenvieh entgegen, wechselt er die Schiffsseite.
Ankunft auf der Reede von Lower Buchanan. Zum ersten Mal bin ich nun in „Afrikiki“, wie die Gegend im Seemannsjargon genannt wird. Verlässt man das klimatisierte Deckshaus, läuft man umgehend gegen eine Mauer. Dort draußen steht ein Hecht, dass einem zunächst die Luft weg bleibt. Feuchtschwüle Hitze, die Sonne knallt vom Firmament wie `ne verdammte Laserkanone.
Der Begriff „Schwitzen“ kriegt `ne ganz neue Bedeutung, ich bilde mir förmlich ein, kleine Fontänen auf meinen Poren wahr zu nehmen. Also zunächst mal wieder rein in die Aufbauten, der Herr segne den Erfinder der „Air-Condition“!
Das ist also die Küste Liberias. Ein Land mit gewissen Besonderheiten, Kolonie waren die nie. Der Staat wurde schon im 19. Jahrhundert gegründet, im Rahmen eines Rückführungsprogrammes ehemaliger Sklaven aus den USA. Deshalb ist Liberia reichlich amerikanisiert, der Dollar fungiert als Parallelwährung, und selbst die Flagge ist dem Sternenbanner irgendwie nachempfunden. Dieser merkwürdigen Staatsgründung lag die Idee zugrunde, hier an der Küste eine Art „Little black United States“ zu erschaffen. Ist aber nicht so richtig gelungen, inzwischen ist das Land genauso ein korrupter Saustall wie viele Länder in dieser Gegend. Leider.
Am Ufer ist die Erzpier zu erkennen, riesige rotbraune Halden türmen sich auf, eine aufwendig konstruierte Verladeanlage direkt am Kai, dahinter endlose Laufbänder zur Heranführung des Eisenerzes. Erst in einiger Entfernung die Küste runter sieht man durchs Glas eine menschliche Ansiedlung, sieht alles ziemlich bescheiden aus. Die Erzgruben, wo das begehrte Mineral abgebaut wird, befinden sich im Landesinneren. Sowohl die Gruben, die zum Transport gebaute Bahn als auch der Verladehafen gehören der schwedischen LAMCO-Corporation. Das Sagen haben aber die Liberianer, und das demonstrieren sie auch sehr überzeugend schon bei der Einklarierung.
Schon zwei Stunden nach der Ankunft drücken uns zwei Schlepper an die Pier, nach gut 11 Tagen wird es ruhig im Schiff, die Hauptmaschine schweigt. Als Funkoffizier gehört die Durchführung der Einklarierung, also der behördlichen Abfertigung bei Ankunft, zu meinen Obliegenheiten. Ich stehe in Khaki-Uniform an der Gangway, um die Hafen-Beamten zu empfangen und in den Salon zu geleiten. Schulterklappen mit den Streifen am Hemd, das ist hier wichtig, diese afrikanischen Beamten sind unglaublich authoritätsfixiert. Ohne Offiziersrang ist man Luft für die. Und dann klettert schon eine ganze Horde die Gangway hoch, einige in Uniform, andere in sehr traditionellen Batik-Hemden. Und siehe da, die schleppen die gleichen Taschenmodelle mit sich herum, die ihre „Kollegen“ in Südamerika so schätzen. Taschen, die man auf ein Vielfaches ihres ursprünglichen Volumens vergrößern kann, um die zusammengschnorrten „Präsente“ von Bord zu schleppen, die hier zu jeder Einklarierung zwingend dazu gehören.
Ich führe die Truppe in den Salon, dort sitzen bereits der Alte und der Chiefmate. Einer der Gilbie-Stewards ist standby, um die Getränkeversorgung sicherzustellen. Und schon geht die Post ab, wildes Palaver, wichtiges Getue. Ich werde Mannschaftslisten gleich im Dutzend los, jeder dieser Lurche muss irgendein Papier bekommen, sonst wäre er ja nicht wichtig. Ja, und die Präsente. „Captain, you got german beer? We like german beer very much!” Na klar, bitte sehr, steht doch auf dem Tisch. Nee, so war das nicht gemeint, die Herrschaften würden gerne ein Paar Kisten mitnehmen. Dazu noch `n Paar Whisky-Buddels, wenn`s recht ist. Und bitte die Zigaretten nicht vergessen, so `ne Stange Marlboro pro Nase, also das ist ja mal das Mindeste. Die Tragetaschen der Beamten schwellen mit fortdauernder Einklarierung deutlich an, unsere Hälse auch. Aber was will man machen, das ist Afrikiki…
So gute zwei Stunden dauert die Vorstellung, die fühlen sich hier sichtlich wohl. Wenigstens der Ladebetrieb leidet nicht darunter, draußen beginnen sie schon mit dem Schütten. Ein turmhoher Loader über einer Luke, und schon rinnt ein ununterbrochener Strom Eisenerz in die PROPONTIS. Der Agent spricht von 24 Stunden Liegezeit, also eine Nacht bleibt uns für die Town. Nicht gerade viel Zeit.
Schwer mit den Schätzen des Okzidents beladen
Die Beamten hauen ab, und zwar schwer mit den Schätzen des Okzidents beladen. Ich kann es mir nicht verkneifen, mal ein dezentes Foto aus dem Bulleye zu machen, wie sie ihre Beute von Bord schleppen. So, und nun ist Feierabend für den Sparks. Dollar-Vorschuss für die Crew habe ich auf See schon ausgezahlt, die Behördenabwicklung ist gelaufen, ich will an Land gehen.
Es ist Nachmittag, von den Kollegen hat noch keiner Zeit, mich zu begleiten. Fahre ich halt mal alleine los, die Liegezeit ist knapp bemessen. Am Ende der Pier, hinter dem Dampfer, ist so `n kleines Wachhäuschen. Und da stehen tatsächlich ein paar Taxen rum, alte Renaults. Geschäftstüchtig, die Jungs. Die wissen, dass da im Laufe der nächsten Stunden etliche Maaten in die Stadt wollen.
Ich greife mir einen der Fahrer, der knattert sofort mit mir los. Ich gebe als Ziel „Downtown“ an. Der grinst und antwortet: „The whole Town ist downtown!“ Auch gut, dann fahre mich halt „to the whole town“. Zwanzig Minuten später, nach wildem Geschaukel über eine trockene rote Lehmpiste, stehe ich mitten in einer afrikanischen Kleinstadt. Alles äußerst lebhaft, quirliger Verkehr, Autos, Mopeds, Fahrräder. Ich stolpere durch das Chaos und schwitze wie ein Schwein. Der Preis tropischer Landgänge. Viele schwarze Frauen sind überwiegend in langen, sehr bunten traditionellen Gewändern unterwegs. Einige befördern Lasten hoch erhobenen Hauptes, und zwar auf dem Haupte. So habe ich mir das immer vorgestellt.
Nach einigem Umhergestreune plagt mich der Durst. Ich kriege schon langsam Kopfschmerzen wegen der Hitze und dem Flüssigkeitsverlust. Vor mir ein Hotel, großer zweigeschossiger Steinbau, überdachte Terrasse mit riesigem Miefquirl an der Decke. Hier werde ich was trinken. Sitze kaum und habe soeben vom Kellner die georderte große Wasserbuddel mit viel Eis erhalten, da fällt mein wohlwollender Blick auf `ne schwarze Grazie zwei Tische weiter. Die guckt mich direkt an und zwinkert mir zu. Ich konstatiere, dass hier mehrere „black beautys“ solo an verschiedenen Tischen hocken. Ist das hier `ne Kontaktbörse der örtlichen Nuttengilde oder was? Egal, ich grinse freundlich zu dem zwinkernden Feger rüber… und schon hockt sie an meinem Tisch. Also ehrlich, ich hatte so was nicht beabsichtigt, als ich die Hotelterrasse betrat, aber nun ist es so gekommen.
Josephine heißt sie, ist nach eigenem Bekunden „twenny years old“ und überaus erfreut, mich kennen zu lernen. Sagt sie. Ich lade sie zu einem Drink ein. Bestellt die doch glatt ein Bier, und zwar in den hier üblichen Ein-Liter-Keulen. Elefantenbier, wie wir Seeleute es nennen.
Und dann haut die das Zeug runter wie Wasser, ich bin beeindruckt. Wir plaudern, es wird Abend. Ich bin nun ebenfalls vom erfrischenden Mineralwasser zu Elefantenbier übergegangen. Die schluckt immer noch fröhlich weiter, und zwar ohne erkennbare Trefferwirkung. Ich lade die Lady zum Essen ein, wir traben zunächst mal die Mainstreet runter, sie will mich zu einem recht schlichten kleinen Fressladen bugsieren. Gibt’s hier nix besseres? Doch, meint sie, da wäre ein „french restaurant“, das wäre aber „very expensiv“. Das ist mir scheißegal, erkläre ich, heute essen wir mal „very expensive“. Das Elefantenbier zeigt bei mir erste Wirkung.
Etwas widerstrebend präsentiert sie mir das französische Restaurant, ein Flachbau in einer Seitenstraße. Zunächst war ich skeptisch, ein französisches Restaurant hier in einer westafrikanischen Kleinstadt. Aber tatsächlich, irgendein Franzose hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vielgepriesene Küche seiner Heimat in Liberia zu präsentieren, mit den zahlreichen hier arbeitenden ausländischen Experten und der kleinen lokalen Oberschicht stand wohl ausreichend Gäste-Potential zur Verfügung.
Unser Erscheinen in dem Schuppen löst deutliches Befremden aus, und jetzt verstehe ich ihr Zögern. Das ist die vornehmste Futterbude von ganz Buchanan, da hockt die Haute Volaute drin. Und ein Seemann in verwaschener Khakihose, verschwitztem T-Shirt und Begleitung in Form einer gerade erst angeheuerten schwarzen Konkubine gehört nun mal erkennbar nicht zur Haute Volaute. Ich bin aber inzwischen in dem Stadium, wo mir das großflächig am Hintern vorbeigeht. Und beantrage bei dem livrierten Äffchen am Eingang lauthals einen „Table for two!“ Der guckt reichlich indigniert, aber nach kurzem Zögern schiebt der uns an einen etwas abseits gelegenen Tisch in Toilettennähe. Du arrogantes Arschloch, denke ich. Setze mich dann aber souverän über Alles hinweg und lasse das Äffchen samt Speisekarte antanzen. Die Kleine wirkt etwas eingeschüchtert, ich sehe dazu keine Veranlassung. Wir ordern im hochpreisigen Bereich der Karte, mich sticht nun wirklich der Hafer. Viele der Gäste sind weiße Paare, wohl das schwedische Personal der Erz-Mine. Wenn uns eine der weißen Ladys verstohlen mustert, grinse ich breit zurück. Dann gucken die peinlich berührt wo anders hin, ich fühle mich gut unterhalten. Das Essen kommt, es ist wirklich erste Sahne, der Preis aber auch. `Ne Flasche Wein haben wir nun auch noch intus, zusammen mit dem Elefantenbier ergibt sich daraus ein gepflegter kleiner Rausch. Auch Josephine wird nun leicht lallig, Gott sei Dank, ich habe schon befürchtet, dass die mich heute Nacht unter den Tisch säuft.
Später dann lotst sie mich zu dem Hotel zurück, wo sie mich aufgegabelt hatte. Unterwegs auf der belebten Straße rollt ein Taxi vorbei, ich werde erst aufmerksam, als lauthals einer brüllt: „Juhuu, Bernd, in Afrika ist Muttertag, jetzt werden wir ein Rohr verlegen…! Aus dem Seitenfenster hängt mit dem halben Oberkörper Norbert, der Edle von Schwaben. Neben ihm undeutlich im Auto auch `ne schwarze Schönheit. Ich bin sicher, dass die eine zentrale Rolle bei den „Rohrverlegearbeiten“ von Norbert spielen wird.
Am folgenden Morgen lässt es sich Josephine nicht nehmen, mich mit dem Taxi an die Pier zu begleiten. Abschiedsküsschen zwischen Erzhalden, diskret lasse ich ihr noch ein bisschen Haushaltsgeld da, die kann ja nicht täglich ins französische Restaurant gehen.
Unmittelbar vor dem Abschluss der Beladung latsche ich mal an Deck. Und stelle erstaunt fest, dass wir gar nicht ganz befüllt sind, da ist noch einiges an Luft bis an die Lukendeckel. Und dann erhalte ich vom Ersten einen kleinen Exkurs in Sachen Erztransport.
Natürlich sind bei Erzfahrt die Räume nicht bis zum Lukenrand befüllt. Wegen der hohen Dichte und dem spezifischen Gewicht dieser Ladung werden die Räume nie bis oben hin voll.
Deshalb sind überwiegend in der Erzfahrt eingesetzte Frachter (wie die frühere Seereederei „Frigga“ sie betrieb) so konstruiert, dass die gesamte Ladungsmasse nur in jeder zweiten Luke gefahren wird, dann ist der Ladungssschwerpunkt etwas höher und nebenbei entfallen noch die aufwendigen Reinigungsarbeiten in den nicht befüllten Luken. Dies war bei der PROPONTIS nicht der Fall. Hier waren die Räume nur teilbefüllt, obwohl das Schiff bis zur erlaubten Marke abgeladen war. Schüttkegel waren in Längsschiffrichtung generiert, Querschiffs muss die Erzladung eingeebnet sein, um ein Abbrechen der Kegel und die damit verbundene große Krängung auszuschließen.
Nachmittags sind wir wieder auf See.
Deck der PROPONTIS – Blick auf Brücke
Der Charterer verlangt „wirtschaftliche“ Geschwindigkeit. Beim Schiff verhält es sich genau so wie bei einem Auto, mit Vollgas verbrät man den meisten Sprit. Also müssen wir es gemütlich angehen lassen, wir laufen 12 Knoten. Bedeutet 15 Tage bis zum Löschhafen Philadelphia. 15 Tage Bordroutine, Wachdienst, Essen, nach Wachende ein wenig Teilnahme am überschaubaren Freizeitangebot. 15 Tage bei permanenter Vibration, das Schiff in ständiger wiegender Bewegung, die Zeit vergeht im Schneckengang. Oft stehe ich auf der Brücke und leiste dem wachhabenden Steuermann Gesellschaft. Wasser bis zum Horizont, so gut wie nie ist ein anderes Schiff zu sehen. Höhepunkte des Alltags sind die Mahlzeiten, man trifft sich in der Messe, klönt, haut das Essen runter und verschwindet wieder in der jeweiligen Arbeitsstation.
Der Koch spielt eine zentrale Rolle, handelt es sich um einen lausigen Frikadellenschmied, der seinen Job nicht beherrscht, ist die Stimmung sofort im Keller. Wir haben Glück, der Herr der Kochtöpfe und Pfannen ist ein Meister seines Fachs und etliche der Piepels plagen sich schon bald mit Gewichtsproblemen herum. Die an Bord verabreichten Kalorien entsprechen eigentlich dem Bedarf eines Schwerarbeiters, gut, das trifft wohl noch auf einige Jungs in der Maschine und auch im Decksbetrieb zu. Typen wie ich, die ihre Arbeit fast vollständig sitzend abwickeln, sollten schon mal den einen oder anderen Gang ausfallen lassen.
Meine letzte tägliche Funkwache endet um 20:00 Uhr. Die Tagesdienste haben dann schon lange Feierabend, in den Nachtstunden arbeiten nur die Wachhabenden auf der Brücke und in der Maschine. Und letztere auch nur eingeschränkt, die Antriebsanlage der PROPONTIS war für einen teilweise wachfreien Betrieb zugelassen.
Ein abendlicher Kneipenbesuch, wie bei Landratten üblich, liegt nicht im Bereich des Möglichen. Aber irgendwo ist immer mal `ne Party fällig. Mal auf der, mal auf jener Kammer trifft man sich mit ein paar Bordkollegen, schlabbert einige Bierchen und schnackt einen aus. Brettspiele kommen immer wieder mal zum Einsatz. Und auf der PROPONTIS wird ein wöchentlicher Preisskat zur festen Einrichtung.
Mit Skat konnte ich mich nie anfreunden, stundenlang konzentriert den Verlauf eines Kartenspiels zu verfolgen hat mich einfach nicht interessiert. Hier aber gibt `s kein Entrinnen, schon beim ersten Preisskat melden sich 14 Mann an, mit `nem 15. Spieler hätte man also 5 Tische bemannen können. Die Gilbertesen scheiden per se aus, die haben keinerlei Neigung zu diesem Spiel. „Sparks, du spielst mit, dann geht’s genau auf!“ – „Mann, ich kann doch gar kein Skat…!“ – „Schnauze, du lernst das, wir machen `nen Schnellkurs mit dir, und morgen Abend steigst du ein!“ Tja, so geschieht es dann auch. Der Chief, der Alte und der Edle von Schwaben unterziehen mich einem Intensivtraining, und als ich gerade mal die einfachste Zählweise der Karten begriffen habe, wird meine „Spielreife“ verkündet.
Schon am nächsten Abend sitze ich mit der Meute in der Messe und liefere ein chaotisches Gezocke ab, den mir zugeteilten Mitspielern klappt mehrfach der Kiefer runter. Macht viel mehr Spaß, wenn man keine Ahnung hat… Trotzdem (und ich habe es als Einziger bemerkt) kriege ich mit, dass Schweine-Willy beim Geben nach Strich und Faden bescheißt. Der jubelt sich jedes Mal beim Mischen und Austeilen die Buben unter, entsprechend gut schneidet er dann auch ab. Meine Beobachtung behalte ich aber für mich und feixe mir einen. Wenn’s die großen Skatexperten nicht schnallen, kann`s mir auch egal sein.
Weilte ich im Urlaub zu Hause, wurde ich immer wieder mal mit der Frage konfrontiert: „Wie hälst`n das aus? Wochenlang auf See, keine Abwechslung, keine kulturellen Angebote, kaum Unterhaltung, und vor allem – keine Weiber.“ – Ach ja? Wie habt denn ihr Junggesellen an Land damals gelebt? OK, Kneipenbesuche waren für euch möglich, aber in der Regel zogt ihr immer in dieselben Läden. Kulturelle Angebote? Wie oft wart ihr denn im Theater? Unterhaltung? Hatten wir genug, wenn auch in einem überschaubaren Personenkreis. Kino? Einen Projektor und ab und an wechselnde Leihfilme schleppten wir auch mit. Und Weiber? Na gut, falls ihr solo wart, habt ihr täglich welche gesehen, hattet aber noch lange keine im Bett. So what? Und was das betrifft, ließen `s die Maaten in den Häfen manchmal richtig krachen. Hemmungslos und mit Juchhu. Sooo viel schlechter als Landratten lebten wir auch nicht. Und in mancher Hinsicht sogar besser. Und nach jedem, im Durchschnitt sechs Monate dauerndem, Einsatz schlossen sich zwei bis drei Monate bezahlter Urlaub an. Es gab schlimmere Schicksale…
Im letzten Drittel der Überfahrt wird`s wacklig. Um uns herum ist das Wetter OK, aber weiter nördlich ziehen Frühjahrsstürme über den Teich. Deren Dünung lässt uns rollen, und zwar auf eine ekelhafte Art und Weise. Durch die Erzladung liegt unser Schwerpunkt verdammt tief, der Kahn bewegt sich wie ein Stehaufmännchen, mit schnellen und oft ruckartigen Bewegungen und kurzen Rollperioden. Unangenehm, aber es gibt sowieso kein Entrinnen, also setzt jeder eine gelassene Miene auf und wartet auf bessere Tage.
Bei längeren Seetörns reduziert sich manchmal das Gefühl für Raum und Zeit, die Tage, die Nächte, die Wachen, die Mahlzeiten, die Skat- und Bierrunden vergehen… und auf einmal sind wir vorm Zielhafen.
Zunächst ankern wir einen Tag lang. Dichter Nebel, wir werden von den Port-Authorities erst mal vertröstet. Am zweiten Tag kommt der Lotse an Bord, in langsamer Fahrt geht’s den Delaware River hoch zum Liegeplatz. Morgens um 04:30 Uhr sind wir an der Erzpier.
Es folgt die übliche Nummer beim Anlaufen US-amerikanischer Häfen. Eine Einklarierungsprozedur an der Grenze des Zumutbaren. Die komplette Besatzung defiliert am Immigration Officer vorbei, wird mit strenger Miene begutachtet und erhält erst nach eingehender Überprüfung mittels des mitgeführten Fahndungsbuches ein Landgangs-Permit ausgestellt. Ein weiterer Officer versiegelt die Provianträume, zuvor darf noch Proviant für die voraussichtliche Liegezeit entnommen werden. Wir nehmen das lästige Procedere gleichmütig hin, was bleibt uns auch sonst übrig.
Löschen der Erzladung
Unmittelbar danach bewegen sich große Kräne mit Greifern über den Luken, das afrikanische Eisenerz wandert an Land. Maximal zwei Tage sollen wir hier liegen.
Am späten Nachmittag verschwinde ich von Bord. US-Häfen gelten für deutsche Seeleute als Shopping-Paradiese, zu günstigen Preisen erwerben wir dort Jeans, sonstige Klamotten amerikanischen Stils sowie einiges Naschwerk, das nicht in der Bordkantine gefahren wird. Auch Musikkassetten und diverse Elektronikartikel erhält man hier günstiger als zu Hause.
Mit zwei Kollegen durchstreife ich ein Shoppingcenter und kehre später beladen wie ein mazedonischer Lastesel an Bord zurück.
Am Abend erneuter Landgang. Mit Norbert lande ich nach angemessener Taxifahrt in der Innenstadt, und gemeinsam schlendern wir ein wenig umher. Landen in einer Kneipe, die im hawaiianischem Stil dekoriert ist, Kellnerinnen in Baströcken und im Übrigen spärlicher Textilausstattung schleppen uns Getränke herbei und wir tickern uns gemächlich einen an. Das war’s dann aber auch, kurz nach Mitternacht landen wir wieder auf dem Dampfer, ein unvergesslicher Landgang sieht anders aus.
Morgens, nach dem Frühstück lungere ich mit Herbie in der Nähe der Gangway herum, da fährt ein Wagen vor und liefert Timmi ab. Am Steuer sitzt `ne Amerikanerin, Timmi hat wohl erfolgreich `ne Ami-Lady gekapert und wird nun nach einer bewegten Nacht von seinem dankbaren „Girl“ wieder an Bord gebracht. Also, genau genommen sind das zwei Ladys, gefangen im Körper von einer. Die ist gigantisch dick und füllt fast die ganze vordere Sitzbank aus, Timmi hat kaum noch Platz. Als sie ihn zum Abschied umarmt, verschwindet er eigentlich völlig in ihren Körperwölbungen. Dass wir Zeugen dieses Auftritts werden, ist ihm etwas peinlich, verlegen grinsend drückt er sich an uns vorbei und verschwindet in den Aufbauten. „Ja, ja“, meint Herbie, „wo die Liebe hinfällt…!“
Ich verbringe den Tag in meinem Funkraum, diverse Verwaltungsarbeiten stehen an. Und Bock auf einen weiteren Landgang habe ich kaum, so reizvoll sind die amerikanischen Hafenstädte hier an der Ostküste auch nicht. Unklar ist noch das Ziel der nächsten Reise. Bei Einlaufen war noch von einer Getreidereise ex Baltimore die Rede, aber das hat sich nicht bestätigt. Also heißt es wieder einmal `Abwarten und Tee trinken`. Und weil der normalgestrickte deutsche Seemann mit Tee nix am Hut hat, trinken wir mal ein Bierchen…
Am Abend kreuzt der Agent beim Alten auf, die beiden verschwinden im Office des „Reiseleiters“ und schnacken einen aus. Kaum ist der Agent verschwunden, lässt unser Kommandant die Katze aus dem Sack: Wir haben Order für Tubarao. Also wieder eine Erzreise. Der Hafen Tubarao liegt in Brasilien, unweit der Großstadt Vitoria im Bundesstaat Espirito Santo, und ist einer der größten Erz-Verladehäfen weltweit. Der Chiefmate war schon mal da und hat einige interessante Details auf Lager. Der Port wurde erst in den Sechziger Jahren eröffnet und verfügt über unglaubliche Kapazitäten, die sind dort allen Ernstes in der Lage, in der Kombination mehrerer „Loader“ 16.000 Tonnen pro Stunde ins Schiff zu schütten. Modernstes Lade-Equipment steht zur Verfügung. Dann wären wir ja in fünf Stunden beladen. Die 16.000 Tonnen sind allerdings `ne schöne Theorie, wie ich sogleich erfahre. Zeitgleich mit dem Laden müssen unsere Pumpen jede Menge Wasser aus den Ballasttanks drücken, sonst wird unser Zossen instabil. Und solche Pumpkapazitäten haben wir nicht, um mit dieser Schüttleistung Schritt halten zu können. Chiefmate meint, wir sollten uns mal auf 24 Stunden einstellen, darunter ginge gar nichts.
Der Großteil der Crew interessiert sich einen Scheiß für diese technischen Details. Kaum ist das Zauberwort „Brasilien“ im Umlauf, gerät der halbe Dampfer in Partylaune. Einige Maaten waren schon mal in einem brasilianischen Hafen, oder sie kennen einen, der einen kennt, der schon mal da war. Also, nach den übereinstimmenden Statements der Janmaaten gibt es in Brasi-Land die schärfsten Weiber, die härtesten Drinks, außerdem die schärfsten Weiber und die härtesten Drinks, ach ja, habe ich schon die scharfen Weiber und die harten Drinks erwähnt? Die beiden Begriffe werden in einer Endlosschleife immer wieder runtergebetet, dieses Land scheint nach Ansicht der Piepels hauptsächlich aus Freudenhäusern und ihnen angeschlossenen Schnaps-Destillen zu bestehen. Mit einer gewissen Erwartungshaltung sortiere ich mir schon mal meine Funkunterlagen für die bevorstehende Ballastreise in dieses angebliche Seemannsparadies…
Sechs Tage, 48 Stunden Funkwache und ein Skatturnier später. Philadelphia ist bereits jetzt im Nebel des Vergessens verschwunden, der Hafen war zu belanglos, um Stoff für Storys und Legenden zu produzieren. Und nun liegen wir vor Point a Pierre. Nie gehört? Macht nichts, kein Mensch muss sich diesen Port merken. Zumal es gar kein richtiger Hafen ist, sondern lediglich ein Bunker-Stützpunkt auf Trinidad. Wir übernehmen Schweröl und Diesel, unsere Maschine hat Durst wie ein Rudel Vollmatrosen und hier ist wieder mal eine Treibstoffübernahme fällig.
Ansteuerung Point a Pierre, Blick von der Brücke
Der Aufenthalt dauert nur Stunden, aber am Nachmittag wetze ich mal auf die Schnelle an Land, in dieser Bulkfahrt sollte man jede Gelegenheit nutzen. Timmi und der dritte Offizier sind auch dabei, gemeinsam schlendern wir durch das kleine Städtchen und schauen uns ein wenig um. Nichts Berauschendes, aber etwas karibisches Flair wird uns doch zuteil. Überwiegend negroide Bevölkerung, dazu die in der Karibik üblichen Mischungen aller Ethnien und Hautfarben. In den Bars dröhnen Calypsoklänge aus den Musikboxen. Oder der klirrende Sound der Steelbands. Aber zu wenig Zeit, um richtig ins pralle Leben einzutauchen. Früh sind wir wieder an Bord, am späten Nachmittag ist die PROPONTIS wieder auf See.
Bis zum Ladehafen Tubarao benötigen wir bei der Geschwindigkeitsvorgabe des Charterers neuneinhalb Tage. Inzwischen habe ich ein Telegramm aufgenommen, das uns den Löschhafen mitteilt, die Erzladung ist für Mobile bestimmt. Also wieder zurück in die USA, die Stadt liegt in Alabama, der Hafen hat sich weitgehend auf den Ex- und Import von Schüttgut spezialisiert.
Chiefmate und F. O. Schlörit
Die Mannschaft werkelt sich bei anhaltend guter Laune der brasilianischen Küste entgegen, nach all den jüngst gehörten Storys sind die Erwartungen recht hoch gesteckt. Angenehm ist überhaupt das Betriebsklima an Bord, fachlich und menschlich gute Piepels hat Laeisz hierher geschickt. Die Gilbertesen sind ebenfalls von der verträglichen Sorte, bisher ist keiner wegen postalkoholischer Verwirrungen auffällig geworden. Auf meinen Kühlschiffen machte ich da andere Erfahrungen, diese Südsee-Sailors sind eigentlich nette Kerle, aber mit Sprit in der Birne entwickeln die manchmal ausgesprochene Rambo-Allüren. Dann geht man denen besser aus dem Weg.
Aber wie auf jedem Dampfer gibt es auch hier ein armes Schwein, das mit der ganzen Situation nicht klarkommt, fachlich nicht sattelfest ist und dann noch zu allem Überfluss sein Heil im Alkohol sucht. Hier ist es der 2. Ing., der den unfreiwilligen Part des Schiffsclowns an sich gezogen hat. Nach anfänglicher Zurückhaltung äußert der Chief immer häufiger Zweifel an der Qualifikation seines nachgeordneten Kollegen. Und immer öfter fällt dieser durch leicht lallige Sprache und spirituosengeschwängerte Ausdünstung auf, wenn er einem mal über den Weg läuft. Bin gespannt, wie sich das entwickelt, lange schauen sich das der Chief und der Alte nicht mehr an.
An einem schon frühmorgens hitzegeschwängerten Tag machen wir an der Erzpier von Tubarao fest.
PROPONTIS an der Erzpier von Tubarao
Erzverladehäfen sehen weltweit gleich aus, zumindest gewinne ich nun diesen Eindruck. Wie schon in Lower Buchanan Halden auf der Pier, soweit das Auge reicht. Und gigantische Schüttanlagen. Riesige Förderbänder, die sich irgendwo im Hintergrund verlieren. Und vor allen schön weit weg von Allem, was das Seemannsherz begehrt. Zunächst mal bringt der Agent unfeine News rüber, die wollen tatsächlich schon abends mit Laden fertig sein, das Landgangsende wird auf 22:00 Uhr festgesetzt. Da wird Hein Seemann aber Gas geben müssen, wenn er die berühmten brasilianischen Damen beglücken und den vielgepriesenen Cachaca („Kaschasch“ ausgesprochen) in sich hineinschütten will. Landgänge unter Zeitdruck, so was schätzen wir besonders.
Die Einklarierung verläuft recht flott und problemlos, der Umfang der damit verbundenen „Präsent-Übergabe“ hält sich auch in Grenzen. Eigentlich untypisch in diesen Breitengraden. Es sieht ganz so aus, als ob hier ein maßgeblicher Vorgesetzter die übelsten Auswüchse der im Süden allgegenwärtigen Korruption mal etwas zurück stutzt.
Nach der Behördenabfertigung zahle ich noch die von den Piepels bestellten Cruzeiros aus, auch für den Seemann heißt es: „Ohne Moos nix los“. Durch die Planungen der Hafenverwaltung ist allerdings der Landgang für die Crew auf ein enges Zeitfenster geschrumpft. Die Schiffsleitung gewährt aber etwas früher „Ausscheiden“, also Arbeitsende, für die Tagesdienste. Damit beweist der Alte wieder einmal, dass er ein Herz für seine Leute hat.
Ich haue direkt nach dem Mittagessen ab, zu tun gibt’s für mich nichts mehr, eine Funkpresse habe ich bereits anhand einer Nachrichtensendung der deutschen Welle fabriziert, jetzt ist die Funkbude dicht. Zunächst mal stolpere ich fast `ne halbe Stunde zwischen den Eisenerzbergen herum, dann kann ich mir am Hafentor ein Taxi ergattern. Etwas schwierig gestaltet sich die Verständigung, mein in der Bananenfahrt angeeignetes Nutten-Spanisch ist nicht so wirksam, man schnackt portugiesisch hierzulande. Taxifahrer, die an Hafentoren warten, labern aber meistens irgendeinen englischen Kauderwelsch, der zur simpelsten Verständigung ausreicht. Das funktioniert weltweit so. Außerdem machte ich die Erfahrung, dass Taxipiloten, die nun einmal überhaupt nichts verstanden, den Seemann in aller Regel zum nächstbesten Puff fuhren, andere Fahrtziele konnten die sich kaum vorstellen. Manchmal war dann eine gesten- und wortreiche Freestyle-Kommunikation angesagt, um doch noch zum eigentlich gewünschten Ziel zu gelangen. Oder man fügte sich in sein Schicksal… und akzeptierte den Puff.
Ich bin aber jetzt nicht in koitaler Mission unterwegs, ich möchte mal eine kleine Sightseeing-Tour durch Vitoria unternehmen. So ein oder zwei Stunden habe ich dafür eingeplant, dann soll mich der Kutscher zurück zum Dampfer karren. Am späten Nachmittag wollen wir in geselliger Runde nochmals los, in der Nähe soll sich ein so genanntes „Campo“ befinden, irgendeine Ansiedlung mit Bars und dem Seemann wohl gesonnenen „Damens“. Unsere Zeit ist knapp bemessen, das wird wohl eine Vergnügungstour im Schnelldurchgang.
Im Schnelldurchgang läuft auch meine Tour durch Vitoria ab.
Mit dem Taxiheini habe ich einen Festpreis vereinbart, nun karrt der mich zu den „Hotspots“ seiner Heimatstadt. Eine schweißtreibende Aktion, der alte Toyota, der mich durch die Gegend schaukelt, ist nicht klimatisiert, draußen hat es 30 Grad bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit.
In der Altstadt von Vitoria
Die Stadt ist sehr quirlig, neue und alte Stadtviertel lösen sich einander ab. Hin und wieder veranlasse ich einen Stopp, um zu fotografieren. Dann hurtig zurück an Bord, das „Campo“ wartet. Dabei lerne ich noch, dass die Taxichauffeure problemlos bis an die Gangway fahren dürfen. Man kann sich auch `ne Karre direkt ans Schiff bestellen, die Ladearbeiter rufen bei Bedarf einen Wagen herbei. Den Fußmarsch durch die Erzhalden hätte ich mir schenken können.
Am späten Nachmittag startet die Operation „Hammerharte Drinks und rattenscharfe Weiber“.
Das herbeigerufene Taxi entpuppt sich als betagter VW-Käfer, made in Brazil. Wir hocken drin wie die Ölsardinen, Schweine-Willy, Timmi, der OA Hermann und meine Wenigkeit. Und der Fahrer natürlich. Das angegebene Ziel der Fahrt entlockt dem schon mal ein breites Grinsen, scheint ja was dran zu sein an dem schlüpfrigen Ruf dieses „Campo“. Zunächst schaukelt der uns über eine unmögliche Piste in die Walachei, fast `ne Stunde sind wir unterwegs. „Habt ihr den Tipp richtig verstanden, oder ist dieses Kaff vielleicht in Argentinien?“ nölt Timmi. Nein, dort ist das Kaff dann doch nicht, schließlich gelangen wir in ein kleines Nest, mehrere auch größere Flachbauten, teilweise aus Holz, teilweise Wellblechkonstruktionen. Auf den Gassen keine Sau, das Campo wirkt wie ausgestorben. An den Türen Bier-Reklame, Bar-Schilder. Wir schauen in den ersten Schuppen – leer. Der zweite sieht keinen Deut besser aus. Im nächsten Laden pennt so `ne ältere Madame hinterm Tresen, nach erfolgreicher Wiederbelebung kommt sie aber in die Hufe und fabriziert recht brauchbare Caipirinhas. Ein erster Lichtblick. Und dann erfahren wir, dass hier zwar täglich der Bär steppt. Aber nicht um diese Tageszeit, die Damens sind alle nachtaktiv, und erst am späten Abend gehen hier die Lichter an. Dann kommt jede Menge Kundschaft aus Vitoria und den Nachbarstädten Cariacica, Serra und Vila Velhar. Notleidende Bulkiefahrer, die hier am Nachmittag aufkreuzen, haben die gar nicht auf dem Tippzettel.
Da hocken wir nun und gucken blöde aus der Wäsche. Den Fahrer haben wir für 20:30 Uhr bestellt, um ganz sicher vor Landgangsende an Bord zu sein. Um diese frühe Stunde sind die Damens zweifelsohne noch mit pudern und parfümieren beschäftigt und kommen für eine Betreuung von zur Unzeit angereisten Seeleuten nicht in Betracht. Shit.
Bleibt der Caipirinha. Und den ziehen wir nun mächtig rein, das Theken-Fossil kommt kaum mit dem Mixen hinterher. Damit erreichen wir, dass wenigstens Teil 1 der Operation „Hammerharte Drinks und rattenscharfe Weiber“ zu einer Erfolgsgeschichte wird.
Und später tauchen dann tatsächlich einige Fräuleins auf, die sind aber das Gegenteil von „rattenscharf“. Ziemlich junge und nicht allzu attraktive Dinger, die man wohl zwecks Ausbildung in die Frühschicht gesteckt hat. In der Mehrzahl haben wir uns bereits in ein desinteressiertes Stadium gezecht und reagieren gleichgültig. Ich vergnüge mich eine Zeit lang mit einem Schlagzeug, auf einer kleinen Bühne sind die Instrumente der am Abend auftretenden Band gelagert. Im ganzen Leben habe ich noch kein Schlagzeug gespielt, und so hört sich mein Geballer auch an. Funkern sagt man allgemein ein herausragendes Rythmusgefühl nach, nur so lasse sich die Tonfolge schnell gesendeter Signale mittels Morsetaste erzeugen. Jetzt beweise ich aber überzeugend, dass man auch ohne jedes Rythmusgefühl der Funkerei anheim fallen kann. Schließlich ertragen die Kollegen den Lärm nicht mehr und ich werde von der Bühne genötigt. Beziehungsweise mittels Caipirinha wieder an den Tisch gelockt.
Der Taxifahrer ist tatsächlich fast pünktlich. Das bedeutet in Lateinamerika, dass er wenigstens am vereinbarten Datum erscheint, die Uhrzeit wird eher großzügig gehandhabt. Jetzt wird’s jedenfalls knapp, um 22:00 Uhr haben wir an Bord zu sein. Kommen wir zu spät und das Auslaufen verzögert sich deshalb, gibt’s jede Menge Ärger. Falls es dem Alten nicht gelingt, die Ursache der Verzögerung zu vertuschen, geht der Dampfer „off hire“. Dann wird für den betreffenden Zeitraum keine Charter gezahlt, auch weitere Kompensationsforderungen seitens des Charterers sind möglich. Die Zeit drängt, wir verpflichten den Taxi-Dödel zu einer Highspeed-Aktion. Der legt auch ganz heftig los, auf der löchrigen Piste haut`s uns fast durchs Autodach. Und plötzlich fängt der Käfer an, wie wild herum zu eiern. Plattfuß. Verdammte Scheiße noch mal, uns läuft die Zeit weg. Jetzt stellt sich raus, dass der Kutscher zwar `nen Ersatzreifen, aber keinen Wagenheber hat. Also spielen wir Wagenheber, wuchten mit vereinten Kräften die Karre hoch, und der Brasi-Driver versucht, sein Ersatzrad auf die wild schwankende Trommel zu wuchten. Irgendwie wird die Kiste immer schwerer, was ist denn da los, verdammt? Wir stellen fest, dass Schweine-Willy nicht mithebt, sondern achtern auf der Stoßstange sitzt und sich somit auch von uns anheben lässt. Der ist breit wie ein Stachelrochen und kriegt absolut nix mehr mit. Hermann pflückt den besoffenen Scheich von der Stoßstange, und jetzt lässt sich der Käfer wieder leichter handhaben. Endlich gelingt der Reifenwechsel, wir zwängen uns wieder in das Vehikel, und weiter geht’s im freien Tiefflug nach Tubarao. Punkt 22:00 Uhr purzeln wir an der Gangway aus dem Wagen, gerade noch geschafft. Der Dampfer ist voll beladen und „ready to go“.
Der Alte ist sichtlich erleichtert, als wir aufkreuzen. Wenn mal ein Matrose oder Schmierer oder Steward zu spät kommt, wird in aller Regel einfach ausgelaufen, die Agentur wird damit betraut, den Typen wieder einzufangen und nach Hause zu schaffen. Der Janmaat ist dann „achteraus gesegelt“, hat sich `ne Menge Ärger und Kosten eingehandelt und ist außerdem seinen Job los. Hier wären aber Funker, Bootsmann, Decksschlosser und OA abhanden gekommen. Ohne Funker auszulaufen ist schlichtweg verboten, und auch der Rest dieses illustren Haufens wäre für einen geordneten Schiffsbetrieb nur schwer verzichtbar gewesen. In diesen Zeiten ist nirgendwo ein überbesetzter Dampfer unterwegs, eher das Gegenteil trifft zu. Die Erleichterung beim Kapitän ist nachvollziehbar. Inzwischen hat er auch meine Arbeit erledigt, einige Maaten wollten Cruzeiros zurückzahlen, das ist eigentlich mein Job. Na gut, der Alte hat es für mich abgewickelt, während ich als angesoffener Wagenheber tätig war.
Am nächsten Morgen sind wir auf See. Später in der Nacht hatte ich die obligatorischen Auslauftelegramme gesendet, dann versank ich in tiefem, vom Caipirinha wirksam unterstützten, Schlaf.
Über 4.700 Seemeilen sind’s von Tubarao bis Mobile. 13 Knoten Geschwindigkeit hat man uns verordnet, das ergibt wieder einen Seetörn von knapp über 15 Tagen. Na dann…
Der Tag nach dem Auslaufen wird weitestgehend vom Erfahrungsaustausch der Landgänger bestimmt. Es stellt sich heraus, dass wir uns mit unsrem Ausflug ins „Campo“ hervorragend zum Deppen gemacht hatten. Während wir nach überlanger Taxireise in einer weitgehend weiberfreien Zone landeten, hatten etliche andere Janmaaten einige ganz brauchbare Bars in Stadtnähe entdeckt und dort auch ein paar heiße Stündchen genossen. Behaupten sie jedenfalls. Wir aber sind gar nicht so enttäuscht, auf jeden Fall haben wir gepflegt einen drauf gemacht.
Einige Tage später kann einer der Assis sogar nachweisen, dass er einen erfolgreichen Nachmittag in weiblicher Gesellschaft verbrachte. Der taucht verlegen grinsend bei Herbie auf und präsentiert einen Tripper, der sich gewaschen hat. Herbie, als zweiter Offizier auch für die medizinische Versorgung an Bord zuständig, findet das nur bedingt lustig, das hat ihn schon auf der PEKARI angeödet, immer wieder mal zur Schwanzkontrolle genötigt zu werden. Die Penicillinspritze setzt er bei dem Assi bewusst so rustikal ein, dass dessen Schmerzenslaute recht gut vor der geschlossenen Hospitaltür zu vernehmen sind.
Der gleiche Assi hatte noch nach dem Auslaufen heftig damit angegeben, dass ihn die Dame nichts gekostet habe, die ganze Nummer sei auf „Symphatico“ gelaufen.
Diese Geschichten hörte man auf allen Dampfern in der Südamerikafahrt. Regelfall ist und war, dass die Janmaaten in den Häfen die einschlägigen Bars aufsuchten und dort in Kontakt mit den reichlich anwesenden und oft auch recht attraktiven „Chicas“ gerieten. Die waren hübsch, lieb und nett, betreuten ihren Sailor über die ganze Liegezeit… und kassierten dafür harte Dollars, es waren halt hübsche, liebe und nette Nutten. Und immer wieder kehrte der eine oder andere Maat an Bord zurück und fabulierte von einer Senorita, die sich unsterblich in ihn verliebt hätte und dann den Nuttenlohn empört zurückgewiesen habe. Alles wegen „Symphatico“. Nun war ich als Funkoffizier auch Zahlmeister, die Vorschusszahlungen an die Crew waren Teil meines Jobs. Tja, und die ach so erfolgreichen „Symphatico-Vögler“ gehörten in aller Regel zu den „Vorschusskönigen“, den Jungs mit den höchsten Landgangskosten. Seltsam, oder?
Kaum auf See, stellen wir auch fest, dass die Katze verschwunden ist. Vom Landgang nicht zurückgekehrt. Achteraus gesegelt. Schweine-Willy hat dazu eine eigene Theorie: „ Die war bestimmt `n Kater. Und dann hat der von den scharfen Weibern in Brasilien gehört und ist getürmt!“ – „Aber hallo!“, erwidere ich „ und wenn der Kater dann so erfolgreich agiert hat wie wir gestern, hat der noch keine Brasi-Muschi gesehen, liegt aber mit einem Heiden-Caipirinha-Rausch hinter der nächsten Erzhalde!“
Die Reise nach Mobile verläuft in ewig gleicher Bordroutine. Tage und Nächte ziehen vorbei, die See ist vergleichsweise ruhig. Am 1. Mai stehe ich neben Herbie auf der Brücke. Nur die Wachgänger arbeiten, der Rest der Crew hat „Ausscheiden“. Wir schauen über die elend lange Decksfläche vor uns und hängen unseren Gedanken nach. Da wird an Steuerbord eine merkwürdige Prozession sichtbar.
Maitour an Deck
Eine kleine Schar Janmaaten zieht nach vorne zur Back, mittenmang der Bollerwagen, mit dem normalerweise Werkzeug und Wartungsmaterial über Deck bewegt wird. Dieses Mal transportiert der Bollerwagen aber Bier, und außerdem ist er mit einer mächtigen Nationalflagge dekoriert. Biertransport unter „Schwarz Rot Senf“.
Was is` dat denn?“ sage ich verblüfft. Herbie grient: „Die machen `ne Maitour. Da haben sie schon gestern den ganzen Tag von gelabert. Vorne auf der Back wollen sie dann feiern und anschließend wieder zurück eiern!“ Und so geschieht es dann auch. Die ganze Horde latscht Richtung Bug, lässt sich anschließend auf der Back zwischen den Ankerwinden nieder und zieht sich dort die mitgebrachten Hopfen-Kanülen rein. Gegen Abend nähert sich der Bollerwagen wieder den Aufbauten, Ende der Maitour 1978.
Kurz vor Erreichen des Zielhafens empfange ich ein längeres Funktelex von der Reederei.
Der Chartervertrag für die PROPONTIS endet vorzeitig, aber die Anschlussbeschäftigung des Schiffes ist bereits gesichert. Nach Beendigung der Erzreise gehen wir in einen längerfristigen Chartervertrag mit dem sowjetischen Staatsunternehmen Sovfracht Moskau. Unser Schlorren soll in der Getreidefahrt USA - Sowjetunion eingesetzt werden. Kalter Krieg hin oder her, amerikanische Farmer machen in jenen Jahren Milliardengeschäfte mit dem hohen Importbedarf der Sowjetunion. Und da es in der sowjetischen Handelsflotte an geeigneten Bulkcarriern für die Getreidetransporte mangelt, verdienen auch deutsche Reeder ganz prächtig an diesem Ost-West-Geschäft. Unser erster Auftrag steht schon fest. Laden sollen wir auf dem Mississippi, Löschhafen ist dann später Odessa.
Zunächst aber muss mal die Erzladung raus. Knappe zweieinhalb Tage liegen wir an der Pier in Mobile. Tag und Nacht krachen die Greifer der Hafenkräne in die Luken und hieven die rotbraunen Pellets an Land. Hier an der US-Golfküste ist es jetzt schon ziemlich heiß, feuchtwarmes Klima, gelegentliche Regenfälle. Abends streunen wir an der Küste herum, schauen mal in diese, mal in jene Bar. Am zweiten Tag unternehmen wir einen Ausflug in kleiner Besetzung. Der Alte, der Chief, Norbert und ich wollen mal ein wenig die Küste entlang fahren, just for fun.
Mit einem Mietwagen dödeln wir los, Norbert als Maschinen-Mann wird kurzerhand zum Fahrer bestimmt, zuständig für alles, was `nen Motor hat. Abends sind wir wieder an Bord, irgendwas Supertolles haben wir nicht gesehen, aber wir sind mal ein paar Stündchen ganz gemütlich über die Küstenstraße gerollt. Easy Cruising.
Zweimal pennen und wir verlassen Mobile, kurz nach dem Auslaufen aus der Mobile Bay morse ich die ETA`s für den nächsten Port in den Äther. Wir sollen New Orleans ansteuern, weitere Order folgt. Ein ausführlicheres Telex der US-Agentur offenbart später folgende Lage: Am Mississippi stehen drei große Verladeanlagen für Getreide zur Verfügung. Vielmehr standen zur Verfügung. Eine davon hat sich unlängst aufgrund einer Staubexplosion in ihre Einzelteile zerlegt, es gab Tote und erheblichen Sachschaden. Die verbliebenen zwei Stationen müssen nun das komplette Ladegeschäft auf dem Ol` Man River alleine bewältigen, es gibt bereits einen erheblichen Rückstau an wartenden Frachtern. Die Sowjets haben `ne ganze Menge Bulkies auf dem Markt zusammengechartert, jetzt wartet ein Gutteil dieser Flotte auf dem River aufs Beladen. Wir sollen uns mal auf drei Wochen Wartezeit einstellen. Na prima, das wird ja `ne schöne Gammelei werden.
Zunächst ist Großreinemachen angesagt. Wenn der Dampfer dem neuen Charterer angedient wird, müssen die Räume sauber sein. Inspektoren des „US-Department of Agriculture“ werden uns penibel kontrollieren, bevor sie das Schiff für Getreidetransporte freigeben. Von Mobile bis New Orleans ist es ein Katzensprung, trotz langsamster Fahrt liegen wir in eineinhalb Tagen vor der Stadt. Schweine-Willy und seine Deckscrew toben Tag und Nacht durch die Räume, um den Erzstaub raus zu kriegen. Tonnenweise Wasser wird zum Ausspritzen der Laderäume durch die Schläuche gejagt. Eigentlich ist es kaum zu schaffen, die Inspektion soll schon kurz nach Einlaufen stattfinden, obwohl die Beladung erst Wochen später möglich ist.