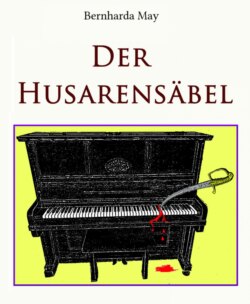Читать книгу Der Husarensäbel - Bernharda May - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
Margit war anderntags ziemlich aufgeregt, denn die Vorfreude auf den Fernsehnachmittag bei Gooths machte sie regelrecht zappelig. Daher hielt ich es für ratsam, sie in die Stadt zu begleiten, wo sie zunächst die Karten für das Puppentheater kaufen und anschließend den hiesigen Frisör aufsuchen wollte.
Tickets für die Heraklesvorstellung wurden nicht im Gasthaus selbst, sondern im Rathaus verkauft, wo es ein winziges Tourismus-Schrägstrich-Reisebüro gab. Der Begriff »Rathaus« sollte dabei von Ihnen, werte Leserschaft, nur mit Vorsicht genossen werden, denn das Gebäude war ein schlichter Backsteinbau, gerade mal zwei Stockwerke hoch, aber immerhin mit Ost- und Westflügel ausgestattet. Weil die Büros der Stadtverwaltung und des Bürgermeisters die Räumlichkeiten nicht gänzlich füllen konnten, befand sich darin auch besagte Tourismus-Info. Ehe Margit die Eintrittskarten kaufen konnte, musste sie warten, bis Oliver, der heute dort Dienst hatte, mit seinem Telefongespräch fertig war.
»Ja, Frau Appelhoff, zwei Karten für die Abendvorstellung«, sprach er in die Hörmuschel (es handelte sich um ein uraltes Telefon mit Wählscheibe), und während seine Stimme freundlich und geduldig blieb, verriet uns sein Augenrollen, dass seine Gesprächspartnerin nicht so schnell abzuwimmeln war, wie er es gerne hätte. »Auf den Namen Appelhoff und Friedrichson, verstehe. Ja. Sie haben recht, man muss die Kleinkunst unterstützen, wo man nur kann. Aber selbstverständlich. Danke, Frau Appelhoff. Ja, Frau Appelhoff. Auf Wiederhören, Frau Appelhoff. Grüße an Frau Friedrichson!«
Endlich legte er auf und atmete tief durch.
»Anstrengende Dame, nicht wahr?«, grinste ich wissend. »Meine Schwiegertochter hier will mir das kaum glauben.«
»Wie das Frauke aushält, den lieben langen Tag«, wunderte sich Oliver, ließ den Gedanken jedoch zügig fallen und wandte sich an Margit. »Womit kann ich helfen?«
»Zwei Karten für die Puppenvorstellung«, antwortete Margit. »Die Abendvorstellung morgen.«
Oliver reichte ihr zwei Tickets und kassierte das Geld. Schon wollten wir seine Touri-Info wieder verlassen, als wir auf Doris Kroogmann trafen, eine Kollegin von Margit und stadtbekanntes Tratschweib.
»Na, bucht ihr schon den nächsten Urlaub?«, grüßte sie uns. »Ich kann ja leider nicht wech, wegen Muddi, du weißt ja. Kümmert sich sonst keiner um sie. Immerhin ist sie zurzeit gesund und mit dem neuen Fernseher kommt sie auch zurecht. Wat’n Glück, wo ja heute die große Schau drin läuft! Habt ihr sicher schon von gehört, nicht wahr?«
»Du redest von Gooths TV-Auftritt?«
»Genau. Muddi kriegt sich kaum ein. Das ist ja ihre Lieblingssendung, von wegen dem Cornelius van Dijk!«
Margit und ich gaben zu verstehen, dass uns der Name nichts sagte.
»Das ist der Moderator von der Sendung! Holländer, sehr charmant. Muddi ist hin und wech von ihm. Immer wenn seine Sendung kommt, deckt sie den Kaffeetisch für ihn mit – extra Teller, extra Tasse, extra Kuchengabel – und tut so, als sei er persönlich bei ihr zu Gast. Niedlich, nicht wahr?«
Ich fand das Verhalten von Doris’ Mutter eher verstörend. Noch verstörender schien mir, wie Doris selbst diesen Hilfeschrei einer einsamen alten Dame nach Gesellschaft nicht als solchen erkennen konnte. Aber ich behielt meine Ansichten lieber für mich.
»Wirst du die heutige Sendung mit deiner Mutter zusammen schauen?«, wollte Margit wissen. »Martin, Michael und ich sind ja zu Gooths persönlich eingeladen.«
Doris setzte ein falsches Lächeln auf.
»Ah, dann gehört ihr zum auserwählten Kreis?«, erwiderte sie in süffisantem Ton. »Die halbe Stadt rätselt schon, wer alles beim Bürgermeister eine Audienz erhält. Wenn du mich fragst, Margit, ist das purer Snobismus, und zwar von Griselda ihrer Seite aus. Ist sich zu schade, einfach mit ihrem Mann im Gasthof aufzukreuzen, und zieht eine Privatvorführung vor.«
Sie neigte den Kopf etwas zur Seite und konnte sich wohl nicht verkneifen, trotz ihrer Empörung die folgende Frage zu stellen:
»Wisst ihr denn, wer noch alles zu Gooths kommt?«
»Soweit ich weiß, jemand von der Lokalpresse«, antwortete Margit. »Wahrscheinlich Alexander Zimmermann.«
»Eduard hat auch Frauke Friedrichson und Doktor Woszack erwähnt«, fügte ich hinzu und war neugierig, wie das Tratschweib auf die Information reagieren würde.
»Ach, die Frauke auch?«, staunte Doris. »Was weiß die schon vom Fernsehen? Da hätte der werte Herr Bürgermeister besser meine Muddi einladen sollen. Die ist immerhin ein Fan der Sendung und weiß alles, wirklich alles über Cornelius van Dijk! Und was die Frau Doktor angeht, nun ja. Jemanden von außerhalb würde ich nicht zu mir einladen. Noch dazu bei dem Namen. Ist bestimmt keine Deutsche. Klingt polnisch, meint ihr nicht?«
Die fremdenfeindlichen Ansichten der Kroogmanns waren stadtweit bekannt. Doris duldete zwar, dass ihre »Muddi« einen niederländischen Moderator verehrte, aber bei einer Ärztin mit slawisch klingendem Nachnamen hörte die Toleranz auf. Margit und ich gingen nicht darauf ein, um uns den Tag nicht zu verderben. Da begann Doris zu kichern und Margit wollte wissen, was los sei.
»Ach, ich muss nur an die Kowalski denken«, erwiderte sie. »Die putzt doch bei den Gooths zweimal die Woche. Jetzt kriegt sie endlich richtig was zu tun, dat fule Ding!«
»Wir haben nicht den Eindruck, dass Nina faul ist«, verteidigte Margit die Haushaltshilfe. »Griselda hat nie abfällig von ihr gesprochen.«
»Mag sein, aber ich weiß es besser«, beharrte Doris. »Ich hatte ihr mal angeboten, bei Muddi das Putzen zu übernehmen. Bodenwischen und Wäsche erledigen, darauf konnten wir uns einigen. Aber Fensterputzen sei ihr zu anstrengend, meinte die Kowalski, und zum Bügeln hätte sie dann doch keine Zeit. Wie eine professionelle Reinigungskraft klingt dat ja nicht, finde ich. Da kann ich das gleich alleine machen.«
»Sie muss sich ja um ihre drei Kinder kümmern und hat den eigenen Haushalt noch dazu«, wandte Margit ein.
»Pah«, machte Doris. »Faul ist sie, das glaub mir man. Ich weiß dat. Immerhin bin ich mit ihrem Mann zehn Jahre zur Schule gegangen, nicht du. Und Johannes hat damals beim ersten Klassentreffen – nein, beim zweiten, glaube ich – jedenfalls, als er sich mit ihr verlobt hatte und sie in unsere Stadt anschleppte, hat er noch groß geprahlt, was für eine kluge und gescheite Frau die Nina sei. Schulabschluss mit einer Eins vorm Komma und so weiter. Und nun ist sie ja doch bloß Hausfrau und putzt nebenher. Ich nenne das faul.«
Das klang wie ein Schlusswort und war auch so gemeint, denn abrupt drehte sich Doris um und stellte sich bei Oliver an, um sich ebenfalls ein Ticket fürs Puppentheater zu besorgen.
»Hast du gemerkt, dass sie nur eine einzige Eintrittskarte gekauft hat?«, flüsterte ich Margit vor dem Rathaus zu. »Ihre arme, einsame Muddi nimmt sie nicht mit.«
»Vielleicht hat Heidrun Mollenhauer kein Interesse daran«, versuchte Margit einzulenken, aber das ließ ich nicht gelten.
»Wer einem Fernsehabbild den Tisch deckt, um das Gefühl von Gesellschaft zu haben, der geht gewiss auch ins Puppentheater«, sagte ich im Brustton der Überzeugung. »Die Kroogmann ist nur zu geizig.«
»Jetzt fang du nicht auch noch an, wie ein Tratschweib zu lästern«, fuhr mir Margit ins Wort. »Oder ist das wieder dein Reporterblut, was da aus dir spricht?«
Ich fühlte mich ertappt und entschied mich, schweigend das Veranstaltungsposter der Puppenspieler zu studieren, welches an die Glastür des Tourismusbüros geklebt worden war. Auf cremefarbenem Untergrund stand ganz oben in bunten Buchstaben »LATERNE«, der Name der Truppe, wobei das »T« wie einer Straßenlaterne mit zwei Leuchten rings und rechts glich. Von den anderen Buchstaben ging jeweils ein schwarzer, dünner Strich in die Mitte des Posters. Diese Striche fanden ihr Ende an den Hand- und Fußgelenken einer Marionette und sollten wohl deren Fäden darstellen. Rings um die Puppe waren Fotos diverser Aufführungen zu sehen, die ich zwar keinem mir bekannten Theaterstück zuordnen konnte, welche aber bewiesen, dass »Laterne« mehr als nur eine Marionettenbühne war. Auf einem Foto sah man die Puppenspieler mit Handpuppen agieren, auf einem anderen präsentierten sie ein Schattentheater.
»Ob Künstler in diesem Metier von jeher alle Facetten des Figurentheaters beherrschen müssen?«, fragte ich mich. »Oder haben sich die Leute von ›Laterne‹ bewusst dafür entschieden, sich auf keine spezielle Form zu reduzieren, um abwechslungsreicher zu wirken als die Konkurrenz?«
Das wäre eine gute Frage für ein Interview gewesen und ich hoffte, mein Nachfolger Alexander Zimmermann würde sie den Künstlern stellen – wenn im Regionalblatt überhaupt ein Bericht über die Aufführung vorgesehen war.
Das Poster schloss unten mit dem Leitspruch »Modernes Puppentheater für Klein und Groß« sowie den notwendigen Kontaktdaten der Truppe. Außerdem waren Städte aufgezählt, die wahrscheinlich den Tourneeplan repräsentieren sollten.
»Potsdam, Magdeburg, Halle/Saale, Hof, Regensburg, Wien«, las ich. »Die kommen ganz schön herum!«
Kaum hatte ich das festgestellt, merkte ich, wie sich ein fremder Arm unter meinem einhakte. Es war Margit, die mich schnappte und weitergehen wollte, ehe ihre Kollegin aus dem Rathaus kam und uns ein zweites unangenehmes Gespräch aufdrängen konnte.
Wir liefen zügig zum Friseursalon und die negative Stimmung, die ein Treffen mit Doris Kroogmann mit sich brachte, war beinahe vergessen. Doch dann wurden wir mit der Tatsache konfrontiert, dass in der Tür des Salons ein Schild hing mit der Aufschrift:
»Wegen Krankheitsfall bis auf Weiteres geschlossen.«
In die nächste Stadt zu fahren, wo im Einkaufszentrum gleich mehrere Haarstylisten zu finden waren, kam nicht infrage, denn dann wären wir nicht mehr pünktlich bei den Gooths eingetroffen. Margit behalf sich mit etwas Spray und einem Damenhut und machte das Beste aus ihrem Zustand, ehe wir zu dritt vor der mächtigen Haustür der Bürgermeistervilla standen und klingelten. Wie wir feststellen konnten, hatte Griselda ihre Frau Kowalski offensichtlich mit Erfolg »gescheucht«.
»Die Fenster sind geputzt und sogar der Türknauf glänzt«, bemerkte meine aufmerksame Schwiegertochter anerkennend. »Gar nicht so leicht, das alles bei dem Sommerstaub in der Luft hinzukriegen. Doris hat wie immer übertrieben, als sie Nina Faulheit vorwarf. Bestimmt hätte Fensterputzen mehr gekostet und sie war zu geizig.«
Warum Margit derart lästern durfte, ich aber nicht, wagte ich nicht zu hinterfragen. Die Tür öffnete sich.
»So schön, dass ihr kommen konntet«, begrüßte uns Griselda und ihre Wangen leuchteten rot. »Die Sendung wird in dreißig Minuten losgehen. Margit, du hast ja deinen Jungen mitgebracht. So hochgewachsen! Sie studieren Medizin, nicht wahr? Ihr Vater wäre stolz auf Sie gewesen. Haben Sie schon eine Richtung im Kopf? Internist? Chirurg?«
Michael verneinte schüchtern.
»Kommt nur herein, es gibt für jeden einen selbstgemachten Fruchtcocktail. Die Mädchen werden euch versorgen. Zwei Schülerinnen. Beyza und Melike, heißen sie – glaube ich jedenfalls. Namen aus dem Nahen Osten sind in dieser Gegend immer noch sehr ungewohnt, nicht wahr?«
Hektisch verließ uns Griselda, während zwei junge Mädchen mit schwarzem Haar, dunklem Teint und weißen Blusen durch die Diele in die Küche flitzten. Sie riefen einander etwas zu, was wohl Türkisch sein mochte, und lachten.
»Die eine kenne ich vom Bioladen«, sagte Margit. »Dort hilft sie an den Wochenenden aus. Bestimmt wohnen die zwei in der Siedlung. Lieb von Griselda, ihnen hier die Möglichkeit zu geben, das Taschengeld aufzubessern, nicht?«
Wir legten ab, betraten das Wohnzimmer, wo die anderen Gäste versammelt waren, und bekamen von den engagierten Kellnerinnen jeweils ein Glas mit orange-rotem Fruchtcocktail inklusive Schirmchen in die Hand gedrückt. Eines der Mädchen – dem Namensschildchen nach zu urteilen handelte es sich um Melike – lächelte Michael scheu zu, der sogleich wegschaute und verlegen an seinem Glas nippte.
Das Wohnzimmer glich eher einem altmodischen Salon als einer normalen, gemütlichen Stube. An den Wänden hingen verschiedene Gemälde in schweren Rahmen. Das Mobiliar bestand zum großen Teil aus alten Biedermeierstücken, die sorgfältig restauriert worden waren und sich nun in einem guten Zustand befanden. Links neben den breiten Terrassenfenstern stand ein schwarzes Klavier, dessen Tasten ein schwerer Deckel verbarg. Wenn nicht der Großbildfernseher an der Wand gehangen hätte, würde man sich beinahe um einhundert bis zweihundert Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt gefühlt haben. Eduard Gooth trat auf uns zu und schüttelte freundlich unsere Hände.
»Martin, ich möchte Ihnen meinen langjährigen Freund Vincent Rosenthal und seine Frau Eleonore vorstellen«, sagte er und führte mich an den anderen vorbei zu einem kleinen Mann mit Halbglatze und grauem Kinnbart.
Ich hatte ihn schon öfter gesehen, wenn er bei den Gooths zu Besuch war, aber noch nie persönlich gesprochen.
»Es freut mich, Sie endlich kennenzulernen«, sagte ich, »nachdem ich schon viel von Ihnen gehört habe.«
»Danke sehr. Die Freude ist ganz auf meiner Seite.«
»Eduard hat öfter erwähnt, dass Sie sich während des Studiums getroffen haben. Und jetzt, wo Sie die Museumsdirektion unserer Landeshauptstadt übernehmen, liest man viele interessante Neuigkeiten aus der Kunstwelt.«
Vincent Rosenthal fühlte sich sichtlich geschmeichelt und scherzte:
»Dann spreche ich wohl mit einem der wenigen Leser von Feuilletons, haha! Ja, Eduard und ich kennen uns seit Jahren und unsere Geschäfte haben sich immer wieder gekreuzt. Seine Sammlung hier« – dabei schwenkte er seine Hand durch die Luft, als wolle er gleichzeitig sowohl auf die Möbel als auch auf die Bilder zeigen – »beherbergt zwar keine übermäßig kostbaren Überraschungen, zeugt aber von Stil und Wissen. Die Möbel gehören zu einem Ensemble, welches sich eine gewisse adlige Familie in Weimar 1823 speziell hat anfertigen lassen. Und unter den Bildern an der Wand gibt es zwei, die in ein paar Jahren möglicherweise doppelt so teuer sein werden wie jetzt.«
Es war offensichtlich, dass Rosenthal nicht ohne Grund einer der wichtigsten Museumsdirektoren des Landes war. Sein historisches und künstlerisches Wissen umfasste alle europäischen Epochen und Stile und er wusste, wie er seine Kenntnisse dezent und wirkungsvoll an seine Zuhörer weitergab, ohne aufdringlich zu wirken.
Seine Frau hingehen stand still und blass neben ihm. Ihr Gesicht erinnerte mich irgendwie an einen verängstigten kleinen Vogel, und während Rosenthal seinen Monolog hielt, fragte ich mich, wie es für eine Frau wohl sein musste, mit einem renommierten Kunstkenner verheiratet zu sein.
Meine Schwiegertochter hatte sich inzwischen zu den Frauen aufs Sofa gesellt. Neben ihr saß, wie immer pure Gemütlichkeit ausstrahlend, Frauke Friedrichson, die Vorsitzende unseres Heimatkundemuseums und Tourismusbeauftragte des Ortes. Sie hatte ihre Freundin Frau Appelhoff dabei, die groß und hager neben ihr thronte, die Beine überschlagen, und ernsthaft auf Margit einredete.
»Sehen Sie in die Vitrine dort, da liegt der Säbel, den wir gleich im Fernsehen bestaunen dürfen. Ich habe Frauke bereits gesagt, dass er unbedingt ins Heimatkundemuseum gehört anstatt in einen Privatsalon. Wie würde er dein Museum aufwerten, Frauke, und denke doch an die Kinder. Man kriegt sie so selten in eine Ausstellung, aber eine Waffe dieser Art würde sie anlocken. Wir müssen mit dem Bürgermeister darüber sprechen. Unbedingt! Wenn wir die Lehrer eurer Grundschule auf unsere Seite ziehen, wird Herr Gooth gewiss einwilligen.«
Frauke und Margit nickten höflich und schauten zur Vitrine. Meine Augen folgten ihren Blicken. Hinter Glas lag der Husarensäbel, ein längliches Stück in einem goldenen, mit Ornamenten verzierten Schaft. Er war leicht gekrümmt und die Klinge glänzte im Blitzlicht, das Alexander Zimmermanns Fotoapparat erzeugte. Gooth hatte ihn herbestellt, damit er alles Wichtige über die Angelegenheit dokumentieren und damit die Öffentlichkeit zufriedenstellen konnte. Er war ein langer, dünner Kerl mit hohlen Wangen und schütterem Haar. Aus seinen Augen jedoch blitzte es gescheit – so leicht würde ihm nichts entgehen.
In der Ecke neben dem Sofa, nahe der Terrassentür, standen der Schuldirektor, seine Gattin sowie Thomas Neef, ein Versicherungskaufmann. Sie schienen in ein ernstes Gespräch vertieft zu sein und ich hoffte für den Direktor, dass die Witwe Appelhoff ihn nicht erkennen und gegen seinen Willen in ihre Pläne fürs Heimatmuseum einspannen würde.
Angesichts der illustren Runde hallten plötzlich die Worte Frau Kroogmanns in meinem Kopfe nach und ich überlegte, ob an ihrem Vorwurf nicht doch etwas Wahres dran sein könnte und dies hier eine recht snobistische Veranstaltung war.
Der letzte Gast erschien. Es war Dr. Woszack, die neue Ärztin. Griselda führte sie zum Sofa und die Witwe Appelhoff verwickelte sie sogleich in ein Gespräch.
»Sie pflichten mir doch vom psychologisch-medizinischen Standpunkt aus bei, Dr. Woszack, dass man Kinder vermehrt für die heimatlichen Ausstellungen interessieren muss. Man darf sie nicht vor dem Computer versauern lassen und sich zu sehr auf die Schulen verlassen. Mit den richtigen Mitteln kann Frauke ihnen einen Grundstock für die Freude an Bildung geben!«
Dr. Woszack blieb unbeeindruckt und fragte nur:
»Sie sind hier auf Besuch?«
»Ja«, mischte sich Frauke ein, »ich habe Lotte eingeladen, weil sie so gute Kenntnisse und Kontakte hat. Wir wollen über eine geeignete Museumspädagogik bezüglich unseres Heimatmuseums sprechen.«
»Und die Neuigkeit hinsichtlich des Husarensäbels haben Sie beide offenbar in ihr Vorhaben integriert?«, stellte Dr. Woszack fest.
Frauke und ihre Freundin lachten verlegen. Sie fühlten sich etwas ertappt.
»Wir werden das gemeinsam angehen«, bemerkte die Witwe siegessicher und drückte gutmütig die Hand ihrer Freundin.
»Sie beide sind wohl schon lange gute Bekannte?«, fragte Dr. Woszack.
»Oh ja, wir haben eine Zeit lang zusammen die Schule besucht und viele gemeinsame Projekte ins Leben gerufen«, antwortete Frauke. »Lotte und ich sind ein unschlagbares Team. Wir verstehen uns praktisch ohne Worte, nicht wahr?«
»Ganz genau«, stimmte die Witwe enthusiastisch zu.
Da anscheinend nur mir die Widersprüchlichkeit dieser Aussage auffiel, hielt ich ein Kichern zurück und nippte weiter an meinem Fruchtcocktail. Da bemerkte ich einen weiteren Gast, den ich vorher übersehen hatte. Griselda, die mir persönlich nachschenkte, weil die Mädchen in der Küche mit dem Mixen neuer Cocktails beschäftigt waren, bemerkte meine Überraschung und erklärte:
»Das ist Gerd, Eduards Bruder. Erinnerst du dich? Er ist überraschend zu Besuch gekommen.«
Das war tatsächlich eine Überraschung. Gerd hatte vor vielen Jahren unser Städtchen verlassen. Niemand wusste Näheres über seinen Verbleib und auch nichts darüber, wie er sein täglich Brot verdiente. Ich fragte mich zudem, ob er im Hause Gooth wirklich willkommen war. Griselda beachtete ihn jedenfalls kaum, während Eduard ihn stets aus den Augenwinkeln beobachtete. Als Gerd meiner gewahr wurde, trat er mit einem verschmitzten Lächeln auf mich zu.
»Der alte Herr Harbecke von gegenüber! Schön, Sie wiederzusehen. Erinnern Sie sich noch, wie Eduard und ich bei Ihnen Kirschen und Pflaumen klauen wollten?«
Ich entsann mich dunkel, wie die zwei Knaben am Ende zu feige waren, mit ihrer Beute abzuhauen, und stattdessen einen Tausch vorgeschlagen hatten: die Birnen und Äpfel aus ihrem Garten gegen meine Früchte.
»Es freut mich, dass du deine alte Heimat mal wieder besuchst«, sagte ich. »Ich muss zugeben, dass ich dich ohne Griseldas Hilfe nicht wiedererkannt hätte!«
»Eine solche Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen«, erwiderte Gerd. »Eigentlich bin ich nur auf der Durchreise, aber gestern schlug ich die Lokalpresse auf und ein Foto von Eduard und seiner Frau samt historischem Säbel prangte mir entgegen. Das weckte meine Neugier. Folglich kam ich her, um herauszufinden, was an dem Bericht über das wertvolle Erbstück dran ist.«
Gerd und ich kamen nicht dazu, uns noch weiter zu unterhalten, denn Griselda schlug ein Löffelchen gegen ihr Glas, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
»Werte Gäste, liebe Freunde! Ich freue mich, dass ihr alle zu uns gekommen seid. Ihr kennt den Anlass: Ich habe einen alten Säbel geerbt, der in der Familie meines Vaters schon lange von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Nachdem ich im Fernsehprogramm eine Sendung entdeckte, in der Fachmänner wertvolle Kunst von nutzlosem Krimskrams trennen, konnte ich nicht widerstehen und ging dorthin, um Näheres über unser Erbstück herauszufinden. Die neueste Folge geht heute zum ersten Mal on air, wie man so schön sagt, und ich hoffe, dass mein erster Fernsehauftritt gelungen ist!«
Sie lachte, aber man spürte ihre Aufregung. Wir versammelten uns vor dem Gerät, die Mädchen stellten Schalen mit Salzgebäck auf den Couchtisch und Eduard drückte auf die Fernbedienung.
»Lasst das private screening beginnen«, verkündete er.
Alexander Zimmermann stand abseits, den Fotoapparat um den Hals und Stift und Notizblock in der Hand. Man sah ihm seinen Stolz darüber an, offiziell zu dieser Runde zu gehören und wichtige Details aus erster Hand erfahren zu dürfen.
Das Programm begann behäbig mit einer Melodie aus dem Keyboard und der Vorstellung der drei Moderatoren – einer hübschen Dame, welche die Klienten vorstellte, sowie zweier älterer Herren, die für die Schätzung der jeweiligen Gegenstände zuständig waren. Einer davon war Professor, der andere ein erfahrener Antiquitätenhändler und niemand anders als der berüchtigte Cornelius van Dijk. Ich konnte an ihm nichts finden, das den Enthusiasmus von Doris Kroogmann und ihrer »Muddi« in irgendeiner Weise rechtfertigte.
Die erste Klientin war eine betuliche alte Jungfer, die zwei Porzellanpuppen mitbrachte, deren Sammlerwert wahrhaftig auf eine dreistellige Summe geschätzt wurde. Der nächste junge Mann hatte eine Spieluhr auf dem Dachboden gefunden, die leider nicht viel wert war. Endlich kam Griseldas Auftritt. Vor der Kamera wirkte sie ruhig und besonnen, sagte aber nicht viel. Der Professor beschrieb den Säbel sehr genau.
»Die Verzierung am Gefäßbügel sowie an der Klinge spricht für die Provenienz Österreich. Es handelt sich um einen Offizierssäbel. Ende 18. Jahrhundert.«
»Aus Österreich, das ist sehr interessant«, sagte die Moderatorin, »da ist der Säbel wohl weit gewandert, wenn er bis zu Ihnen gekommen ist, Frau Gooth?«
Die Kamera zeigte Griselda, wie sie lächelte und kurz die österreichische Familienlinie ihrer Großmutter väterlicherseits beschrieb, die letztlich die Alpenregionen verlassen und sich im Frankenland niedergelassen hatte.
»Und von dort hat mich die Liebe weiter in den Norden gelockt«, schloss sie.
Die Moderatorin wandte sich an den Professor.
»Kam der Säbel denn auch zum Einsatz?«
»Der Zustand und die Verzierung deuten darauf hin, dass der Säbel hauptsächlich zu repräsentativen Zwecken verwendet wurde, eher selten bis gar nicht als Waffe.«
»Wir haben hier also einen österreichischen Husarenoffizierssäbel, 1770-1790, in einem sehr guten Erhaltungszustand«, ergriff nun der Antiquitätenfachmann das Wort. »Damit liegt hier ein Mindestwert von 5000 Euro vor. Frau Gooth, unter Sammlerkreisen könnten Sie eventuell das Doppelte herausschlagen. Vielleicht möchten Sie über unsere Homepage inserieren?«
Griselda lehnte den Vorschlag van Dijks ab, da sie sich nur ungern von dem Familienerbstück trennen wollte. Die Sendung konzentrierte sich nun auf einen vierten Klienten und unsere Bürgermeistergattin verschwand aus dem Bild. Eduard drehte den Ton leiser, Griselda lächelte uns alle stolz an und wir schenkten ihr einen kleinen Applaus.
»Das Gespräch war in Wahrheit deutlich länger gewesen«, erklärte sie, »aber wegen der Sendezeit haben sie einige Details herausschneiden müssen.«
»Du sahst sehr schick aus, Griselda«, lobte Frauke Friedrichson.
»War ich nicht zu steif vor der Kamera?«
»Ach i wo, genau richtig. Wenn ich daran denke, wie aufgeregt ich gewesen wäre!«
Es entstanden verschiedene Gespräche gleichzeitig. Ich hörte Gerd mit einem undefinierbaren Klang in seiner Stimme »Fünftausend Euro« sagen. Michael und Dr. Woszack tauschten sich über medizinische Belange aus. Neef sprach Griselda auf eine gesonderte Versicherung für den Husarensäbel an, wurde aber von Alexander unterbrochen, der von ihr die Abläufe hinter der Kamera erklärt haben wollte.
»Werden die Gegenstände, von denen ja einige sehr wertvoll sind, vom Sender während des Aufenthalts im Studio versichert? Was passiert, solange sie nicht vor die Kamera dürfen? Welchen Eindruck haben Sie von den Moderatoren als Menschen bekommen?«
Rosenthal und Gooth unterhielten sich abseits und schauten sehr ernst drein. Das machte mich neugierig, deshalb spitzte ich die Ohren.
»Fünftausend Euro, Vincent«, sagte Gooth vorwurfsvoll.
»Was soll ich dazu sagen?« Rosenthal zuckte mit den Schultern. »Jeder irrt sich mal. Ich hatte deiner Frau empfohlen, eine zweite Meinung einzuholen.«
»Vincent, mach mir nichts vor!« Gooths Stimme blieb leise, wurde aber eindringlicher. »Deine Schätzung und die der Fachleute des Fernsehens unterscheiden sich um das Fünffache!«
Ein Klirren durchdrang den Raum. Eleonore Rosenthal hatte ihr Cocktailglas fallen gelassen und erntete dafür erschrockene Blicke von allen Seiten.
»Ach, so ein Unglück«, sagte sie verlegen und beugte sich zu den Scherben. »Wie ungeschickt von mir.«
Eines der Mädchen, Melike, kam mit Kehrblech und Besen hinzu, um die Spuren zu beseitigen, während Griselda die Situation nutzte, um sich aus den Fängen Alexanders und Neefs zu befreien.
»Kein Problem, es war ja glücklicherweise leer«, tröstete sie ihren Gast. »Stell dir vor, du hättest dir dein schönes neues Kleid ruiniert!«
Das war nur der Beginn einer Kette von merkwürdigen Begebenheiten, die die angenehme Atmosphäre der Veranstaltung zu verderben drohten. Noch während Melike mit dem Kehrblech zugange war, schubste mich jemand unsanft zur Seite, um ihr zu Hilfe zu eilen. Es war Gerd, der sich neben das Mädchen hockte, seine Hand auf ihr Knie legte und lächelte:
»Lassen Sie mich Ihnen zur Hand gehen, junge Dame.«
Unvermittelt wurde er von Griselda wieder emporgezogen, die ihn mit einer Spur zu viel Überschwang von Melike weg, hin zur Witwe Appelhoff bugsierte.
»Ich glaube, ich habe euch beide noch gar nicht miteinander bekanntgemacht«, flötete sie. »Frau Appelhoff, das ist der Bruder meines Gatten: Gerd Gooth. Mein lieber Schwager, das ist die Frau Appelhoff.«
»Ah, von dem Großunternehmen?«, erriet Gerd.
»Eben diese«, bestätigte die Witwe.
»Gerd ist auch Unternehmer, müssen Sie wissen«, sagte Griselda.
»Wirklich?«, erwiderte Frau Appelhoff. »Was unternehmen Sie denn Schönes?«
Ob die letzten Worte ein schaler Scherz gewesen waren, konnte ich nicht ganz deuten, denn die beiden drehten sich weg und gingen langsam auf das Klavier zu, über dessen Deckel die Witwe Appelhoff gedankenverloren mit ihren Fingern strich. Aller Wahrscheinlichkeit nach wollten sie Geschäftliches besprechen, also widmete ich meine Aufmerksamkeit wieder Gooth und Rosenthal, welche noch immer beieinanderstanden und die Beseitigung der Glasscherben beobachteten. Keiner von beiden dachte daran, die Aufregung ihrer Gattinnen mit beschwichtigenden Worten zu besänftigen. Stattdessen rührten sie sich nicht vom Fleck und starrten auf die Cocktailpfützchen. Es war beinahe unheimlich, denn keiner von beiden schien wirklich zu sehen, was vor sich ging.
Die nächste unschöne Begebenheit wurde durch aufdringliches Telefonklingeln eingeleitet. Griselda nahm ab und alle Einheimischen erkannten die beißende Stimme von Heidrun Mollenhauer, die durch die Leitung dröhnte. Was sie sagte, verstand man freilich nicht, aber die Antworten meiner Nachbarin ließen eindeutige Rückschlüsse zu.
»Frau Mollenhauer, danke für Ihren Anruf… Ja, es war sehr aufregend… Nein, ich will den Säbel wirklich nicht veräußern. Seit der Aufzeichnung hat sich an meiner Meinung nichts geändert… Ich glaube nicht, dass Herr van Dijk dafür herkommen würde… Ob ich was? Ein Autogramm? Nein, tut mir leid… Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Herr van Dijk ist, wir sprachen ja kaum miteinander… Oh, Sie können doch bestimmt selber an den Sender schreiben und… Frau Mollenhauer, ich bitte Sie! … Wenn Sie möchten, können Sie den Säbel gern einmal ansehen, aber ich möchte damit nicht durch unser halbes Städtchen zu Ihnen… Das müssen Sie doch verst-«
Plötzlich machte es hörbar »Klick« und Griselda fuhr zusammen. Heidrun Mollenhauer hatte, nicht gerade freundlich, mitten im Gespräch aufgelegt. Unbeholfen lächelte Griselda in die Runde und wusste nicht, was sie sagen sollte.
Die Witwe Appelhoff blieb von alledem unbeeindruckt. Sie ließ Gerd am Klavier stehen, schnappte sich den Schuldirektor und führte ihn zielstrebig zum Bürgermeister.
»Eine sehr schöne Sendung, Herr Gooth, Sie sollten stolz auf Ihre Frau sein«, sagte sie. »Es wäre doch aber zu schade, wenn Ihr Husarensäbel einsam und unbeachtet in der eigenen Vitrine verstaubte. Haben Sie darüber nachgedacht, ihn dem Heimatmuseum als Leihgabe zur Verfügung zu stellen? Ihr Schuldirektor hier wäre über die Möglichkeit, seine Schüler dadurch zu mehr geschichtlichem Interesse zu animieren, gewiss sehr angetan, nicht wahr?«
Unser Schuldirektor fühlte sich sichtlich überrumpelt, schaffte es aber, gute Miene zu machen.
»Nun, was unser Bürgermeister mit dem Säbel macht, ist ganz und gar abhängig von den Wünschen und Vorstellung seiner Ehefrau, nicht wahr? Ich will mich da nicht einmischen…«
»Recht haben Sie!«, rief Frau Appelhoff aus, ließ die Männer stehen und drängte sich zu Griselda, welche den Mädchen gerade Anweisungen gab, wo die Scherben zu entsorgen seien.
»Was für ein Weib«, seufzte der Schuldirektor kopfschüttelnd.
Rosenthal und Gooth waren indessen aus ihrer Starre erwacht. Rosenthal lächelte höflich und ging zu seiner Frau, während der Schuldirektor mit Eduard über die kommende Kulturveranstaltung in Alberts Saal sprach.
»Herakles ist ja der griechische Name von Herkules, oder?«, sagte der Bürgermeister. »Ich wusste gar nicht, dass es über den sogar ein Theaterstück gibt.«
»Das wird sicherlich ein von der Truppe selbst verfasstes Stück sein«, vermutete unser Schuldirektor. »›Laterne‹ heißen die Künstler. Habe von denen noch nie gehört.«
»Gehen Sie denn hin?«
»Meine Frau bestand darauf. Wenn unser Städtchen schon von einer Schauspieltruppe beachtet wird, sollte man ihr Angebot dankbar annehmen. Selbst wenn es nur Puppenspiel ist.«
Der Rest des Nachmittags verlief ohne Vorkommnisse und niemand erwähnte mehr das zerbrochene Glas oder den Anruf von Mollenhauer. Die Gooths posierten mit ihrem Säbel für ein paar Fotos, die Alexander schoss, und auch Rosenthal ließ sich überreden, sich als namhafter Museumsdirektor dazuzustellen. Gegen 19 Uhr verließen Margit, Michael und ich die Feierlichkeit.
»War doch nett, oder?«, fragte meine Schwiegertochter. »Bis auf das Salzgebäck. Das bläht einen immer so auf.«
»Den Anruf von Frau Kroogmanns Muddi fandest du nicht störend?«, fragte ich.
»Ach, das darf man nicht ernst nehmen«, meinte Margit.
»Ist wohl etwas meschugge, die Oma Mollenhauer?«, fragte Michael und schaute uns beide belustigt an.
Ich ging nicht darauf ein, sondern fragte zurück:
»Hast du mit der neuen Ärztin über dein Studium gesprochen, Michael?«
»Ein bisschen«, erwiderte er tonlos.
»Und? Hat sie dir hilfreiche Tipps gegeben? Weißt du jetzt, welche Richtung du einschlagen willst? Pathologe? Chirurg?«
Er zuckte mit den Achseln und antwortete nicht.
»Ist es dir etwa unangenehm, darüber zu sprechen?«, bohrte seine Mutter nach.
»Ein andermal«, sagte er und ging auf sein Zimmer.
Nachdem er verschwunden war, sagte ich zu Margit:
»Dein Sohn verbirgt etwas. Wieso geht er jedem Gespräch über sein Studium aus dem Weg?«
»Langsam ist es auffällig, nicht wahr? Ach, ich weiß nicht. Er ist erwachsen, man will ihm ja nicht reinreden.«
Wir schwiegen eine Weile. Plötzlich erschrak Margit und machte dabei ein so seltsames Geräusch, dass auch ich zusammenzuckte.
»Daran habe ich gar nicht gedacht!«, rief sie aus.
»Woran? Was ist los?«
»Oje, wäre ich doch gestern statt heute gegangen, vielleicht hätte es noch geklappt! Aber ich war zu faul…«
»Was meinst du denn? Worum geht es?«
»Meine Haare!«
»Deine Haare?«
»Ja. Ich bin bestimmt auf einem von Alexanders Fotos drauf und jeder wird sehen, dass ich nicht beim Friseur war. Was sollen die Leute denken?«
»Die werden gar nichts denken«, musste ich Margit enttäuschen, »sondern nur auf die Gooths und auf den Säbel gucken. Ist ja auch ein schönes Stück!«
»Ja, aber eine Kriegswaffe im Wohnzimmer auszustellen wäre nicht mein Fall«, entgegnete meine Schwiegertochter.
Seit dem Tod meines Sohnes – ihres Ehemannes – hegte sie eine starke Abneigung gegen alles, was mit Gewalt zu tun haben könnte.
»Ich würde mich da nicht wohlfühlen. Frau Appelhoff hat recht, das Ding gehört ins Museum.«
»Im Fernsehen sagten sie, dass der Säbel wahrscheinlich nicht als Waffe benutzt wurde«, warf ich ein. »Und nach all den Jahren wird er mit Sicherheit so abgestumpft sein, dass er kaum noch Schaden anrichten kann.«
Tags darauf wurde ich eines Besseren belehrt.