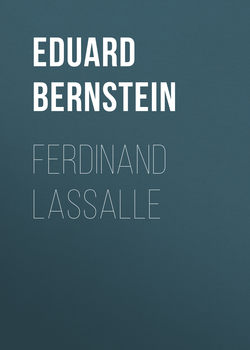Читать книгу Ferdinand Lassalle - Bernstein Eduard, Eduard Bernstein - Страница 3
Lassalles Jugend, der Hatzfeldt-Prozeß, die Assisenrede und der Franz von Sickingen
ОглавлениеAls das Leipziger Komitee sich an Lassalle wandte, stand dieser in seinem 37. Lebensjahre, in der Vollkraft seiner körperlichen und geistigen Entwicklung. Er hatte bereits ein bewegtes Leben hinter sich, sich politisch und wissenschaftlich – beides allerdings zunächst innerhalb bestimmter Kreise – einen Namen gemacht, er unterhielt Verbindungen mit hervorragenden Vertretern der Literatur und Kunst, verfügte über ansehnliche Geldmittel und einflußreiche Freunde – kurz, nach landläufigen Begriffen konnte ihm das Komitee, eine aus bisher völlig unbekannten Persönlichkeiten zusammengesetzte Vertretung einer im Embryozustand befindlichen Bewegung, nichts bieten, was er nicht schon hatte. Trotzdem ging er mit der größten Bereitwilligkeit auf dessen Wünsche ein und traf die einleitenden Schritte, der Bewegung diejenige Richtung zu geben, die seinen Ansichten und Zwecken am besten entsprach. Von anderen Rücksichten abgesehen, zog ihn gerade der Umstand besonders zu ihr hin, daß die Bewegung noch keine bestimmte Form angenommen hatte, daß sie sich ihm als eine ohne Schwierigkeit zu modelnde Masse darstellte. Ihr erst Form zu geben, sie zu einem Heerbann in seinem Sinne zu gestalten, das entsprach nicht nur seinen hochfliegenden Plänen, das war überhaupt eine Aufgabe, die seinen natürlichen Neigungen ungemein sympathisch sein mußte. Die Einladung traf ihn nicht nur bei seiner sozialistischen Überzeugung, sondern auch bei seinen Schwächen. Und so ging er denn mit großer Bereitwilligkeit auf sie ein.
Die vorliegende Arbeit beansprucht nicht, eine eigentliche Biographie Ferdinand Lassalles zu geben, die sehr ansehnliche Zahl der Lebensbeschreibungen des Gründers des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins noch um eine weitere zu vermehren. Der für sie zur Verfügung stehende Raum gebietet von vielem abzusehen, was zu einer Biographie gehörte. Was sie in erster Reihe will, ist vielmehr die Persönlichkeit und Bedeutung Ferdinand Lassalles zu schildern, insoweit seine politisch-literarische und agitatorische Tätigkeit in Betracht kommt. Nichtsdestoweniger ist ein Rückblick auf den Lebenslauf Lassalles unerläßlich, da er erst den Schlüssel zum Verständnis seines politischen Handelns liefert.
Schon seine Abstammung scheint auf die Entwicklung Lassalles eine große, man kann sogar sagen verhängnisvolle Wirkung ausgeübt zu haben. Wir sprechen hier nicht schlechthin von vererbten Eigenschaften oder Dispositionen, sondern von der bedeutungsvollen Tatsache, daß das Bewußtsein, von jüdischer Herkunft zu sein, Lassalle eingestandenermaßen noch in vorgeschrittenen Jahren peinlich war, und daß es ihm trotz seines eifrigen Bemühens oder vielleicht gerade wegen dieses Bemühens nie gelang, sich tatsächlich über seine Abstammung hinwegzusetzen, eine innerliche Befangenheit loszuwerden. Aber man darf nicht vergessen, daß Lassalles Wiege im östlichen Teil der preußischen Monarchie gestanden hatte – er wurde am 11. April 1825 in Breslau geboren – , wo bis zum Jahre 1848 die Juden nicht einmal formell völlig emanzipiert waren. Die Wohlhabenheit seiner Eltern ersparte Lassalle viele Widerwärtigkeiten, unter denen die ärmeren Juden damals zu leiden hatten, aber sie schützte ihn nicht vor den allerhand kleinen Kränkungen, denen die Angehörigen jeder für untergeordnet gehaltenen Rasse, auch wenn sie sich in guter Lebensstellung befinden, ausgesetzt sind, und die in einer so selbstbewußten Natur, wie Lassalle von Jugend auf war, zunächst einen trotzigen Fanatismus des Widerstandes erzeugen, der dann später oft in das Gegenteil umschlägt. Wie stark dieser Fanatismus bei dem jungen Lassalle war, geht aus seinem durch Paul Lindau zur Veröffentlichung gebrachten Tagebuch aus den Jahren 1840 und 1841 hervor. Am 1. Februar 1840 schreibt der noch nicht 15 Jahre alte Ferdinand in sein Tagebuch:
„… Ich sagte ihm dies, und in der Tat, ich glaube, ich bin einer der besten Juden, die es gibt, ohne auf das Zeremonialgesetz zu achten. Ich könnte, wie jener Jude in Bulwers ‚Leila’ mein Leben wagen, die Juden aus ihrer jetzigen drückenden Lage zu reißen. Ich würde selbst das Schafott nicht scheuen, könnte ich sie wieder zu einem geachteten Volke machen. O, wenn ich meinen kindischen Träumen nachhänge, so ist es immer meine Lieblingsidee, an der Spitze der Juden mit den Waffen in der Hand sie selbständig zu machen.” Die Mißhandlungen der Juden in Damaskus im Mai 1840 entlocken ihm den Ausruf: „Ein Volk, das dies erträgt, ist schrecklich, es räche oder dulde die Behandlung.” Und an den Satz eines Berichterstatters: „Die Juden dieser Stadt erdulden Grausamkeiten, wie sie nur von diesen Parias der Erde ohne furchtbare Reaktion ertragen werden können”, knüpft er die von Börne übernommene Betrachtung an: „Also sogar die Christen wundern sich über unser träges Blut, daß wir uns nicht erheben, nicht lieber auf dem Schlachtfeld, als auf der Tortur sterben wollen. Waren die Bedrückungen, um deren willen sich die Schweizer einst erhoben, größer?.. Feiges Volk, du verdienst kein besseres Los.” Noch leidenschaftlicher äußert er sich einige Monate später (30. Juli): „Wieder die abgeschmackten Geschichten, daß die Juden Christenblut brauchten. Dieselbe Geschichte, wie in Damaskus, auch in Rhodos und Lemberg. Daß aber aus allen Winkeln der Erde man mit diesen Beschuldigungen hervortritt, scheint mir anzudeuten, daß die Zeit bald reif ist, in der wir in der Tat durch Christenblut uns helfen werden. Aide-toi et le ciel t'aidera. Die Würfel liegen, es kommt auf den Spieler an.”
Diese kindischen Ideen verfliegen, je mehr sich der Blick erweitert, aber die Wirkung, die solche Jugendeindrücke auf die geistigen Dispositionen ausüben, bleibt. Zunächst wurde der frühreife Lassalle durch den Stachel der „Torturen”, von denen er schreibt, um so mehr angetrieben, sich für seine Person um jeden Preis Anerkennung und Geltung zu verschaffen. Auf der anderen Seite wird der Rebell gegen die Unterdrückung der Juden durch die Christen bald politischer Revolutionär. Dabei macht er einmal, als er Schillers Fiesko gesehen, folgende, von merkwürdig scharfer Selbstkritik zeugende Bemerkung: „Ich weiß nicht, trotzdem ich jetzt revolutionär-demokratisch-republikanische Gesinnungen habe wie einer, so fühle ich doch, daß ich an der Stelle des Grafen Lavagna ebenso gehandelt und mich nicht damit begnügt hätte, Genuas erster Bürger zu sein, sondern nach dem Diadem meine Hand ausgestreckt hätte. Daraus ergibt sich, wenn ich die Sache bei Lichte betrachte, daß ich bloß Egoist bin. Wäre ich als Prinz oder Fürst geboren, ich würde mit Leib und Leben Aristokrat sein. So aber, da ich bloß ein schlichter Bürgerssohn bin, werde ich zu seiner Zeit Demokrat sein.”
Sein politischer Radikalismus ist es auch, der 1841 den sechzehnjährigen Lassalle veranlaßt, den vorübergehend gefaßten Entschluß, sich zum Kaufmannsberuf vorzubereiten, wieder aufzugeben und von seinem Vater die Erlaubnis zu erwirken, sich zum Universitätsstudium vorzubereiten. Die lange Zeit verbreitete Anschauung, als sei Lassalle von seinem Vater wider seinen Willen auf die Handelsschule nach Leipzig geschickt worden, ist durch das Tagebuch als durchaus falsch erwiesen, Lassalle hat selbst seine Übersiedelung vom Gymnasium auf die Handelsschule betrieben. Freilich nicht aus vorübergehender Vorliebe für den Kaufmannsberuf, sondern um den Folgen einer Reihe von leichtsinnigen Streichen zu entgehen, die er zu dem Zweck begangen hatte, seinem Vater nicht die tadelnden Zensuren zeigen zu müssen, welche er – nach seiner Ansicht unverdient – zu erhalten pflegte. Als es ihm aber auf der Leipziger Handelsschule nicht besser erging als auf dem Breslauer Gymnasium, als er auch dort mit den meisten der Lehrer, und vor allem mit dem Direktor in Konflikte geriet, die sich immer mehr zuspitzten, je radikaler Lassalles Ansichten wurden, da war's auch sofort mit der Kaufmannsidee bei ihm vorbei. Im Mai 1840 hat er die Handelsschule bezogen, und schon am 3. August „hofft” er, daß der „Zufall” ihn eines Tages aus dem Kontor herausreißen und auf einen Schauplatz werfen werde, auf dem er öffentlich wirken könne. „Ich traue auf den Zufall und auf meinen festen Willen, mich mehr mit den Musen als den Haupt- und Strazzabüchern, mich mehr mit Hellas und dem Orient, als mit Indigo und Runkelrüben, mehr mit Thalien und ihren Priestern, als mit Krämern und ihren Kommis zu beschäftigen, mich mehr um die Freiheit, als um die Warenpreise zu bekümmern, heftiger die Hunde von Aristokraten, die dem Menschen sein erstes, höchstes Gut wegnehmen, als die Konkurrenten, die den Preis verschlechtern, zu verwünschen.” „Aber beim Verwünschen soll's nicht bleiben,” setzt er noch hinzu. Zu dem Radikalismus kommt der immer stärkere Drang, den Juden in sich abzuschütteln, und dieser Drang ist schließlich so energisch, daß, als Lassalle im Mai 1841 dem Vater seinen „unwiderruflichen” Entschluß mitteilt, doch zu studieren, er zugleich ablehnt, Medizin oder Jura zu studieren, weil „der Arzt wie der Advokat Kaufleute sind, die mit ihrem Wissen Handel treiben”. Er aber wolle studieren „des Wirkens wegen”. Mit dem letzteren war der Vater zwar nicht einverstanden, er willigte aber ein, daß Lassalle sich zum Studium vorbereite.
Nun arbeitete Lassalle mit Rieseneifer, und war im Jahre 1842 schon so weit, sein Maturitätsexamen abzulegen. Er studiert zuerst Philologie, geht aber dann zur Philosophie über und entwirft den Plan zu einer größeren philologisch-philosophischen Arbeit über den Philosophen Herakleitos von Ephesus. Daß er sich gerade diesen Denker zum Gegenstand der Untersuchung auswählte, von dem selbst die größten Philosophen Griechenlands bekannt hatten, daß sie nie sicher seien, ob sie ihn ganz richtig verstanden, und der deshalb den Beinamen „der Dunkle” erhielt, ist wiederum in hohem Grade bezeichnend für Lassalle. Mehr noch als die Lehre Heraklits, den Hegel selbst als seinen Vorläufer anerkannt hatte, reizte ihn das Bewußtsein, daß hier nur durch glänzende Leistungen Lorbeeren zu erlangen waren. Neben dem schon erwähnten Trieb, jedermann durch außergewöhnliche Leistungen zu verblüffen, hatte Lassalle zugleich das Bewußtsein, jede Aufgabe, die er sich stellte, auch lösen zu können. Dieses grenzenlose Selbstvertrauen war das Fatum seines Lebens. Es hat ihn in der Tat Dinge unternehmen und zu Ende führen lassen, vor denen tausend andere zurückgeschreckt wären, selbst wenn sie über die intellektuellen Fähigkeiten Lassalles verfügt hätten, es ist aber auf der andern Seite zum Anlaß verhängnisvoller Fehlgriffe und schließlich zur Ursache seines jähen Endes geworden.
Nach vollendetem Studium ging Lassalle 1845 an den Rhein und später nach Paris, teils um dort in den Bibliotheken zu arbeiten, teils um die Weltstadt, das Zentrum des geistigen Lebens der Epoche, kennenzulernen. In Paris gingen damals die Wogen der sozialistischen Bewegung sehr hoch, und so zog es auch Lassalle dorthin, der 1843 schon sein sozialistisches Damaskus gefunden hatte. Ob und inwieweit Lassalle mit den in Paris lebenden deutschen Sozialisten bekannt wurde – Karl Marx war, nachdem die „Deutsch-französischen Jahrbücher” eingegangen und der „Vorwärts” sistiert worden war, im Januar 1845 aus Paris ausgewiesen worden und nach Brüssel übersiedelt – , darüber fehlen zuverlässige Angaben. Wir wissen nur, daß er viel mit Heinrich Heine verkehrte, an den er empfohlen war, und dem er in mißlichen Geldangelegenheiten (einem Erbschaftsstreit) große Dienste leistete. Die Briefe, in denen der kranke Dichter dem zwanzigjährigen Lassalle seine Dankbarkeit und Bewunderung aussprach, sind bekannt. Sie lassen unter anderem erkennen, welch starken Eindruck Lassalles Selbstbewußtsein auf Heine gemacht hat.
Nach Deutschland zurückgekehrt, machte Lassalle im Jahre 1846 die Bekanntschaft der Gräfin Sophie von Hatzfeldt, die sich seit Jahren vergeblich bemühte, von ihrem Manne, einem der einflußreichsten Aristokraten, der sie allen Arten von Demütigungen und Kränkungen ausgesetzt hatte, gesetzliche Scheidung und Herausgabe ihres Vermögens zu erlangen. Man hat über die Motive, welche Lassalle veranlaßten, die Führung der Sache der Gräfin zu übernehmen, vielerlei Vermutungen aufgestellt. Man hat sie auf ein Liebesverhältnis mit der zwar nicht mehr jugendlichen, aber noch immer schönen Frau zurückführen wollen, während Lassalle selbst sich im Kassettenprozeß mit großer Leidenschaftlichkeit dagegen verwahrt hat, durch irgendeinen anderen Beweggrund dazu veranlaßt worden zu sein, als den des Mitleids mit einer verfolgten, von allen helfenden Freunden verlassenen Frau, dem Opfer ihres Standes, dem Gegenstand der brutalen Verfolgungen eines übermütigen Aristokraten. Es liegt absolut kein Grund vor, dieser Lassalleschen Beteuerung nicht zu glauben. Ob nicht Lassalle in den folgenden Jahren vorübergehend in ein intimeres Verhältnis als das der Freundschaft zur Gräfin getreten ist, mag dahingestellt bleiben; es ist aber schon aus psychologischen Gründen unwahrscheinlich, daß ein solches Verhältnis gleich am Anfang ihrer Bekanntschaft, als Lassalle den Prozeß übernahm, bestanden habe. Viel wahrscheinlicher ist es, daß neben der vielleicht etwas romantisch übertriebenen, aber doch durchaus anerkennenswerten Parteinahme für eine verfolgte Frau und dem Haß gegen den hochgestellten Adligen gerade das Bewußtsein, daß es sich hier um eine Sache handelte, die nur mit Anwendung außergewöhnlicher Mittel und Kraftentfaltung zu gewinnen war, einen großen Reiz auf Lassalle ausgeübt hat. Was andere abgeschreckt hätte, zog ihn unbedingt an.
Er hat in dem Streit gesiegt, er hat den Triumph gehabt, daß der hochmütige Aristokrat vor ihm, dem „dummen Judenjungen” kapitulieren mußte. Aber er ist gleichfalls nicht unverletzt aus dem Kampf hervorgegangen. Um ihn zu gewinnen, hatte er freilich außergewöhnliche Mittel aufwenden müssen, aber es waren nicht, oder richtiger, nicht nur die Mittel außergewöhnlicher Vertiefung in die rechtlichen Streitfragen, außergewöhnlicher Schlagfertigkeit und Schärfe in der Widerlegung der gegnerischen Finten; es waren auch die außergewöhnlichen Mittel des unterirdischen Krieges: die Spionage, die Bestechung, das Wühlen im ekelhaftesten Klatsch und Schmutz. Der Graf Hatzfeldt, ein gewöhnlicher Genußmensch, scheute vor keinem Mittel zurück, seine Ziele zu erreichen, und um seine schmutzigen Manöver zu durchkreuzen, nahm die Gegenseite zu Mitteln ihre Zuflucht, die nicht gerade viel sauberer waren. Wer die Aktenstücke des Prozesses nicht gelesen, kann sich keine Ahnung machen von dem Schmutz, der dabei aufgewühlt und immer wieder herangeschleppt wurde, von der Qualität der beiderseitigen Anklagen und – Zeugen.
Und von den Rückwirkungen der umgekehrten Augiasarbeit im Hatzfeldt-Prozeß hat sich Lassalle nie ganz freimachen können. Wir meinen das nicht im spießbürgerlichen Sinne, etwa im Hinblick auf seine späteren Liebesaffären, sondern mit Bezug auf seine von nun an wiederholt bewiesene Bereitwilligkeit, jedes Mittel gutzuheißen und zu benutzen, das ihm für seine jeweiligen Zwecke dienlich erschien; wir meinen den Verlust jenes Taktgefühls, das dem Mann von Überzeugung selbst im heftigsten Kampfe jeden Schritt verbietet, der mit den von ihm vertretenen Grundsätzen in Widerspruch steht, wir meinen die von da an wiederholt und am stärksten in der tragischen Schlußepisode seines Lebens sich offenbarende Einbuße an gutem Geschmack und moralischem Unterscheidungsvermögen. Als jugendlicher Enthusiast hatte Lassalle sich in den Hatzfeldtschen Prozeß gestürzt, – er selbst gebraucht in der Kassettenrede das Bild des Schwimmers: „Welcher Mensch, der ein starker Schwimmer ist, sieht einen andern von den Wellen eines Stromes fortgetrieben, ohne ihm Hilfe zu bringen? Nun wohl, für einen guten Schwimmer hielt ich mich, unabhängig war ich, so sprang ich in den Strom” – gewiß, aber leider war es ein recht trüber Strom, in den er sich gestürzt, ein Strom, der sich in eine große Pfütze verlief, und als Lassalle herauskam, war er von der eigenartigen Moral der Gesellschaft, mit der er sich zu befassen gehabt, angesteckt. Seine ursprünglichen besseren Instinkte kämpften lange gegen die Wirkungen dieses Giftes, drängten sie auch wiederholt siegreich zurück, aber schließlich ist er ihnen doch erlegen. Das hier Gesagte mag manchem zu scharf erscheinen, aber wir werden im weiteren Verlauf unserer Skizze sehen, daß es nur gerecht gegen Lassalle ist. Wir haben hier keine Apologie zu schreiben, sondern eine kritische Darstellung zu geben, und das erste Erfordernis einer solchen ist, die Wirkungen aus den Ursachen zu erklären1.
Bevor wir jedoch weitergehen, haben wir zunächst noch der Rolle zu gedenken, die Lassalle im Jahre 1848 gespielt hat.
Beim Ausbruch der März-Revolution war Lassalle so tief in den Maschen des Hatzfeldtschen Prozesses verwickelt, daß er sich ursprünglich fast zur politischen Untätigkeit verurteilt sah. Im August 1848 fand der Prozeß wegen „Verleitung zum Kassettendiebstahl” gegen ihn statt und er hatte alle Hände voll zu tun, sich auf diesen zu rüsten. Erst als er nach siebentägiger Verhandlung freigesprochen worden war, gewann er wieder Zeit, an den politischen Ereignissen jener bewegten Zeit direkten Anteil zu nehmen.
Lassalle, der damals in Düsseldorf, der Geburtsstadt Heines, lebte, stand natürlich als Republikaner und Sozialist auf der äußersten Linken der Demokratie. Organ dieser im Rheinland war die von Karl Marx redigierte „Neue Rheinische Zeitung”. Karl Marx gehörte ferner eine Zeitlang dem Kreisausschuß der rheinischen Demokraten an, der in Köln seinen Sitz hatte. So war eine doppelte Gelegenheit gegeben, Lassalle in nähere Verbindung mit Marx zu bringen. Er verkehrte mündlich und schriftlich mit dem erwähnten Kreisausschuß, sandte wiederholt Mitteilungen und Korrespondenzen an die „Neue Rheinische Zeitung” und erschien auch gelegentlich selbst auf der Redaktion dieses Blattes. So bildete sich allmählich ein freundschaftlicher persönlicher Verkehr zwischen Lassalle und Marx heraus, der auch später noch, als Marx im Exil lebte, in Briefen und auch zweimal in Besuchen fortgesetzt wurde. Lassalle besuchte Marx 1862 in London, nachdem Marx im Jahre 1861 auf einer Reise nach Deutschland Lassalle in Berlin besucht hatte. Indes herrschte zu keiner Zeit ein tieferes Freundschaftsverhältnis zwischen den beiden, dazu waren schon ihre Naturen viel zu verschieden angelegt. Was sonst noch einer über die politische Kampfgenossenschaft hinausgehenden Intimität im Wege stand, soll später erörtert werden.
Der hereinbrechenden Reaktion des Jahres 1848 gegenüber nahm Lassalle genau dieselbe Haltung ein, wie die Redaktion der „Neuen Rheinischen Zeitung” und die Partei, die hinter dieser stand. Gleich ihr forderte er, als die preußische Regierung im November 1848 den Sitz der Nationalversammlung verlegt, die Bürgerwehr aufgelöst und den Belagerungszustand über Berlin verhängt hatte, und die Nationalversammlung ihrerseits mit der Versetzung des Ministeriums in Anklagezustand, sowie mit der Erklärung geantwortet hatte, daß dieses Ministerium nicht berechtigt sei, Steuern zu erheben, zur Organisierung des bewaffneten Widerstandes gegen die Steuererhebung auf. Gleich dem Ausschuß der rheinischen Demokraten ward auch Lassalle wegen Aufreizung zur Bewaffnung gegen die königliche Gewalt unter Anklage gestellt, gleich ihm von den Geschworenen freigesprochen, aber die immer rücksichtsloser auftretende Reaktion stellte außerdem gegen Lassalle noch die Eventualanklage, zur Widersetzlichkeit gegen Regierungsbeamte aufgefordert zu haben, um ihn vor das Zuchtpolizeigericht zu bringen. Und in der Tat verurteilte dieses – die Regierung kannte unzweifelhaft ihre Berufsrichter – Lassalle schließlich auch zu sechs Monaten Gefängnis.
Lassalles Antwort auf die ersterwähnte Anklage ist unter dem Titel „Assisen-Rede” im Druck erschienen. Sie ist jedoch nie wirklich gehalten worden, und alles, was in verschiedenen älteren Biographien über den „tiefen” Eindruck erzählt wird, den sie auf die Geschworenen und das Publikum gemacht habe, gehört daher in das Bereich der Fabel. Lassalle hatte die Rede noch vor der Verhandlung in Druck gegeben, und da einzelne der fertigen Druckbogen auch vorher in Umlauf gesetzt worden waren, beschloß der Gerichtshof, die Öffentlichkeit auszuschließen. Als trotz Lassalles Protest und der Erklärung, die Verbreitung der Druckbogen sei ohne sein Vorwissen erfolgt, ja höchstwahrscheinlich von seinen Feinden durch das Mittel der Bestechung veranlaßt worden, der Gerichtshof den Beschluß aufrecht erhielt, verzichtete Lassalle überhaupt darauf, sich zu verteidigen, wurde aber nichtsdestoweniger freigesprochen.
Ob aber gehalten oder nicht, die „Assisen-Rede” bleibt jedenfalls ein interessantes Dokument für das Studium der politischen Entwicklung Lassalles. Er steht in ihr fast durchgängig auf dem von Karl Marx drei Monate vorher in dessen Rede vor den Kölner Geschworenen vertretenen Standpunkt. Ein Vergleich der beiden Reden zeigt dies aufs deutlichste, ebenso aber auch die Verschiedenartigkeit des Wesens von Marx und Lassalle. Marx enthält sich aller oratorischen Ausschmückung, er geht direkt auf die Sache ein, entwickelt in einfacher und gedrängter Sprache, Satz für Satz, scharf und mit rücksichtsloser Logik seinen Standpunkt und schließt ohne jede Apostrophe mit einer Charakteristik der politischen Situation. Man sollte meinen, seine eigene Person stehe ganz außer Frage, und er habe nur die Aufgabe, den Geschworenen einen politischen Vortrag zu halten. Lassalle dagegen peroriert fast von Anfang bis zu Ende, er erschöpft sich in – oft sehr schönen – Bildern und in Superlativen. Alles ist Pathos, ob von der durch ihn vertretenen Sache oder von seiner Person die Rede ist, er spricht nicht zu den Geschworenen, sondern zu den Tribünen, zu einer imaginären Volksversammlung, und schließt, nach Verkündigung einer Rache, die „so vollständig” sein wird wie „die Schmach, die man dem Volke antut”, mit einer Rezitation aus Tell.
Noch im Gefängnis, wo er sich durch seine Energie und Hartnäckigkeit Vergünstigungen ertrotzte, die sonst Gefangenen nie erteilt zu werden pflegten – so erhielt er, was er später selbst für ungesetzlich erklärte, wiederholt Urlaub, um in den Prozessen der Gräfin Hatzfeldt zu plädieren – und in den darauffolgenden Jahren wurde Lassalles Tätigkeit wieder fast vollständig durch die Hatzfeldtsche Angelegenheit in Anspruch genommen. Daneben hielt Lassalle ein gastliches Haus für politische Freunde und versammelte längere Zeit einen Kreis vorgeschrittener Arbeiter um sich, denen er politische Vorträge hielt. Endlich erfolgte im Jahre 1854 im Hatzfeldtschen Prozeß der Friedensschluß. Die Gräfin erhielt ein bedeutendes Vermögen ausbezahlt und Lassalle eine Rente von jährlich siebentausend Talern sichergestellt, die ihm gestattete, seine Lebensweise ganz nach seinen Wünschen einzurichten.
Zunächst behielt er seinen Wohnsitz in Düsseldorf bei und arbeitete hier an seinem „Heraklit” weiter. Daneben unternahm er allerhand Reisen, u. a. auch eine in den Orient. Auf die Dauer aber konnten ihn diese Unterbrechungen nicht mit dem Aufenthalt in der Provinzialstadt, in der das politische Leben erloschen war, aussöhnen. Es verlangte ihn nach einem freieren, anregenderen Leben, als es die rheinische Stadt bot oder erlaubte, nach dem Umgang mit bedeutenden Persönlichkeiten, nach einem größeren Wirkungskreis. So erwirkt er sich denn 1857 durch die Vermittlung Alexander von Humboldts beim Prinzen von Preußen von der Berliner Polizei die Erlaubnis, seinen Wohnsitz in Berlin nehmen zu dürfen.
Dieses Gesuch wie die erteilte Erlaubnis verdienen Beachtung. Lassalle hatte im Mai 1849 in flammenden Worten die „schmachvolle und unerträgliche Gewaltherrschaft” gebrandmarkt, die „über Preußen hereingebrochen”; er hatte ausgerufen: „Warum zu soviel Gewalt noch soviel Heuchelei? Doch das ist preußisch” und „vergessen wir nichts, nie, niemals… Bewahren wir sie auf, diese Erinnerungen, sorgfältig auf, wie die Gebeine gemordeter Eltern, deren einziges Erbe ist der Racheschwur, der sich an diese Knochen knüpft.” (Assisenrede.) Wie kam er nun dazu, ein solches Gesuch zu stellen, und es dem guten Willen der Regierung, die in der angegebenen Weise angegriffen worden war, anheim zu stellen, es zu bewilligen? Er konnte in politischen Dingen sehr rigoros sein und hat es 1860 in einem Brief an Marx scharf verurteilt, daß Wilhelm Liebknecht für die großdeutsch-konservative „Augsburger Allgemeine Zeitung” schrieb. Aber er hielt es im Hinblick auf die wissenschaftlichen Arbeiten, die ihn beschäftigten, für sein gutes Recht, die Aufenthaltsbewilligung zu verlangen, und im Bewußtsein der Festigkeit seines politischen Wollens für reine Formsache, daß er seine betreffenden Eingaben als Gesuche abzufassen hatte. Denn es handelt sich da um verschiedene Anträge, der erste 1855 an den Berliner Polizeigewaltigen Hinckeldey, der zweite, im Juni 1856, direkt an den damaligen Prinzregenten gerichtet (Vgl. darüber „Dokumente des Sozialismus”, Jahrgang 1903, S. 130 und 407 ff.) Aus diesen Schritten machte er Karl Marx gegenüber kein Geheimnis.
Es ist zudem nicht unmöglich, daß Lassalle durch Verbindungen der Gräfin Hatzfeldt, die ziemlich weit reichten, davon unterrichtet war, daß sich in den oberen Regionen Preußens ein neuer Wind vorbereite. Wie weit diese Verbindungen reichten, geht aus Informationen hervor, die Lassalle bereits im Jahre 1854, beim Ausbruch des Krimkrieges, an Marx nach London gelangen ließ. So teilt er Marx unterm 10. Februar 1854 den Wortlaut einer Erklärung mit, die einige Tage vorher vom Berliner Kabinett nach Paris und London abgegangen sei, schildert die Zustände im Berliner Kabinett – der König und fast alle Minister für Rußland, nur Manteuffel und der Prinz von Preußen für England – und die für gewisse Eventualitäten vom Kabinett beschlossenen Maßregeln, worauf es heißt: „Alle die hier mitgeteilten Nachrichten kannst Du so betrachten, als wenn Du sie aus Manteuffels und Aberdeens eigenem Munde hättest!” Vier Wochen später machte er wieder allerhand Mitteilungen über beabsichtigte Schritte des Kabinetts, gestützt auf Mitteilungen „zwar nicht aus meiner ‚offiziellen’, aber doch aus ziemlich glaubhafter Quelle”. Am 20. Mai 1854 klagt er, daß seine „diplomatische Quelle” eine weite Reise angetreten habe. „Eine so vorzügliche Quelle, durch die man kabinettsmäßig informiert war, zu haben und dann auf so lange Zeit wieder verlieren, ist überaus ärgerlich.” Aber er hat immer noch Nebenquellen, die ihn über Interna des Berliner Kabinetts unterrichten, und ist u. a. „zeitig vorher von Bonins Entlassung usw.” benachrichtigt worden.
Einige dieser Quellen standen dem Berliner Hof sehr nahe, und ihre Berichte mögen auch Lassalles Schritt veranlaßt haben. Die geistige Zerrüttung Friedrich Wilhelm IV. war um das Jahr 1857 bereits sehr weit vorgeschritten, und wenn auch die getreuen Minister und Hüter der monarchischen Idee sie noch nicht für genügend erachteten, des Königs Regierungsunfähigkeit auszusprechen, so wußte man doch in allen unterrichteten Kreisen, daß der Regierungsantritt des Prinzen von Preußen nur noch eine Frage von Monaten sei.
In Berlin vollendete Lassalle zunächst den Heraklit, der Ende 1857 im Verlage von Franz Duncker erschien.
Über dieses beinahe mehr noch philologische als philosophische Werk gehen die Meinungen der Sachverständigen auseinander. Die einen stellen es als epochemachend hin, die andern behaupten, daß es in der Hauptsache nichts sage, was nicht schon bei Hegel zu finden sei. Richtig ist, daß Lassalle hier fast durchgängig auf althegelschem Standpunkt steht – die Dinge werden aus den Begriffen entwickelt, die Kategorien des Gedankens als ewige metaphysische Wesenheiten behandelt, deren Bewegung die Geschichte erzeugt. Aber auch diejenigen, welche die epochemachende Bedeutung der Lassalleschen Arbeit bestreiten, geben zu, daß sie eine sehr tüchtige Leistung ist. Sie verschaffte Lassalle in der wissenschaftlichen Welt einen geachteten Namen.
Für die Charakteristik Lassalles und seines geistigen Entwicklungsganges ist sein Werk über Herakleitos den Dunklen von Ephesos aber nicht bloß darin von Bedeutung, daß es Lassalle als eben entschiedenen Anhänger Hegels zeigt. Man kann auch dem bekannten dänischen Literarhistoriker G. Brandes zustimmen, wenn er in seiner oft zugunsten belletristischer Ausschmückung mit den Tatsachen ziemlich frei umspringenden Studie über Lassalle2 auf verschiedene Stellen in der Arbeit über Heraklit als Schlüssel zum Verständnis von Lassalles Lebensanschauungen hinweist. Es gilt dies namentlich von Lassalles großem Kultus des Staatsgedankens – auch in dieser Hinsicht war Lassalle Althegelianer – und in bezug auf Lassalles Auffassung von Ehre und Ruhm. Brandes schreibt in ersterer Hinsicht:
„Heraklits Ethik, sagt Lassalle, faßt sich in den einen Gedanken zusammen, der zugleich der ewige Grundbegriff des Sittlichen selbst ist: ‚Hingabe an das Allgemeine.’ Das ist zugleich griechisch und modern; aber Lassalle kann sich das Vergnügen nicht versagen, in der speziellen Ausführung dieses Gedankens bei dem alten Griechen die Übereinstimmung mit Hegels Staatsphilosophie nachzuweisen: ‚Wie in der Hegelschen Philosophie die Gesetze gleichfalls aufgefaßt werden als die Realisation des allgemeinen substantiellen Willens, ohne daß bei dieser Bestimmung im geringsten an den formellen Willen der Subjekte und deren Zählung gedacht wird, so ist auch das Allgemeine Heraklits gleich sehr von der Kategorie der empirischen Allheit entfernt.’” (Vgl. a. a. O. S. 40.)
Brandes hat nicht Unrecht, wenn er zwischen dieser Staatsidee, die bei Lassalle immer wiederkehrt, und Lassalles Bekennerschaft zur Demokratie und zum allgemeinen Stimmrecht – die doch die Herrschaft des „formellen Willens der Subjekte” darstellen – einen Gegensatz erblickt, den man „nicht ungestraft in seinem Gemüte hegt”, und der in der Welt der Prinzipien das Gegenstück zu dem Kontrast darstelle, der „rein äußerlich zutage trat, wenn Lassalle mit seiner ausgesucht eleganten Kleidung, seiner ausgesucht feinen Wäsche und seinen Lackstiefeln in und zu einem Kreise von Fabrikarbeitern mit rußiger Haut und schwieligen Händen sprach”.
Das ist belletristisch ausgedrückt. Tatsächlich hat Lassalles althegelsche Staatsidee ihn später im Kampf gegen den Liberalismus weit über das Ziel hinausschießen lassen.
Über Lassalles Auffassung von Ehre und Ruhm schreibt Brandes:
„Noch eine Übereinstimmung, die letzte zwischen – Heraklit und Lassalle, bildet der trotz des Selbstgefühls und des Stolzes so leidenschaftliche Drang nach Ruhm und Ehre, nach der Bewunderung und dem Lobe anderer. Heraklit hat das oft zitierte Wort gesprochen: ‚Die größeren Schicksale erlangen das größere Los.’ Und er hat gesagt, was das rechte Licht auf diesen Satz wirft: ‚Daß die Menge und die sich weise Dünkenden den Sängern der Völker folgen und die Gesetze um Rat fragen, nicht wissend, daß die Menge schlecht, wenige nur gut, die Besten aber dem Ruhme nachfolgen. ‚Denn,’ fügt er hinzu, ‚es wählen die Besten eins statt allem, den immerwährenden Ruhm der Sterblichen.’ Ruhm war für Heraklit also gerade jenes größere Los, welches das größere Schicksal erlangen kann; sein Trachten nach Ehre war nicht nur das unmittelbare, welches im Blute liegt, sondern ein durch Reflexion und Philosophie begründetes. ‚Der Ruhm’, sagt Lassalle, ‚ist in der Tat das Entgegengesetzte von allem, das Entgegengesetzte gegen die Kategorie des unmittelbaren realen Seins überhaupt und seiner einzelnen Zwecke. Er ist Sein der Menschen in ihrem Nichtsein, eine Fortdauer im Untergang der sinnlichen Existenz selbst, er ist darum erreichte und wirklich gewordene Unendlichkeit des Menschen”, und mit Wärme fügt er hinzu: ‚Wie dies der Grund ist, weshalb der Ruhm seit je die großen Seelen so mächtig ergriffen und über alle kleinen und beschränkten Ziele hinausgehoben hatte, wie das der Grund ist, weshalb Platen von ihm singt, daß er erst annahen kann ‚Hand in Hand mit dem prüfenden Todesengel’, so ist es auch der Grund, weshalb Heraklit in ihm die ethische Realisierung seines spekulativen Prinzips erblickte.’”
Allerdings lag es nicht in Lassalles Natur, sich mit dem Ruhm, der erst Hand in Hand mit dem Todesengel annaht, zu begnügen. Im Gegensatz zu der Heraklitischen Verachtung der Menge war er für den Beifall durchaus nicht unempfindlich und nahm ihn selbst dann, wenn er mehr Höflichkeitsform war, unter Umständen mit fast naiver Genugtuung für die Sache selbst auf. Die Vorliebe für das Pathos, die sich bei Lassalle in so hohem Grade zeigte, deutet in der Regel auf eine Neigung zur Schauspielerei. Ist Lassalle nun auch von einer Dosis davon nicht ganz freizusprechen, so kann man ihn wenigstens nicht anklagen, daß er aus dem, was Brandes „seine unselige Vorliebe für den Lärm und Trommelschall der Ehre, für ihre Pauken und Trompeten” nennt, je einen Hehl gemacht habe. In seinen Schriften, in seinen Briefen tritt sie mit einer Offenheit zutage, die in ihrer Naivetät etwas Versöhnendes hat. Wenn Helene von Rakowitza in ihrer Rechtfertigungsschrift erzählt, daß Lassalle ihr in Bern ausgemalt habe, wie er einst als volkserwählter Präsident der Republik „von sechs Schimmeln gezogen” seinen Einzug in Berlin halten werde, so ist man versucht, entweder an eine Übertreibung der Schreiberin zu glauben, oder anzunehmen, daß Lassalle sich durch Ausmalen einer so verlockenden Zukunft um so fester in dem Herzen seiner Erwählten festzusetzen hoffte. Indes, die bekannte schriftliche „Seelenbeichte” an Sophie von Sontzew beweist, daß es sich bei diesem Zukunftsbild keineswegs nur um die Spielerei einer müßigen Stunde, um den Einfall eines Verliebten handelte, sondern um einen Gedanken, in dem Lassalle selbst sich berauschte, dessen Zauber einen mächtigen Reiz auf ihn ausübte. Er nennt sich – im Jahre 1860 – „das Haupt einer Partei”, in bezug auf das sich „fast unsere ganze Gesellschaft” in zwei Parteien teile, deren eine – ein Teil der Bourgeoisie und das Volk – Lassalle „achtet, liebt, sogar nicht selten verehrt”, für die er „ein Mann von größtem Genie und von einem fast übermenschlichen Charakter ist, von dem sie die größten Taten erwarten”. Die andere Partei – die ganze Aristokratie und der größte Teil der Bourgeoisie – fürchtet ihn „mehr als irgend jemand anders” und haßt ihn daher „unbeschreiblich”. Werde die Frauenwelt dieser aristokratischen Gesellschaft es Sophie von Sontzew nicht verzeihen, daß sie einen solchen Menschen heiratete, so werden auf der andern Seite viele Frauen es ihr nicht verzeihen, daß ein solcher Mensch sie heiratete, „sie eines Glückes halber beneiden, das ihre Verdienste übersteige”. Und „freilich, ich verhehle es Ihnen nicht, es könnte wohl sein, daß, wenn gewisse Ereignisse eintreten, eine Flut von Bewegung, Geräusch und Glanz auf Ihr Leben fallen würde, wenn Sie mein Weib werden.”
So übertrieben alle diese Äußerungen erscheinen, so wenig sie der Wirklichkeit entsprachen zu einer Zeit, wo von einer sozialistisch-demokratischen Partei gar keine Rede war, Lassalle vielmehr gesellschaftlich mit den bürgerlichen Liberalen und Demokraten auf bestem Fuße stand und soeben eine Broschüre veröffentlicht hatte, deren Inhalt mit Aspirationen übereinstimmte, die in Regierungskreisen gehegt wurden, so wohnt ihnen doch eine große subjektive Wahrheit inne – Lassalle selbst glaubte an sie. Lassalle glaubte an die Partei, die in ihm ihr Haupt erblickte, wenn sie auch vorläufig bloß aus ihm bestand und selbst in seinen Ideen noch ein sehr unbestimmtes Dasein führte. Die Partei, das war er – seine Bestrebungen und seine Pläne. Jedes Wort der Anerkennung von seiten seiner Freunde oder aber, was er dafür hielt, war für ihn Bestätigung seiner Mission, und nicht selten nahm er Schmeichelei für aufrichtige Huldigung. Es ist merkwürdig, welcher Widersprüche die menschliche Natur fähig ist. Lassalle war, wie aus den Berichten seiner näheren Bekannten und aus seinen Briefen hervorgeht, mit schmeichelhaften Adjektiven äußerst freigebig, aber sie waren allenfalls Flitterwerk, wenn er sie verschleuderte, von anderen auf ihn selbst angewendet, nahm er sie dagegen leicht für echtes Gold.
So sehr war seine Partei in seiner Vorstellung mit ihm selbst verwachsen, daß, als er später wirklich an der Spitze einer Partei stand, oder wenigstens an der Spitze einer im Entstehen begriffenen Partei, er sie nur aus dem Gesichtswinkel seiner Person zu betrachten vermochte und danach behandelte. Man mißverstehe uns nicht. Es wäre absurd, etwa zu sagen, daß Lassalle den Allgemeinen deutschen Arbeiterverein nur ins Leben rief, um seinem Ehrgeiz zu frönen, daß der Sozialismus ihm nur Mittel, aber nicht Zweck war. Lassalle war überzeugter Sozialist, das unterliegt gar keinem Zweifel. Aber er wäre nicht imstande gewesen, in die sozialistische Bewegung aufzugehen, ihr seine Persönlichkeit – ich sage ausdrücklich nicht sein Leben, aufzuopfern.
Soviel an dieser Stelle hierüber.
Dem griechischen Philosophen folgte ein deutscher Ritter. Kurz nachdem der Heraklit erschienen, vollendete Lassalle ein bereits in Düsseldorf entworfenes historisches Drama und ließ es, nachdem eine anonym eingereichte Bühnenbearbeitung von der Intendantur der Kgl. Schauspiele abgelehnt worden war, 1859 unter seinem Namen im Druck erscheinen.
Daß der „Franz von Sickingen” als Bühnenwerk verfehlt war, hat Lassalle später selbst eingesehen, und er hat als Hauptursache dafür den Mangel an dichterischer Phantasie bezeichnet. In der Tat macht das Drama, trotz einzelner höchst wirkungsvoller Szenen und der gedankenreichen Sprache, im ganzen einen trockenen Eindruck, die Tendenz tritt zu absichtlich auf, es ist zuviel Reflexion da, und es werden vor allem viel zuviel Reden gehalten. Auch ist die Metrik oft von einer erstaunlichen Unbeholfenheit. Brandes erzählt, daß ein Freund Lassalles, den dieser, während er am „Franz von Sickingen” arbeitete, um seinen Rat ersuchte, und der ein bewährter metrischer Künstler gewesen, Lassalle den Vorschlag gemacht habe, er solle das Stück lieber in Prosa schreiben, und man kann Brandes beistimmen, daß ein besserer Rat gar nicht gegeben werden konnte. Denn die Lassallesche Prosa hat wirklich eine Reihe großer Vorzüge, und selbst die stark entwickelte Tendenz, ins Deklamatorische zu verfallen, hätte in einem Drama wie der Sickingen nichts verschlagen. Aber Lassalle ließ sich nicht von seiner Idee abbringen, daß die Versform für das Drama unentbehrlich sei, und so stolpern nicht nur seine Ritter und Helden auf oft recht geschraubten fünffüßigen Jamben einher, selbst die aufständischen Bauern bedienen sich der Stelzen des Blankverses. Eine Ausnahme machen sie nur bei den bekannten Losungsworten:
„Loset, sagt an: Was ist das für ein Wesen?”
„Wir können vor Pfaffen und Adel nicht genesen,”
die denn auch wahrhaft erfrischend wirken.
Indes diese technischen Fragen treten für uns zurück vor der Frage nach Inhalt und Tendenz des Dramas. Lassalle wollte mit dem „Franz von Sickingen” über das historische Drama, wie es Schiller und Goethe geschaffen, einen weiteren Schritt hinaus machen. Die historischen Kämpfe sollten nicht, wie namentlich bei Schiller, nur erst den Boden liefern, auf welchem sich der tragische Konflikt bewegt, während die eigentliche dramatische Handlung sich um rein individuelle Interessen und Geschicke dreht, vielmehr sollten die kulturhistorischen Prozesse der Zeiten und Völker zum eigentlichen Subjekt der Tragödie werden, so daß sich diese nicht mehr um die Individuen als solche dreht, die vielmehr nur die Träger und Verkörperungen der kämpfenden Gegensätze sind, sondern um jene größten und gewaltigsten Geschicke der Nationen selbst – „Schicksale, welche über das Wohl und Wehe des gesamten allgemeinen Geistes entscheiden und von den dramatischen Personen mit der verzehrenden Leidenschaft, welche historische Zwecke erzeugen, zu ihrer eigenen Lebensfrage gemacht werden. „Bei alledem sei es möglich,” meint Lassalle, „den Individuen aus der Bestimmtheit der Gedanken und Zwecke heraus, denen sie sich zuteilen, eine durchaus markige und feste, selbst derbe und realistische Individualität zu geben.” (Vgl. das Vorwort zum Franz von Sickingen.) Ob und inwieweit Lassalle die so gestellte Aufgabe gelöst hat und inwieweit sie überhaupt lösbar ist, unter welchen Voraussetzungen sich die großen Kämpfe der Menschheit und der Völker so in Individuen verkörpern lassen, daß nicht das eine oder das andere, die Größe und umfassende Bedeutung jener Kämpfe oder die lebendige Persönlichkeit der Individuen dabei zu kurz kommt, ist ebenfalls eine Frage, die wir hier unerörtert lassen können. Es genügt, daß Lassalle bei der Durchführung des Dramas von jener Auffassung ausgegangen ist. Und nun zum Stoff des Dramas selbst.
Wie schon der Titel anzeigt, hat es das Unternehmen Franz von Sickingens gegen die deutschen Fürsten zum Mittelpunkt. Sickingen und sein Freund und Ratgeber Ulrich von Hutten sind die Helden des Dramas, und es ist eigentlich schwer zu sagen, wer von beiden das Interesse mehr in Anspruch nimmt, der militärische und staatsmännische oder der theoretische Repräsentant des niederen deutschen Adels. Merkwürdigerweise hat Lassalle nicht in dem ersteren, sondern in dem letzteren sich selbst zu zeichnen versucht. „Lesen Sie mein Trauerspiel,” schreibt er an Sophie von Sontzew. „Alles, was ich Ihnen hier sagen könnte, habe ich Hutten aussprechen lassen. Auch er hatte alle Verleumdungen, alle Arten von Haß, jede Feindseligkeit zu ertragen. Ich habe aus ihm den Spiegel meiner Seele gemacht, und ich konnte dies, da sein Schicksal und das meinige einander vollständig gleich und von überraschender Ähnlichkeit sind.” Es würde selbst Lassalle schwer geworden sein, diese überraschende Ähnlichkeit zu beweisen, namentlich um die Zeit, wo er diesen Brief schrieb. Er führte in Berlin ein luxuriöses Leben, verkehrte mit Angehörigen aller Kreise der besser situierten Gesellschaft und erfreute sich als Politiker nicht entfernt eines ähnlichen Hasses wie der fränkische Ritter, der Urheber der leidenschaftlichen Streitschriften wider die römische Pfaffenherrschaft. Nur in einigen Äußerlichkeiten lassen sich Analogien zwischen Lassalle und Hutten ziehen, aber in diesem Falle kann es weniger darauf ankommen, was tatsächlich war, sondern was Lassalle glaubte und wovon er sich bei seinem Werke geistig leiten ließ. Menschen mit so ausgeprägtem Selbstgefühl sind in der Regel leicht Täuschungen über sich selbst ausgesetzt. Genug, wir haben in dem Hutten des Dramas Lassalle vor uns, wie er um jene Zeit dachte, und die Reden, die er Hutten in den Mund legt, erhalten dadurch für das Verständnis des Lassalleschen Ideenkreises eine besondere Bedeutung.
Hierher gehört namentlich die Antwort Huttens auf die Bedenken des Ökolampadius gegen den geplanten Aufstand:
„Ehrwürd'ger Herr! Schlecht kennt Ihr die Geschichte.
Ihr habt ganz recht, es ist Vernunft ihr Inhalt,”
ein echt Hegelscher Satz,
„Doch ihre Form bleibt ewig – die Gewalt!”
Und dann, als Ökolampadius von der „Entweihung der Liebeslehre durch das Schwert” gesprochen:
„Ehrwürd'ger Herr! Denkt besser von dem Schwert!
Ein Schwert, geschwungen für die Freiheit, ist
Das fleischgewordne Wort, von dem Ihr predigt,
Der Gott, der in der Wirklichkeit geboren.
Das Christentum, es ward durchs Schwert verbreitet,
Durchs Schwert hat Deutschland jener Karl getauft,
Den wir noch heut den Großen staunend nennen.
Es ward durchs Schwert das Heidentum gestürzt,
Durchs Schwert befreit des Welterlösers Grab!
Durchs Schwert aus Rom Tarquinius vertrieben,
Durchs Schwert von Hellas Xerxes heimgepeitscht
Und Wissenschaft und Künste uns geboren.
Durchs Schwert schlug David, Simson, Gideon!
So vor- wie seitdem ward durchs Schwert vollendet
Das Herrliche, das die Geschichte sah,
Und alles Große, was sich jemals wird vollbringen,
Dem Schwert zuletzt verdankt es sein Gelingen!”
Es liegt in den Sätzen „doch ihre – der Geschichte – Form bleibt ewig die Gewalt”, und „daß alles Große, was sich jemals wird vollbringen”, dem Schwert zuletzt sein Gelingen verdanken werde, unzweifelhaft viel Übertreibung. Trotzdem hatte der Hinweis, daß das für die Freiheit geschwungene Schwert das „fleischgewordene Wort” sei, daß, wer die Freiheit erwerben will, bereit sein muß, für sie mit dem Schwert zu kämpfen, seine volle Berechtigung in einer Epoche, wo man in weiten Kreisen der ehemaligen Demokratie sich immer mehr darauf verlegte, alles von der Macht des Wortes zu erwarten. Sehr zeitgemäß, und nicht nur für die damalige Epoche, sind auch die Worte, die Lassalle den alten Balthasar Slör Sickingen im letzten Akt zurufen läßt:
„O, nicht der Erste seid Ihr, werdet nicht
Der Letzte sein, dem es den Hals wird kosten
In großen Dingen schlau zu sein. Verkleidung
Gilt auf dem Markte der Geschichte nicht,
Wo im Gewühl die Völker dich nur an
Der Rüstung und dem Abzeichen erkennen;
Drum hülle stets vom Scheitel bis zur Sohle
Dich kühn in deines eig'nen Banners Farbe.
Dann probst du aus im ungeheuren Streit
Die ganze Triebkraft deines wahren Bodens,
Und stehst und fällst mit deinem ganzen Können!”
Auch der Ausspruch Sickingens:
„Das Ziel nicht zeige, zeige auch den Weg.
Denn so verwachsen ist hienieden Weg und Ziel,
Daß eines sich stets ändert mit dem andern,
Und andrer Weg auch andres Ziel erzeugt”.
ist ein Satz aus dem politischen Glaubensbekenntnis Lassalles. Leider hat er ihn jedoch gerade in der kritischsten Periode seiner politischen Laufbahn unbeachtet gelassen.
Halten wir uns jedoch nicht bei Einzelheiten auf, sondern nehmen wir das Ganze des Dramas, ziehen wir seine Quintessenz.
Die Rolle Huttens und Sickingens in der Geschichte ist bekannt. Sie sind beide Vertreter des spätmittelalterlichen Rittertums, einer um die Zeit der Reformation im Untergehen begriffenen Klasse. Was sie wollen, ist diesen Untergang aufhalten, ein vergebliches Beginnen, das notwendigerweise scheitert und dasjenige, was es verhindern will, nur beschleunigt. Da Hutten wie Sickingen durch Charakter wie Intelligenz ihre Klasse weit überragen, so ist hier in der Tat das Material zu einer echten Tragödie gegeben, der vergebliche Kampf markiger Persönlichkeiten gegen die geschichtliche Notwendigkeit. Merkwürdigerweise wird aber diese Seite der Hutten-Sickingenschen Bewegung im Lassalleschen Drama am wenigsten behandelt, so bedeutungsvoll sie doch gerade für die – wir wollen nicht einmal sagen, sozialistische, sondern überhaupt die moderne wissenschaftliche Geschichtsbetrachtung ist. Im Drama geht das Hutten-Sickingensche Unternehmen an tausend Zufälligkeiten – Unüberlegtheit, Mißgriffe in den Mitteln, Verrat usw. – zugrunde, und Hutten-Lassalle schließt mit den Worten: „Künft'gen Jahrhunderten vermach' ich unsere Rache”, was unwillkürlich an den recht unhistorischen Schluß in Götz von Berlichingen erinnert: „Wehe dem Jahrhundert, das dich von sich stieß! Wehe der Nachkommenschaft, die dich verkennt!” Begreift man aber, warum der junge Goethe im achtzehnten Jahrhundert sich einen Vertreter des untergehenden Rittertums zum Helden wählen konnte, so ist es schon schwerer zu verstehen, wie nahezu hundert Jahre später, zu einer Zeit, wo die Geschichtsforschung bereits ganz andere Gesichtspunkte zur Beurteilung der Kämpfe des Reformationszeitalters eröffnet hatte, ein Sozialist wie Lassalle zwei Vertreter eben dieses Rittertums schlechthin als die Repräsentanten „eines kulturhistorischen Prozesses hinstellt, auf dessen Resultaten”, wie er sich in der Vorrede ausdrückt, „unsere ganze Wirklichkeit lebt”. „Ich wollte,” sagt er an der betreffenden Stelle weiter, „wenn möglich, diesen kulturhistorischen Prozeß noch einmal in bewußter Erkenntnis und leidenschaftlicher Ergreifung durch die Adern alles Volkes jagen. Die Macht, einen solchen Zweck zu erreichen, ist nur der Poesie gegeben – und darum entschloß ich mich zu diesem Drama.”
Nun vertreten allerdings Hutten und Sickingen neben und mit der Sache des Rittertums noch den Kampf gegen die Oberherrschaft Roms und für die Einheit des Reiches, zwei Forderungen, welche ideologisch die des untergehenden Rittertums waren, geschichtlich aber im Interesse der aufkommenden Bourgeoisie lagen, und die denn auch durch die Entwicklung der Verhältnisse in Deutschland nach Überwindung der unmittelbaren Wirkungen des Dreißigjährigen Krieges wieder in den Vordergrund gedrängt und im neunzehnten Jahrhundert in erster Reihe von dem liberalen Bürgertum verfochten wurden. Der deutsche Adel hat sich erst nach der Gründung des neudeutschen Reiches daran erinnert, daß er einmal eine so anständige Persönlichkeit wie Franz von Sickingen hervorgebracht hat – den Hutten kann er noch immer nicht verdauen; in den fünfziger Jahren und noch später feierte der „Gartenlauben”-Liberalismus Hutten und Sickingen als Vorkämpfer der nationalen und Aufklärungsbewegung und ignorierte ihre Klassenbestrebungen.
Genau dasselbe ist im Lassalleschen Drama der Fall. Ulrich von Hutten und Franz von Sickingen kämpfen lediglich um der geistigen Freiheit willen gegen den römischen Antichrist, nur im Interesse der nationalen Sache gegen die Einzelfürsten. „Was wir wollen,” sagt Sickingen im Zwiegespräch mit Hutten, —
„das ist ein ein'ges großes, mächt'ges Deutschland,
Zertrümmerung alles Pfaffenregiments,
Vollständ'ger Bruch mit allem röm'schen Wesen,
Die reine Lehr' als Deutschlands ein'ge Kirche,
Wiedergeburt, zeitmäßige der alten,
Der urgermanischen gemeinen Freiheit,
Vernichtung unsrer Fürstenzwergherrschaft
Und usurpierten Zwischenregiments,
Und machtvoll auf der Zeit gewaltigem Drang
Gestützt, in ihrer Seele Tiefen wurzelnd,
Ein – evangelisch Haupt als Kaiser an der Spitze
Des großen Reichs.”
Und Hutten antwortet: „Treu ist das Bild.”
Da Lassalle ausdrücklich den „Franz von Sickingen” als ein Tendenzdrama bezeichnet, so haben wir in ihm einen Beleg für die Wandlung, die sich in ihm in bezug auf seine – vorläufig ideale – Stellungnahme zu den politischen Strömungen der Zeit vollzogen. Es sollte indes gar nicht lange dauern, bis sich diese Wandlung, eine Annäherung an die Auffassungsweise der norddeutschen bürgerlichen Demokratie, auch gegenüber einer konkreten Frage des Tages offenbaren sollte3.
Der „Franz von Sickingen” war im Winter 1857/58 vollendet worden. Lassalle hatte ihn, wie er an Marx schreibt, bereits entworfen und begonnen, während er noch am Heraklit arbeitete. Es sei ihm ein Bedürfnis gewesen, sich zeitweilig aus der abstrakten Gedankenwelt, in die er sich bei jener Arbeit „einspintisieren” mußte, mit einem Gegenstand zu beschäftigen, der in direkterer Beziehung zu den großen Kämpfen der Menschheit stand. Daher habe er nebenbei Mittelalter und Reformationszeit studiert und sich an den Werken und dem Leben Ulrich von Huttens „berauscht”, als ihn die Lektüre eines gerade erschienenen elenden „modernen” Dramas auf den Gedanken brachte: Das – der Kampf Huttens – wäre ein Stoff, der Behandlung wert. So habe er ohne ursprünglich an sich als ausführenden Dichter zu denken, den Plan des Dramas entworfen, wurde sich aber alsbald klar, daß er es auch selbst fertig machen müsse. Es sei „wie eine Eingebung” über ihn gekommen. Man spürt es dem Drama auch an, daß es mit warmem Herzblut geschrieben wurde. Trotz der oben bezeichneten Fehler erhebt es sich, dank seines geistigen Gehalts, immer noch himmelhoch über die ganze Dramenliteratur jener Zeit. Es hätte es keiner der deutschen Dichter damals besser gemacht als Lassalle.
1
Auf Vorgänge, die mit Führung und Ausgang des Hatzfeldt-Prozesses in Verbindung stehen, bezieht sich ein Teil der Anklagen, welche im Jahre 1855 eine von Düsseldorf, dem damaligen Wohnort Lassalles, nach London entsandte Deputation rheinischer Sozialisten bei Karl Marx und Freiligrath gegen Lassalle erhob und die auf diese beiden, wie Marx an Engels schrieb, einen entscheidenden Eindruck machten.
2
G. Brandes, Ferdinand Lassalle. Ein literarisches Charakterbild. Berlin 1877.
3
Das Vorstehende war seinerzeit gerade geschrieben, als ich durch die Freundlichkeit von Friedrich Engels die im Nachlaß von Karl Marx vorgefundenen Briefe Lassalles an Karl Marx erhielt, die seitdem von Franz Mehring herausgegeben sind (Stuttgart, J. H. W. Dietz Nachfolger). Ein vom 7. Mai 1859 datierter, an Marx und Engels adressierter Brief handelt bis auf wenige Zeilen ausschließlich vom „Franz von Sickingen”. Lassalle hatte von dem Drama, sobald es im Druck erschienen, je ein Exemplar an Karl Marx und Friedrich Engels geschickt, worauf ihm diese, die damals noch örtlich getrennt lebten, eingehend ihre Urteile über es mitteilten, und der erwähnte Brief Lassalles ist dessen Antwort auf diese Urteile. Er verbindet sie in einem und demselben Schreiben, weil, wie er sich ausdrückt, „Eure beiderseitigen Einwürfe, ohne geradezu identisch zu sein, doch in der Hauptsache dieselben Punkte berühren”.
Aus dem Lassalleschen Schreiben geht hervor, daß die Kritik von Marx wie Engels eben die Punkte betrifft, die auch ich im obigen kritisieren zu müssen glaubte. „Ihr stimmt beide darin überein,” schreibt Lassalle an einer Stelle, „daß auch Sickingen noch zu abstrakt gezeichnet ist.” In diesem Satze ist in nuce dasselbe gesagt, was ich oben ausgeführt habe. Der Lassallesche Sickingen ist nicht der streitbare Ritter der ersten Jahrzehnte des sechzehnten Jahrhunderts, er ist der in des letzteren Rüstung gesteckte Liberale des neunzehnten Jahrhunderts, das heißt der liberale Ideologe. Seine Reden fallen gewöhnlich vollständig aus der Epoche, in der sie gehalten sein sollen, heraus. „Ihr begegnet Euch Beide”, schreibt Lassalle an einer andern Stelle, „daß ich die Bauernbewegung ‚zu sehr zurückgesetzt’, ‚nicht genug hervorgehoben habe’. Du (Marx) begründest dies so: Ich hätte Sickingen und Hutten daran untergehen lassen müssen, daß sie, wie der polnische Adel etwa, nur in ihrer Einbildung revolutionär waren, in der Tat aber ein reaktionäres Interesse vertraten. ‚Die adligen Repräsentanten der Revolution’, sagst Du, ‚hinter deren Stichwörtern von Einheit und Freiheit immer noch der Traum des alten Kaiserthums und des Faustrechts lauert – durften dann nicht so alles Interesse absorbiren, wie sie es bei Dir thun, sondern die Vertreter der Bauern, namentlich dieser, und der revolutionären Elemente in den Städten mußten einen ganz bedeutend aktiveren Hintergrund bilden. Du hättest dann auch in viel höherem Grade gerade die modernsten Ideen in ihrer naivsten Form sprechen lassen können, während jetzt in der That, außer der religiösen Freiheit, die bürgerliche Einheit die Hauptidee bleibt’. ‚Bist Du nicht selbst’, rufst Du aus, ‚gewissermaßen wie Dein Franz von Sickingen in den diplomatischen Fehler gefallen, die lutherisch-ritterliche Opposition über die plebejisch-bürgerliche zu stellen?’”
Ich habe aus diesem Zitat die Lassalleschen Zwischenbemerkungen fortgelassen, weil sie sich meist auf im Brief vorhergehende Ausführungen beziehen, hier also unverständlich wären. Im wesentlichen verteidigt sich Lassalle damit, daß er nachzuweisen sucht, die ritterliche Beschränktheit, soweit sie überhaupt im historischen Sickingen vorhanden, damit genügend zum Ausdruck gebracht zu haben, daß Sickingen, statt sich an die ganze Nation zu wenden, statt alle revolutionären Kräfte im Reich zum Aufstand aufzurufen und sich an ihre Spitze zu stellen, seinen Aufstand als einen ritterlichen beginnt und fortführt, bis er an der Beschränktheit seiner ritterlichen Mittel zugrunde geht. Gerade darin, daß Sickingen unterliegt, weil er nicht weit genug gegangen, liege die tragische und zugleich die revolutionäre Idee des Dramas. Der Bauernbewegung aber habe er in der einen Szene des Stückes, in der er die Bauern selbst auf die Bühne bringe, und in den verschiedenen Hinweisen auf sie in den Reden Balthasars usw., vollauf die Bedeutung zugeschrieben, welche ihr in Wirklichkeit innegewohnt habe und noch darüber hinaus. Geschichtlich sei die Bauernbewegung ebenso reaktionär gewesen, wie die des Adels.
Die letztere Auffassung hat Lassalle bekanntlich auch in verschiedenen seiner späteren Schritten verfochten, so u. a. im „Arbeiterprogramm”. Sie ist aber m. E. keineswegs richtig. Daß die Bauern mit Forderungen auftraten, die auf die Vergangenheit zurückgriffen, stempelt ihre Bewegung noch zu keiner reaktionären, die Bauern waren zwar keine neue Klasse, aber sie waren keineswegs, wie die Ritter, eine untergehende Klasse. Das Reaktionäre in ihren Forderungen ist nur formell, nicht das Wesentliche. Das übersieht Lassalle, der als Hegelianer hier wieder in den Fehler verfällt, die Geschichte aus den „Ideen” abzuleiten, so vollständig, daß er zu der Marxschen Bemerkung: „Du hättest dann auch in viel höherem Grade gerade die modernsten Ideen in ihrer naivsten Form sprechen lassen können”, ein doppeltes Fragezeichen, verstärkt durch ein Ausrufungszeichen, macht.
Der andere Teil seiner Verteidigung hätte dann seine Berechtigung, wenn im Stück auch nur die leiseste Andeutung gegeben wäre, daß Sickingens Beschränkung auf seine ritterlichen Mittel seiner ritterlichen Beschränktheit geschuldet war. Das ist aber nicht der Fall. Im Stück wird sie lediglich als ein taktischer Fehler behandelt. Das reicht aus für die tragische Idee des Dramas, aber nicht für die Veranschaulichung des historischen Anachronismus, an dem das Sickingensche Unternehmen in Wirklichkeit zugrunde gegangen ist.