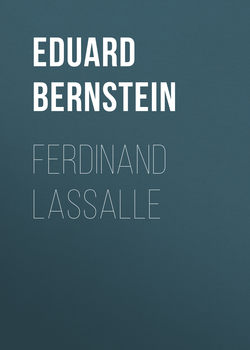Читать книгу Ferdinand Lassalle - Bernstein Eduard, Eduard Bernstein - Страница 4
Ferdinand Lassalle und der italienische Krieg
ОглавлениеAnfang 1859 erschien der „Franz von Sickingen” als Buchdrama. Gerade als er herauskam, stand Europa am Vorabend eines Krieges, der auf die Entwicklung der Dinge in Deutschland eine große Rückwirkung ausüben sollte. Es war der bereits im Sommer 1858 zwischen Louis Napoleon und Cavour in Plombières verabredete französisch-sardinische Feldzug behufs Losreißung der Lombardei von Österreich und der Beseitigung der österreichischen Oberherrschaft in Mittelitalien.
Österreich gehörte damals zum deutschen Bund, und so erhob sich natürlich die Frage, welche Haltung die übrigen Bundesstaaten in diesem Streit einnehmen sollten. Sei es Pflicht des übrigen Deutschland, sich gegenüber Frankreich mit Österreich zu identifizieren oder nicht?
Die Beantwortung der Frage war dadurch erschwert, daß der Krieg einen zwieschlächtigen Charakter trug. Für die ihn betreibenden Italiener war er ein nationaler Befreiungskampf, der die Sache der Einigung und Befreiung Italiens einen Schritt vorwärts bringen sollte. Von seiten Frankreichs dagegen war er ein Kabinettskrieg, unternommen, um die Herrschaft des bonapartistischen Regimes in Frankreich zu stärken und die Machtstellung Frankreichs in Europa zu erhöhen. Soviel stand auf jeden Fall fest. Außerdem pfiffen es die Spatzen von den Dächern, daß Napoleon sich von seinem Verbündeten, dem König von Sardinien, für seine Bundesgenossenschaft einen hübschen Kaufpreis in Gebietsabtretungen (Nizza und Savoyen) ausbedungen hatte und daß die „Einigung” Italiens in jenem Moment nur soweit stattfinden sollte, als sich mit den Interessen des bonapartistischen Kaiserreichs vertrug. Aus diesem Grunde denunzierte z. B. ein so leidenschaftlicher italienischer Patriot wie Mazzini bereits Ende 1858 den in Plombières zwischen Napoleon und Cavour abgeschlossenen Geheimvertrag als eine bloße dynastische Intrige. Soviel war sicher, daß, wer diesen Krieg unterstützte, zunächst Napoleon III. und dessen Pläne unterstützte.
Napoleon III. brauchte aber Unterstützung. Gegen Österreich allein konnte er im Bunde mit Sardinien den Krieg aufnehmen, kamen aber die übrigen Staaten des Deutschen Bundes und namentlich Preußen Österreich zu Hilfe, so stand die Sache wesentlich bedenklicher. So ließ er denn durch seine Agenten und Geschäftsträger bei den deutschen Regierungen, in der deutschen Presse und unter den deutschen Parteiführern mit allen Mitteln dagegen agitieren, daß der Krieg als eine Sache behandelt werde, die Deutschland etwas angehe. Was habe das deutsche Volk für ein Interesse, die Gewaltherrschaft, die Österreich in Italien ausübe, aufrechtzuerhalten, überhaupt einem so urreaktionären Staat wie Österreich Hilfe zu leisten? Österreich sei der geschworene Feind der Freiheit der Völker; werde Österreich zertrümmert, so würde auch für Deutschland ein schönerer Morgen anbrechen.
Auf der anderen Seite entwickelten die österreichischen Federn, daß, wenn die Napoleonischen Pläne im Süden sich verwirklichten, der Rhein in direkte Gefahr geriete. Ihm würde der nächste Angriff gelten. Wer das linke Rheinufer vor Frankreichs gierigen Händen sicherstellen wolle, müsse dazu beitragen, daß Österreich seine militärischen Positionen in Oberitalien unbeeinträchtigt erhalte, der Rhein müsse am Po verteidigt werden.
Die von den napoleonischen Agenten ausgegebene Parole stimmte in vielen wesentlichen Punkten mit dem Programm der kleindeutschen Partei (Einigung Deutschlands unter Preußens Spitze, unter Hinauswerfung Österreichs aus dem deutschen Bund) überein, war direkt auf es zugeschnitten. Trotzdem konnten sich eine große Anzahl kleindeutscher Politiker nicht dazu entschließen, gerade in diesem Zeitpunkt die Sache Österreichs von der des übrigen Deutschland zu trennen. Dies erschien ihnen um so weniger zulässig, als es weiterhin bekannt war, daß Napoleon den Krieg im Einvernehmen mit der zarischen Regierung in Petersburg führte, dieser also den weiteren Zweck hatte, den russischen Intrigen im Südosten Europas Vorschub zu leisten. Vielmehr ging ihre Meinung dahin, jetzt käme es vor allen Dingen darauf an, den Angriff Napoleons abzuschlagen. Erst wenn das geschehen sei, könne man weiter reden. Bis es geschehen, müßten sich aber die Italiener gefallen lassen, daß man sie, solange sie unter der Schutzherrschaft Bonapartes kämpften, einfach als dessen Verbündete behandelte.
Es läßt sich nun nicht leugnen, daß man vom kleindeutschen Standpunkt aus auch zu einer andern Auffassung der Situation gelangen, in der vorentwickelten Gedankenreihe eine Inkonsequenz erblicken konnte. Wenn Österreich, und namentlich dessen außerdeutsche Besitzungen, um so eher je besser aus dem Deutschen Bund hinausgeworfen werden sollten, warum nicht mit Vergnügen ein Ereignis begrüßen, das sich als ein Schritt zur Verwirklichung dieses Programms darstellte? Hatte nicht Napoleon erklärt, daß er nur Österreich und nicht Deutschland bekriege? Warum also Österreich gegen Frankreich beistehen, zumal man dadurch gezwungen werde, auch die Italiener zu bekriegen, die doch für die gerechteste Sache von der Welt kämpften? Warum den Rhein verteidigen, ehe er angegriffen, ehe auch nur eine Andeutung gefallen, daß ein Angriff auf ihn beabsichtigt sei? Warum nicht lieber die Verlegenheit Österreichs und die Beschäftigung Napoleons in Italien benutzen, um die Sache der Einigung Deutschlands unter Preußens Führung auch durch positive Maßnahmen einen weiteren Schritt zu fördern?
Dieser – es sei wiederholt – vom kleindeutschen Standpunkt aus konsequenteren Politik spricht Lassalle in seiner, Ende Mai 1859 erschienenen Schrift „Der Italienische Krieg und die Aufgabe Preußens” das Wort. Mit großer Energie bekämpft er die in den beiden Berliner Organen des norddeutschen Liberalismus, der „National-Zeitung” und der „Volks-Zeitung”, – in der ersteren unter anderm auch von Lassalles nachmaligem Freunde, Lothar Bucher – verfochtene Ansicht, einem von Bonaparte ausgehenden Angriff gegenüber müsse Preußen Österreich als Bundesgenosse zur Seite stehen, und fordert er dagegen, daß Preußen den Moment benutzen solle, den deutschen Kleinstaaten gegenüber seine deutsche Hegemonie geltend zu machen und, wenn Napoleon die Karte Europas im Süden nach dem Prinzip der Nationalitäten revidiere, dasselbe im Namen Deutschlands im Norden zu tun, wenn jener Italien befreie, seinerseits Schleswig-Holstein zu nehmen. Jetzt sei der Moment gekommen, „während die Demolierung Österreichs sich schon von selbst vollzieht, für die Erhöhung Preußens in der Deutschen Achtung zu sorgen”. Und, fügt Lassalle schließlich hinzu, „möge die Regierung dessen gewiß sein. In diesem Kriege, der ebensosehr ein Lebensinteresse des deutschen Volks als Preußens ist, würde die deutsche Demokratie selbst Preußens Banner tragen und alle Hindernisse vor ihm zu Boden werfen mit einer Expansivkraft, wie ihrer nur der berauschende Ausbruch einer nationalen Leidenschaft fähig ist, welche seit fünfzig Jahren komprimiert in dem Herzen eines großen Volkes zuckt und zittert.”
Man hat Lassalle später auf Grund dieser Broschüre zu einem Advokaten der „deutschen” Politik Bismarcks zu stempeln gesucht, und es läßt sich nicht bestreiten, daß das in ihr entwickelte nationale Programm als solches eine große Ähnlichkeit mit dem des im Sommer 1859 gegründeten Nationalvereins und ebenso, mutatis mutandis, mit der Politik hat, die Bismarck bei der Verwirklichung der deutschen Einheit unter preußischer Spitze befolgte. Lassalle war eben bei all seinem theoretischen Radikalismus in der Praxis noch ziemlich stark im Preußentum stecken geblieben. Nicht daß er bornierter preußischer Partikularist gewesen wäre – wir werden gleich sehen, wie weit er davon entfernt war – , aber er sah die nationale Bewegung und die auf die auswärtige Politik bezüglichen Angelegenheiten im wesentlichen durch die Brille des preußischen Demokraten an, sein Haß gegen Österreich war in dieser Hinsicht ebenso übertrieben, wie der Preußenhaß vieler süddeutscher Demokraten und selbst Sozialisten. Österreich ist ihm „der kulturfeindlichste Staatsbegriff, den Europa aufzuweisen hat”, er möchte „den Neger kennen lernen, der, neben Österreich gestellt, nicht ins Weißliche schimmerte”; Österreich ist „ein reaktionäres Prinzip”, der „gefährlichste Feind aller Freiheitsideen”; „der Staatsbegriff Österreich” muß „zerfetzt, zerstückt, vernichtet, zermalmt – in alle vier Winde zerstreut werden”, jede politische Schandtat, die man Napoleon III. vorwerfen könne, habe Österreich auch auf dem Gewissen, und „wenn die Rechnung sonst ziemlich gleichstehen möchte – das römische Konkordat hat Louis Napoleon trotz seiner Begünstigung des Klerus nicht geschlossen”. Selbst Rußland kommt noch besser weg, als Österreich. „Rußland ist ein naturwüchsig-barbarisches Reich, welches von seiner despotischen Regierung soweit zu zivilisieren gesucht wird, als mit ihren despotischen Interessen verträglich ist. Die Barbarei hat hier die Entschuldigung, daß sie nationales Element ist.” Ganz anders aber mit Österreich. „Hier vertritt, im Gegensatz zu seinen Völkern, die Regierung das barbarische Prinzip, künstlich und gewaltsam seine Kulturvölker unter dasselbe beugend.”
In dieser einseitigen und relativ – d. h. wenn man die übrigen Staaten in Vergleich zieht – damals auch übertriebenen Schwarzmalerei Österreichs und auch sonst in verschiedenen Punkten, begegnet sich die Lassallesche Broschüre mit einer Schrift, die schon einige Wochen vor ihr erschienen war und ebenfalls die Tendenz hatte, die Deutschen zu ermahnen, Napoleon in Italien, solange er den Befreier spiele, freie Hand zu lassen und der Zertrümmerung Österreichs zu applaudieren. Es war dies die Schrift Karl Vogts „Studien zur gegenwärtigen Lage Europas”, ein die bonapartistischen Schlagworte wiedergebendes und direkt oder indirekt auch auf bonapartistischen Antrieb geschriebenes Buch. Ich würde Anstand genommen haben, diese Schrift in irgendeinem Zusammenhange mit der Lassalleschen zu zitieren, indes Lassalle ist so durchaus über jeden Verdacht der Komplizität mit Vogt oder dessen Einbläsern erhaben, daß die Möglichkeit absolut ausgeschlossen ist, durch den Vergleich, der mir aus sachlichen Gründen notwendig erscheint, ein falsches Licht auf Lassalle zu werfen. Zum Überfluß will ich aber noch einen Passus aus der Vorrede zum „Herr Vogt” von Karl Marx hierhersetzen, jener Schrift, die den Beweis lieferte, daß Vogt damals im bonapartistischen Interesse schrieb und agitierte, und deren Beweisführung neun Jahre später durch die in den Tuilerien vorgefundenen Dokumente bestätigt wurde – ein Passus, der schon deshalb hierher gehört, weil er zweifelsohne gerade auch auf Lassalle sich bezieht. Marx schreibt:
„Von Männern, die schon vor 1848 miteinander darin übereinstimmten, die Unabhängigkeit Polens, Ungarns und Italiens nicht nur als ein Recht dieser Länder, sondern als das Interesse Deutschlands und Europas zu vertreten, wurden ganz entgegengesetzte Ansichten aufgestellt über die Taktik, die Deutschland bei Gelegenheit des italienischen Krieges von 1859 Louis Bonaparte gegenüber auszuführen habe. Dieser Gegensatz entsprang aus gegensätzlichen Urteilen über tatsächliche Voraussetzungen, über die zu entscheiden einer späteren Zeit vorbehalten bleibt. Ich für meinen Teil habe es in dieser Schrift nur mit den Ansichten Vogts und seiner Klique zu tun. Selbst die Ansicht, die er zu vertreten vorgab, und in der Einbildung eines urteilslosen Haufens vertrat, fällt in der Tat außerhalb der Grenzen meiner Kritik. Ich behandle die Ansichten, die er wirklich vertrat.” (K. Marx „Herr Vogt”. Vorwort V, VI.)
Trotzdem war es natürlich nicht zu vermeiden, daß dort, wo Vogt mit Argumenten operiert, die sich auch bei Lassalle finden, dieser in der Marxschen Schrift mitkritisiert wird, was übrigens Lassalle nicht verhindert hat, in einem Briefe an Marx vom 19. Januar 1861 zu erklären, daß er nach der Lektüre des „Herr Vogt” Marx' Überzeugung, daß Vogt von Bonaparte bestochen sei, „ganz gerechtfertigt und in der Ordnung” finde, der innere Beweis dafür4 sei „mit einer immensen Evidenz geführt”. Das Buch sei „in jeder Hinsicht ein meisterhaftes Ding”.
Jedenfalls ist der „Herr Vogt” ein äußerst instruktives Buch zum Verständnis der Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts; dieses Pamphlet enthält eine Fülle von geschichtlichem Material, das zu einem ganzen Dutzend Abhandlungen ausreichen würde.
Für unsere Betrachtung hat es aber noch ein besonderes Interesse.
Die Korrespondenz zwischen Marx und Lassalle war zu keiner Zeit so lebhaft, als in den Jahren 1859 und 1860, und ein großer Teil davon handelt eben von dem italienischen Krieg und der ihm gegenüber einzunehmenden Haltung. Ob die Briefe Marx' hierüber an Lassalle noch erhalten sind und wenn, in welchen Händen sie sich befinden, ist bis jetzt nicht bekannt, noch ob der jetzige Besitzer sie zu veröffentlichen bereit ist. Aus den Lassalleschen Briefen ist jedoch die Stellung, die Marx damals einnahm, nur unvollkommen zu ersehen, und noch weniger ihre Begründung, da sich Lassalle, wie übrigens ganz natürlich, meist darauf beschränkt, seine Stellungnahme zu motivieren und die Einwände gegen dieselbe möglichst zu widerlegen. Es braucht aber wohl nicht des weiteren dargelegt zu werden, warum in einer für Sozialisten geschriebenen Abhandlung über Lassalle nicht nur dessen persönliche Beziehung zu den Begründern des modernen wissenschaftlichen Sozialismus, sondern auch sein Verhältnis zu ihrer theoretischen Doktrin und zu ihrer Behandlung der politischen und sozialen Fragen von besonderem Interesse ist.
Der Tagesliterat hatte in bezug auf dieses Verhältnis lange Zeit seine fertige Schablone. Für die Politik im engeren Sinne des Wortes lautete sie: Lassalle war national, Marx und Engels waren in jeder Hinsicht international, Lassalle war deutscher Patriot, Marx und Engels waren vaterlandslos, sie haben sich immer nur um die Weltrepublik und die Revolution gekümmert, was aus Deutschland wurde, war ihnen gleichgültig.
Seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieser Schrift hat jene Gegenüberstellung aufgegeben werden müssen.
Noch ehe Lassalles „Italienischer Krieg” erschien, war in demselben Verlage, wie später diese, eine Broschüre erschienen, die dasselbe Thema behandelte. Sie war betitelt: „Po und Rhein.” Der Verfasser, der sich ebensowenig nannte, wie Lassalle in der ersten Auflage seiner Schrift, suchte militärwissenschaftlich nachzuweisen, daß die von den Organen der österreichischen Regierung ausgegebene Parole, Deutschland bedürfe zu seiner Verteidigung im Südwesten der italienischen Provinzen, falsch sei, daß auch ohne diese Deutschland noch eine starke Defensivposition in den Alpen habe, namentlich sobald ein einheitliches und unabhängiges Italien geschaffen sei, da ein solches kaum je einen triftigen Grund, mit Deutschland zu hadern, wohl aber häufig genug Anlaß haben werde, Deutschlands Bundesgenossenschaft gegen Frankreich zu suchen. Oberitalien sei ein Anhängsel, das Deutschland höchstens im Kriege nutzen, im Frieden immer nur schaden könne. Und auch der militärische Vorteil im Kriege würde erkauft durch die geschworene Feindschaft von 25 Millionen Italienern. Aber, führte der Verfasser alsdann aus, die Frage um den Besitz dieser Provinzen ist eine zwischen Deutschland und Italien, und nicht eine zwischen Österreich und Louis Napoleon. Gegenüber einem Dritten, einem Napoleon, der um seiner eigenen, in anderer Beziehung anti-deutschen Interessen willen sich einmischte, handle es sich um die einfache Behauptung einer Provinz, die man nur gezwungen abtritt, einer militärischen Position, die man nur räumt, wenn man sie nicht mehr halten kann … „Werden wir angegriffen, so wehren wir uns.” Wenn Napoleon als Paladin der italienischen Unabhängigkeit auftreten wolle, so möge er erst bei sich anfangen und den Italienern Korsika abtreten, dann werde man sehen, wie ernst es ihm ist. Solle aber die Karte von Europa revidiert werden, „so haben wir Deutsche das Recht, zu fordern, daß es gründlich und unparteiisch geschehe, und daß man nicht, wie es beliebte Mode ist, verlange, Deutschland allein solle Opfer bringen.” „Das Endresultat dieser ganzen Untersuchung aber ist,” heißt es schließlich, „daß wir Deutsche einen ganz ausgezeichneten Handel machen würden, wenn wir den Po, den Mincio, die Etsch und den ganzen italienischen Plunder vertauschen könnten gegen die Einheit … die allein uns nach innen und außen stark machen kann.”
Der Verfasser dieser Broschüre war kein anderer als – Friedrich Engels. Unnütz zu sagen, daß Engels sie im Einverständnis mit Karl Marx veröffentlicht hatte. Den Verleger hatte Lassalle besorgt. Lassalle hatte auch, wie aus einem seiner Briefe hervorgeht, eine Besprechung ihres Inhalts an die – damals noch unabhängige – Wiener „Presse” geschickt, deren Redakteur mit ihm verwandt war. Er kannte also ihren Inhalt ganz genau, als er seinen „Italienischen Krieg” schrieb, polemisiert somit auch gegen sie, wenn er die Ansicht bekämpft, daß, da der Krieg durch Napoleons Führung aus einem Befreiungskrieg in ein gegen Deutschland gerichtetes Unternehmen verwandelt sei, das notgedrungen mit einem Angriff auf den Rhein enden werde, er auch deutscherseits nur als solches zu behandeln sei. Auf der andern Seite wird, wie schon erwähnt, Lassalles Schrift im „Herr Vogt” mitkritisiert, und zwar in dem Abschnitt VIII „Dâ-dâ-Vogt und seine Studien”5.
Wie sehr die Darlegungen Lassalles oft mit den Vogtschen übereinstimmten, dafür nur ein Beispiel. Österreichischerseits war auf die Verträge von 1815 hingewiesen worden, durch welche Österreich der Besitz der Lombardei garantiert worden war. Darauf antworten nun:
Hören wir nun Marx gegen Vogt:
„Nikolaus natürlich vernichtete Konstitution und Selbständigkeit des Königreich Polen, durch die Verträge von 1815 garantiert, aus ‚Achtung’ vor den Verträgen von 1815. Rußland achtete nicht minder die Integrität Krakaus, als es die freie Stadt im Jahre 1831 mit moskowitischen Truppen besetzte. Im Jahre 1836 wurde Krakau wieder besetzt von Russen, Österreichern und Preußen, wurde völlig als erobertes Land behandelt und appellierte noch im Jahre 1840, unter Berufung auf die Verträge von 1815, vergebens an England und Frankreich. Endlich am 22. Februar 1846 besetzten Russen, Österreicher und Preußen abermals Krakau, um es Österreich einzuverleiben. Der Vertragsbruch geschah durch die drei nordischen Mächte, und die österreichische Konfiskation von 1846 war nur das letzte Wort des russischen Einmarsches von 1831.” („Herr Vogt”, S. 73/74.) In einer Note weist dann Marx noch auf sein Pamphlet „Palmerston and Poland” hin, wo nachgewiesen sei, daß Palmerston seit 1831 ebenfalls an der Intrige gegen Krakau mitgearbeitet habe. Indes das letztere ist eine Frage, die uns hier nicht weiter interessiert, wohl aber interessiert uns der andere Nachweis bei Marx, daß Vogt auch mit der Verweisung auf das Beispiel Krakaus nur eine von bonapartistischer Seite ausgehende Argumentation ab- und umschrieb. In einem der Anfang 1859 bei Dentu in Paris herausgekommenen bonapartistischen Pamphlete, „La vraie question, France, – Italie – Autriche”, hatte es wörtlich geheißen:
„Mit welchem Rechte übrigens würde die österreichische Regierung die Unverletzbarkeit der Verträge von 1815 anrufen, sie, welche dieselben verletzt hat durch die Konfiskation von Krakau, dessen Unabhängigkeit diese Verträge garantierten?”
Vogt hatte in seiner Manier überall noch einen Extratrumpf aufgesetzt. Phrasen wie „die einzige Regierung”, „in frecher Weise”, „frevelnde Hand” sind sein Eigentum. Ebenso wenn er am Schluß des obenzitierten Satzes pathetisch die „politische Nemesis” gegen Österreich anruft.
Lassalle hatte, als er seine Broschüre schrieb, das Vogtsche Machwerk noch nicht zu Gesicht bekommen, aber daß seine Schrift durch die von Bonaparte ausgegebenen und durch tausend Kanäle in die Presse des In- und Auslandes lancierten Schlagworte beeinflußt war, das unterliegt nach diesem Beispiel, dem noch eine ganze Reihe ähnlicher an die Seite gesetzt werden können, gar keinem Zweifel. Wenn die nationalliberalen Bismarckanbeter sich später darauf beriefen, daß die Politik ihres Heros sogar die Sanktion Lassalles erhalten habe, so übersahen sie dabei nur die eine Tatsache, daß das von Lassalle der preußischen Regierung vorgehaltene Programm, wie immer es von Lassalle selbst gemeint war, in den entscheidenden Punkten dem Programm glich, das Bonaparte zu jener Zeit den deutschen Patrioten vorsetzen ließ, um sie für seine damalige Politik zu gewinnen. Alle die Ausführungen Lassalles in dieser Schrift, die später von bürgerlichen Schriftstellern als ungewöhnliche Vorhersagungen bezeichnet worden sind, finden sich auch in Vogts „Studien” und andern aus bonapartistischen Quellen gespeisten Pamphleten. Gerade Vogt wußte z. B. schon im Jahre 1859, also noch vor der preußischen Heeresreform, daß, wenn Preußen einen deutschen Bürgerkrieg für die Herstellung einer einheitlichen deutschen Zentralgewalt ins Werk setzen würde, dieser Krieg „nicht so viel Wochen kosten würde, als der italienische Feldzug Monate.” („Studien” S. 155.) Des weiteren wußte Vogt, daß das Berliner Kabinett Österreich im Stich lassen werde, es mußte nach ihm „dem Kurzsichtigsten” klar geworden sein, daß ein Einverständnis zwischen Preußens Regierung und der kaiserlichen Regierung Frankreichs besteht; daß Preußen nicht zur Verteidigung der außerdeutschen Provinzen Österreichs zum Schwerte greifen … jede Teilnahme des Bundes oder einzelner Bundesglieder für Österreich verhindern wird, um … seinen Lohn für diese Anstrengungen in norddeutschen Flachlanden zu erhalten. („Studien” S. 19.) Mehr Vorhersagungen kann man wirklich von einem Propheten nicht verlangen.
4
Daß Vogt verdächtig war, hatte Lassalle, der ursprünglich Vogt in Schutz genommen, schon früher zugegeben.
5
Desgleichen auch in einer zweiten Broschüre von Engels „Savoyen, Nizza und der Rhein”. Lassalle hatte in seiner Broschüre die Annexion Savoyens an Frankreich als eine ganz selbstverständliche und, wenn Deutschland eine dieser Vergrößerung aufwiegende Kompensation erhielte, „ganz unanstößige” Sache hingestellt. Engels weist nun nach, welche außerordentlich starke militärische Position der Besitz Savoyens Frankreich Italien und der Schweiz gegenüber verschaffe, was doch auch in Betracht zu ziehen war. Sardinien gab Savoyen preis, weil es im Moment mehr dafür eintauschte, die Schweizer waren aber durchaus nicht erbaut von dem Handel, und ihre Staatsmänner, Stämpfli, Frey-Herosé u. a., taten ihr möglichstes, die Überlieferung des bisher neutralen Savoyer Gebiets in französische Hände zu verhindern. Im „Herr Vogt” kann man nachlesen, durch welche Manöver die bonapartistischen Agenten in der Schweiz jene Bemühungen hintertrieben. Alles übrige sagt ein einfacher Blick auf die Landkarte.