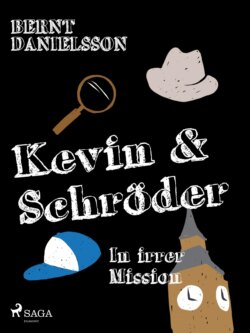Читать книгу In irrer Mission - Bernt Danielsson - Страница 4
2 El Apparillo
ОглавлениеIch holte einen Spaten, der an der Garagenwand lehnte und nahm die zerschlissenen Gartenhandschuhe, die auf dem Griff lagen. Ich klemmte den Spaten unter den Arm, zog die Handschuhe an und lief zum Blumenbeet unten am Zaun zum Nachbargrundstück, direkt hinter dem größten Apfelbaum.
Im Dunkeln konnte ich die Blumen zwar nicht sehen, aber ich hörte deutlich, dass ich sie niedertrampelte, als ich über die kleine, sorgfältig angelegte Kieselsteinmauer rund um das Blumenbeet stieg. Ich stieß den Spaten brutal in die Erde und fing an zu graben.
Schröder kam angerannt. „Wo zum Teufel bist du denn?“, murmelte er und fluchte, als ihm ein paar Apfelbaumzweige ins Gesicht schlugen.
„Hier.“
„Vielen Dank für die äußerst brauchbare Information, vielen Dank. Sie ist in dieser Stockdunkelheit von großer Hilfe. Ihr müsst diesen verdammten Apfelbaum beschneiden. Oder am besten gleich umsägen. Wie kann man das bloß die helle Jahreszeit nennen? Es ist ja so dunkel wie im Dezember, verdammt. Und auch nicht sehr warm, aber trotzdem irgendwie drückend. Es würde mich nicht wundern, wenn es heute Nacht noch ein Gewitter gäbe. Verdammt.“
Plötzlich stand er direkt neben mir.
„Aber was zum Teufel hast du denn vor, Kevin?“
Das war eine gute Frage. Es war eine sehr gute Frage: Was hatte ich eigentlich vor?
Ich schaute hoch und sah mich um, aber es war wirklich nicht sehr viel zu sehen. Ich konnte nicht mal Schröder sehen, obwohl ich wusste, dass er direkt neben mir stand. Aber ich hörte ihn:
„Hast du mich gehört? Was machst du hier eigentlich?!“
„Ich grabe.“
„Grabe? Wie, du gräbst? Willst du ausgerechnet jetzt Kartoffeln ausbuddeln? Mitten in der Nacht? Denkst du immer nur ans Essen? Und es ist auch noch nicht Mittsommer, sie sind bestimmt noch winzig klein, die Kartoffeln, fürchte ich. Das reicht wohl kaum für Bratkartoffeln für uns beide ... Du kannst doch nicht einfach so ohne ein Wort abhauen.“
„Ich werde es dir schon erklären, und das habe ich dir auch gesagt.“
„Hast du nicht. Du hast nur gesagt, dass ich die Taschenlampe nehmen soll, dann bist du abgehauen wie eine gesengte Sau. Völlig durchgedreht.“
„Wo ist die Taschenlampe?“
„Ich hab keine gefunden.“
Da stöhnte ich. Wie ich immer stöhne. Und dann grub ich weiter. Währenddessen war mein Gehirn damit beschäftigt, die Frage zu diskutieren, was ich eigentlich vorhatte. Eine gute Frage.
Ich kniete in einer ungewöhnlich dunklen Juninacht in unserem Garten und grub eins der umhegten Blumenbeete meines Vaters um. Er würde natürlich total ausrasten. Aber als ich im März an einem feuchtkalten Abend das Paket einbuddelte, hatte ich keinem Gedanken an seine Blumen verschwendet. Die Blumenzwiebeln waren inzwischen natürlich gewachsen, hatten ihre Stängel und Blüten nach oben geschickt, und es war noch keine Woche her, dass sie aufgeblüht waren. Es war völlig unmöglich, sie nicht kaputtzumachen, vor allem, weil ich blind buddelte.
„Sie stand auf der Kommode im Flur“, sagte ich sauer.
„Wer stand auf der Kommode?“
„Die Taschenlampe.“
„Willst du damit sagen, dass ich sie holen soll?“
Ich schüttelte den Kopf und steckte beide Hände in die regennasse Erde und suchte.
„Hast du gehört?“
„Was?“
„Ob ich sie holen soll?“
„Was denn?“
„Aber verdammt noch mal, Junge! El Torcho natürlich!“
„Was für’n Ding?“
„Die Scheißlampe!“
Die Feuchtigkeit drang durch die Handschuhe, und auch wenn es Juni war, so wurden meine Hände schnell eiskalt.
„Nein. Nicht nötig. Ich glaube, ich – wart mal ...“
Er schnüffelte misstrauisch. „Verdammt, es riecht so verbrannt, riechst du es auch? Brennt es irgendwo?“
„Es riecht nach Gegrilltem“, sagte ich, trat einen Schritt beiseite, steckte den Spaten in die Erde und zerstörte ein weiteres Stück Blumenbeet.
„Stimmt. Das ganze verfluchte Täby stinkt nach verbranntem Schweinefleisch und Grillfett. Sobald im Kalender steht, dass Sommer ist, rollen die Deppen ihre fahrbaren Schweinekrematorien raus. Die Leute spinnen einfach. Bist du bald fertig?“
„Ja, ich hab es.“
Ich suchte mit den Fingern, fand eine Ecke, schob die Hand drunter und hob es an. Ich konnte richtig hören, wie die aus Holland importierten Blumenzwiebeln meines Vaters mit einen spröden, knirschenden Geräusch zerdrückt wurden, als ich das Paket herauszog.
Ich bürstete die Erde ab und stand auf.
„Komm“, sagte ich und trat auf den Kiesweg.
„Komm, komm“, murmelte Schröder, und ich hörte, wie er fluchte, wahrscheinlich war er genau in das von mir gegrabene Loch getreten.
„Nimm den Spaten mit“, sagte ich.
„Wo hast du den bloß gelassen?“
Ich antwortete gar nicht erst, lief die Schiefertreppe zur Haustür hoch und trat in den Flur. Ich stellte den Karton auf die Fußmatte und zog die lehmverschmierten Gartenhandschuhe aus. Ich sah mich um und wusste nicht, wo ich sie hinlegen sollte, ohne allzu viel schmutzig zu machen. Ehe ich einen Entschluss fassen konnte, wurde die Tür aufgerissen und Schröder trat ein.
„Ich habe keinen verdammten Spaten gefunden. Wir müssen ihn morgen früh holen. Und was ist das? Ein Buch?“
Ich zuckte mit den Schultern und zog die Schuhe aus.
„Kevin, bitte, sei so lieb. Kannst du mir erklären, warum – Ich meine, ich komme her und besuche dich und erzähle, dass Lena angerufen hat und das ich dich ‚dreimal‘ grüßen soll und ...“ Er unterbrach sich und machte mit beiden Armen eine resignierte Geste. „Jesses, was seid ihr blöd! Grüß den kleinen Kevin dreimal von mir!“
„So hat sie es bestimmt nicht gesagt!“
„Ha! Jetzt hab ich dich erwischt, was?“
„Zieh die Boots aus.“
„Ja, ja, ist schon gut. Natürlich verstehe ich, dass das etwas bedeuten soll, irgendein Code oder was ihr euch ausgedacht habt. Es sei ganz verdammt wichtig, sagte sie.“ Er lehnte sich an die Wand und hob das linke Bein, legte es auf den rechten Oberschenkel und zog mit beiden Händen und unter großem Stöhnen einen Cowboystiefel aus. „Und dann drehst du total durch. Ich kann kaum Guten Tag sagen und erzählen, wie es mir geht, da hast du schon die Gartenhandschuhe an und stürzt dich hinaus in die Nacht und fängst an zu buddeln wie der Totengräber aus Hamlet.“
Er wechselte den Fuß, blieb aber nicht stehen, sondern hüpfte auf einem bestrumpften Fuß umher und schaffte es schließlich unter lauten Gestöhn, auch den anderen Stiefel auszuziehen. Mit besorgter Miene inspizierte er die Zehenspitze des Lederstiefels. „Verdammt, jetzt ist die Sohle schon wieder abgegangen, nur weil ich in eurem matschigen Garten herumstiefeln musste. Das ist doch lächerlich und außer ...“ Er verstummte, als sein Blick plötzlich die Bilder an den Wänden entdeckte. „Und sieh mal, die verdammten Bilder hängen immer noch an der Wand!“
Während Schröder weitermachte wie immer, ging ich in die Küche, legte die Handschuhe in den Ausguss und stellte den Karton auf das Abtropfbrett. Irgendwie hatte er ja Recht, es war schon ein ziemlich bescheuert. Aber als Lena damals sagte, an dem Tag, an dem ich einen Gruß von ihr bekommen würde, der lautete „dreimal“, sollte ich sofort den Apparillo holen und ihn so schnell wie möglich einschalten, da klang es überhaupt nicht lächerlich. Im Gegenteil.
Ich kam an mein Kinn und hatte wieder Blut an der Hand. Blöder Pickel, dachte ich und wischte es mit Haushaltspapier ab.
„Tja, verdammt, hier hat sich auch nichts verändert seit dem letzten Mal“, sagte Schröder, als ich mir gerade die Hände wusch. „Das Leben wichtelt weiter so vor sich hin in der blitzeblanken Küche von familio El Karlsson.“ Er kicherte, unterbrach sich dann und wurde plötzlich ernst. „Hast du mal darüber nachgedacht? Wie viele Menschen denken, dass Geborgenheit das Gleiche wie Glück ist, wo doch eigentlich nur das seltene Glück an sich wirklich Geborgenheit geben kann.“ Er schaute mich mit so einem erwartungsvollen Blick an, der jedoch schnell in deutliche Enttäuschung überging.
„Und was hat unsere Küche damit zu tun?“, fragte ich, machte den Putzschrank auf und trocknete mich an einem Geschirrhandtuch ab.
„Eine ganze Menge, mein Junge, mehr als du denkst. Aber ich merke, dass du heute Abend nicht zu tiefsinnigen Gesprächen aufgelegt bist. Du hast ja viel wichtigere Dinge vor, wie zum Beispiel Bücherpakete aus den Blumenbeeten auszugraben. Es ist ja ein gottverdammtes Glück, dass deine Eltern heute nicht zu Hause sind. Ich muss zugeben, ich habe mir auf dem Weg hierher ein wenig Sorgen gemacht. Dank für die gütige Nichtfrage, mir geht es, den Umständen entsprechend, ganz gut. Tatsächlich muy bien, auch wenn dir das scheißegal ist.“
„Ist es nicht, aber Lena sagte, dass ...“
„Wann hast du sie eigentlich getroffen? Habt ihr denn kein Pflaster im Haus?“
„Doch, oben. Aber es ist fast alle. Irgendwann im Frühjahr.“
„Was?“
„Lena. Ich habe Lena irgendwann im Frühjahr getroffen“, sagte ich. „Sie rief an, und dann kam sie und ...“
„Sie war hier?!“ Er wühlte energisch in den Innentaschen seines Mantel und brachte eine zerschlissene Lederbrieftasche zum Vorschein. „Willst du damit sagen, dass sie hier war und nicht mal bei mir angeklingelt hat?!“ Er blätterte durch mehrere zum Platzen volle Fächer und hielt dann mit einem triumphierenden Grinsen ein altes Pflaster hoch.
Ich nahm es, zog das Schutzpapier ab und klebte es irgendwie auf mein Kinn.
„Nicht besonders hübsch. Und du hättest in den Spiegel schauen können. Aber zweckdienlich.“
„Was?“
„Das Pflaster. Es sitzt nicht sonderlich elegant. Was zum Teufel ist nur mit Lena los?“ Er seufzte tief, zog einen der Küchenstühle raus und setzte sich. „Und jetzt ruft sie also an, bittet mich, hierher zu flitzen und dich dreimal zu grüßen. Warum zum Teufel hat sie nicht selbst hier angerufen!?“
„Weil ihr Telefon natürlich verwanzt ist.“
„Verwanzt? Hat sie Ungeziefer im Telefon? Aber wie hat sie dann ...“
„Abgehört wird“, unterbrach ich ihn ungeduldig und riss das Verpackungsband auf.
„Aha, also wieder so was. Du, pleasch, wie der Bramaputrawichtel Rashmal zu sagen pflegte, könntest du mir das ein bisschen genauer erklären?“
Ich zuckte mit den Schultern. Innerhalb einer Nanosekunde blätterte das Gedächtnis ein halbes Jahr durch. Mir wurde fast schwindlig, so schnell ging das.
Eigentlich war nach dem großen Durcheinander am Rösjö im letzten Winter nicht sehr viel passiert, falls ihr euch daran erinnert.1 „Das fehlende Glied“, wie Lena und ihr Vater Adler den Kerl nannten, den sie mit Hilfe der gefälschten Diskette nach Schweden gelockt hatten, und den ich mit Adlers Infrarot-Polaroidkamera auf die Platte bekommen hatte. Er war irgendein schwedischer Bigshot und steckte bis zu den Knöcheln in der mafiaähnlichen Organisation namens BEDA.
Wenn man bedenkt, wie aufgeregt Adler und seine Helfer wurden, als sie sahen, wer da auf dem Foto war, hatte ich erwartet, eine Menge darüber in der Zeitung zu lesen. Wochenlang las ich deshalb jeden Artikel auf der Nachrichtenseite, zum großen Erstaunen meiner Eltern.
Es stand nie etwas drin, keine Zeile. Und dabei hatte Adler zu Schröder gesagt, dass die Affäre große innenpolitische Konsequenzen haben würde und die Regierung vermutlich zurücktreten müsse. Was sie nicht tat. Der Außenminister trat zwar ungefähr einen Monat später aus gesundheitlichen Gründen zurück, was wahrscheinlich sogar stimmte, er sah ziemlich krank aus. Ich fand es einigermaßen unwahrscheinlich, dass es etwas mit der Diskette und Adler zu tun hatte.
Dann kam Mitte Februar der Finanzminister bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Die Kommission, die den Absturz untersuchte, kam zu dem Schluss, dass die eine Tragfläche des kleinen Flugzeugs vereist war. Der Gedanke, dass das Unglück etwas mit BEDA zu tun haben könnte, kam mir zwar, aber ich verwarf ihn wieder.
Inzwischen hatte ich fast vergessen, was mit dieser Diskette und draußen am Rösjö und im VIP-Raum am Arlanda-Flughafen passiert war und auch Beppo, die Morchel, und Rashmal. Oder: ich versuchte es zumindest. Aber immer wieder, kurz vor dem Einschlafen, liefen dann die Erinnerungsvideos und die waren jedes Mal anders. Schließlich wusste ich nicht mehr, was ich wirklich erlebt hatte und was meine Erinnerung hinterher erfunden hatte. Schließlich hatte ich das Gefühl, dass es bloß ein Buch war – verdammt gut, aber immerhin bloß ein Buch, das ich gelesen hatte.
Stattdessen versuchte ich mich aufs Lernen zu konzentrieren, was mir nicht besonders gut gelang. Ich dachte über die berühmte Zukunft nach und was ich werden sollte, wo ich doch nicht mal wusste, was ich werden wollte. Meine Eltern maulten oft, dass ich mir gar nicht mehr ähnlich war, und das stimmte auch. Ich war total verwirrt, in jeder Beziehung.
Diese Erinnerungsbilder, die kamen, bevor ich einschlief, handelten nämlich meistens von Lena Dahlén. Ich kam einfach nicht von ihr los. Wie sehr ich es auch versuchte. Natürlich rannte ich auf jede Menge Feste und natürlich machte ich auch mit allen möglichen Bräuten rum, aber ich merkte immer wieder, dass ich ständig an Lena dachte. Und ich verglich die anderen Mädchen mit ihr. Und da hatten die natürlich keine Chance.
Das war doch lächerlich. Sie war ja mindestens fünfunddreißig, vielleicht sogar so alt wie meine Mutter (Jesses!). Ich verstand nicht, wieso ich so fixiert auf sie war. Ich versuchte, das alles irgendwie klar zu kriegen, und habe doch tatsächlich angefangen so eine Art Tagebuch zu schreiben. Ich versuchte aufzuschreiben, was für Gefühle ich hatte. Das ging natürlich nicht.
Plötzlich, eines Morgens Ende Januar stand ein neu glänzendes, schwarzes Piaggio-Moped an unserem Gartentor, ein riesiges, rosa Seidenband war darumgeschlungen und zu einer gigantischen Schleife gebunden, mit einem Schild, auf dem stand: „Für Kevin, von Raymond & Lena.“
Es war ziemlich schwierig, meinen Eltern das Ganze zu erklären. Fast so schwierig, wie zu erklären, warum mein altes Piaggio gestohlen worden war, warum die Garagentür kaputt oder „verwüstet“ war, wie mein Vater es nannte, warum seine Diskettenbox aufgebrochen war, wo sein unglaublich wichtiger Entwurf für die Jahressteuer seines größten Kunden hingekommen war, und wie es kam, dass zwei seiner teuersten Flaschen Rotwein verschwunden waren usw. usw.
Ich weiß nicht mehr, wie es mir gelang, alles zu erklären, ohne zu erzählen, was wirklich passiert war. Es hätte auch keinen Sinn gehabt. Sie hätten mir doch nicht geglaubt. Außerdem durfte ich auch nichts erzählen. Aber sowohl meine Mutter als auch mein Vater wollten unbedingt meinen „neuen Freund“, diesen Raymond Schröder kennen lernen. Aber zum Glück vergaßen sie es irgendwann wieder. Sie hatten genug andere Probleme, die Firma meines Vaters ging mehrmals beinahe in Konkurs und meine Mutter hatte jede Menge Sorgen in der Schule mit Kürzungen, unmöglichen Einsparungen und hoffnungslos verwässerten Lehrplänen, wie sie sich ausdrückte.
Und dann klingelte eines Abends im April das Telefon. Glücklicherweise war ich allein zu Hause, Mutter war bei einem Kurs und Vater arbeitete mal wieder länger.
„Hallo, Kevin, ich bin’s ...“
Und es gab überhaupt keinen Zweifel, wer ich war.
Das Gespräch verlief genau wie alle Gespräche, die ich mit Lena am Telefon führte. Wenn ihre Stimme so nah war und sich direkt in mein Ohr schlich, war es, als ob sie ganz in mich hineinkriechen würde, und da kam ich ganz durcheinander, fing an zu stottern, wurde rot, verhaspelte mich und bekam Frösche in den Hals und einen leicht surrenden Schwindel. Und alles zusammen führte dazu, dass ich nicht richtig hörte, was sie sagte, ich begriff den Zusammenhang irgendwie nicht, oder wie man das ausdrücken soll.
Sie sei in der Nähe, sagte sie, und sie brauche Hilfe. Ich müsse etwas für sie aufbewahren und verstecken. Als ich sagte, ich sei allein zu Hause und Mama und Pa ... ähm ... meine Eltern kämen erst in einigen Stunden, hatte ich fast noch nicht den Hörer aufgelegt, als ich auch schon ein Auto unten auf der Straße halten hörte. Ich stieg in die Schuhe und erwartete einen weißen Porsche. Seit jenem regnerischen Herbstabend im letzten Jahr hatten weiße Porsches für mich eine besondere Bedeutung, und wenn ich einen sah, spürte ich (es fällt mir schwer, es zuzugeben, aber gut), spürte ich Lena Dahléns Lippen auf meinen (doch, das stimmt).
Da unten stand überhaupt kein weißer Porsche. Stattdessen stieg sie aus einem knallgelben, rostigen Citroën 2CV, ihr wisst schon, so eine französische Blechbüchse, die schon lange nicht mehr gebaut wird. Als ich zum Gartentor kam, stand sie da und lächelte.
„Noch mal hallo, Kevin.“
Sie sah aus wie immer. Mir kam sofort die alte Songzeile in den Sinn: I grow weak in the presence of beauty.
Sie reichte mir ein Paket, das in ganz normales, braunes Packpapier eingeschlagen war, vielleicht ein bisschen größer als ein Taschenbuch, nicht dicker als Chandlers „The Big Sleep“.
„Kannst du das für mich verstecken?“
Es war wichtig und natürlich fürchterlich geheim. Sie erklärte, es sei ein Gerät, das an ein Telefon angeschlossen wurde.
„Ein Fax, meinst du?“, fragte ich erstaunt.
„Nein, kein Fax, aber etwas Ähnliches“.
Dann erklärte sie mir, wie es funktionierte, aber ich verstand es nicht richtig. Denn wenn sie vor mir stand, war ich total verwirrt und kindisch.
Sie meinte, dass ich vermutlich nichts machen müsse, aber: „Sobald jemand dich anruft oder zu dir nach Hause kommt und dich dreimal von mir grüßt – merk dir das: nicht nur grüßt, sondern dreimal von mir grüßt“, dann sollte ich das Gerät anschließen, sobald ich allein war.
„Es ist ganz einfach, ich habe ein paar Hinweise aufgeschrieben, sie liegen in der Schachtel, und da steht auch, was du dann machen musst.“ Es war also sehr wichtig, dass ich es wirklich versteckte, sie hätte mich lieber nicht schon wieder in etwas verwickelt, aber sie kannte sonst niemanden, bei dem es keine Verbindungen zwischen ihr und BEDA gab.
„Wie ist es denn mit denen weitergegangen?“, fragte ich und nahm das Paket.
„Es ist noch nicht zu Ende“, sagte sie und folgte mir zum Haus.
„Du hast vielleicht von diesem Flugzeugabsturz gehört.“
„Waren das ...“
„Ja. Deswegen muss ich es so machen. Alles ist so schrecklich verwickelt, ich traue inzwischen niemandem mehr, deshalb muss ich ... Und du, Kevin – kein Wort, vergiss das nicht.“
„Willst du nicht einen Kaffee oder so?“, fragte ich und kam mir schon wieder so superalbern und megakindisch vor. Ich war dankbar, dass die Außenlampe nicht so hell war. Und trotzdem hoffte ich innerlich, dass sie Ja sagen würde. Ich würde ihr Kaffee machen, in der Mikrowelle tiefgekühlte Zimtschnecken auftauen, ihr am Küchentisch gegenübersitzen, ihr in die Augen schauen, ihre Stimme hören und –
„Hab keine Zeit, Kevin. Ein andermal. Hast du in letzter Zeit mir Raymond gesprochen?“ Ich schüttelte den Kopf und versuchte über die Enttäuschung hinwegzukommen, die wie ein großer, grober Stein in meinen Körper sank. „Ich auch eine ganze Weile nicht“, sagte sie mit so einem Lächeln, von denen meine Erinnerungsabteilung eine sorgfältig gepflegte und hoch geschätzte Sammlung besaß. „Wenn du ihn sprichst, grüß ihn.“
„War das alles? Grüßen? Hat sie sonst nichts gesagt? Und dann ging sie einfach wieder?“
Ich nickte, aber das stimmte nicht ganz. Ich erzählte nicht, dass sie mir noch so ein Lächeln schenkte, und dass sie sich dann vorbeugte und mich rasch in eine Umarmung einschloss, die ich immer noch als deutlichen Abdruck auf dem ganzen Körper spüre.
„Als ob ich der Cousin der Schwägerin ihrer Mutter wäre“, brummte Schröder.
Ich machte den Pappkarton auf und holte eine blau-schwarze Plastikschachtel heraus, die aussah wie ein übergroßer Walkman. Sie war ungefähr so dick wie Chandlers „The Big Sleep“. Ganz unten lag ein gefaltetes A4-Papier mit den Instruktionen, von denen Lena gesprochen hatte. Sie waren auf einem Computer geschrieben und mit einem Tintenstrahldrucker ausgedruckt worden, der bald eine neue Tintenpatrone brauchen würde, vermutete ich.
Für Kevin stand ganz oben in Kursivschrift.
„Verdammt, Kaffee, Kevin. Kaffee.“
Ich zeigte gedankenverloren Richtung Küchenschrank, ohne meine Lektüre zu unterbrechen.
Er machte zwei große Schritte und riss die Schranktür auf. „Löfbergs Lila?! Aber was ist denn das, Kevin? Was? Hat dein Alter Steuern nachzahlen müssen? Kein Segafredo? Kein Kimbo? Nicht mal Lavazza?“
„Hmm ...“, brummte ich.
„Ich hab was gefragt!!“
„Was?“
„Habt ihr keinen richtigen Kaffee im Haus?“
„Nicht?“ Ich zog den Stecker des Küchentelefons aus der Buchse und drückte ihn an der einen Seite in den Apparillo, dann steckte ich den Stecker vom Apparillo in unsere Buchse.
„Ein Anrufbeantworter?“, fragte Schröder erstaunt und hörte mit seinem Kaffeegemaule auf. Er machte nicht einmal die Schranktür zu, sondern kam zu mir und starrte die schwarze Schachtel an. „Warum habt ihr den Anrufbeantworter im Blumenbeet vergraben? Wozu soll das gut sein? Das hab ich mit meinem noch nicht versucht ...“
Ich warf ihm einen müden und hoffentlich strafenden Blick zu, während ich den Stromstecker vom Apparillo in die Steckdose steckte. Ich drückte auf einen roten Knopf und eine kleine rote Lampe ging an.
„Mit eingebauter Lampe und allem“, sagte Schröder. „Ich bin wirklich beeindruckt, Kevin. Aber was soll jetzt passieren? Spielt der gleich ein Liedchen. Vielleicht Mozarts Flötenkonzert in E-Dur? Und was ist das überhaupt für ein verdammter Apparillo?“
„Ich weiß es auch nicht genau“, sagte ich und war etwas erstaunt.
Der Apparillo schaltete ein paar Mal und nach einer kurzen Pause begann er leise zu surren. Schröder legte eine Hand hinters Ohr und beugte sich runter.
„Nein, absolut kein Mozart. Möglicherweise eine moderne Interpretation des Brausens der Wasserfälle von Avesta, aber das klingt mehr wie mein neuer Kühlschrank.“
Er verschränkte die Arme und lehnte sich an die Spüle, nahm den Zettel und las die erste Zeile. „An der Überschrift hat sie lange gefeilt ...“ Er lehnte sich noch weiter zurück und begann zu lesen. Nach einer Weile schaute er den Apparillo an, dann unser Telefon und schließlich starrte er intensiv die Buchse an der Wand an.
„Punkt für Punkt galant ausgeführt, Kevin“, sagte er säuerlich.
„Ich bin ja so stolz auf dich.“
„Hör auf. Lies weiter“, sagte ich und verschränkte meinerseits die Arme.
Er zuckte mit den Schultern und nahm wieder den Zettel. Genau in diesem Moment klingelte das Telefon. Wir zuckten beide zusammen und schauten uns an.
Schröder nahm den Hörer ab.
„Nein!“, schrie ich und stürzte mich auf ihn. „Verdammt, kannst du nicht lesen?!“ Ich riss ihm den Hörer aus der Hand und legte wieder auf.
„Ich bin noch nicht fertig ...“
Ich zeigte mit einem wütend zitternden Zeigefinger weiter unten auf das Blatt, wo stand, dass ich
absolut nicht
abnehmen sollte, wenn das Telefon während der fünfundzwanzig Minuten, in denen es angeschlossen war, klingelte.
„Verdammt ...“ Er kratzte sich mit schabendem Geräusch unter dem Kinn. „Aber ich habe wenigstens nichts gesagt.“
„Das nützt vielleicht nichts“, sagte ich und spürte wie sich ätzende Panik irgendwo in der Magengegend breit machte. Ich hatte das seit einem halben Jahr nicht mehr gespürt und vergessen, wie widerwärtig es sein konnte. Es war, als ob ein scharf geschliffenes Pendel da drinnen hin- und herschwingen würde.
„Wie, nützt nichts?“
„Der Grund, warum er hier installiert ist, ist natürlich der, dass niemand diese Nummer kennt, und darum können sie auch die Funktionen nicht aufspüren.“
„Was zum Teufel fantasierst du da?“
„Dieser Apparillo ist gerade damit beschäftigt, die kompletten Informationen aus einer gigantischen Datenbank abzuziehen. Aber wenn sie die Nummer aufspüren, können sie auch den Prozess stoppen und vor allem können sie ihn bis hierher verfolgen. Und deswegen sollte ich es machen.“
„Damit sie ihn bis hierher verfolgen können?“
„Damit sie es nicht können, selbstverständlich!“
„Oh! Lena und ihre verfluchten Computerapparillos, also wirklich! Und muss sie ständig dich da hineinziehen? Sie hätte doch mich bitten können, es zu machen.“
„Dich kennen sie, sagte sie, das sei genauso schlimm.“
„Mich kennen sie?! Zum Teufel aber auch. Wie ausgesprochen unangenehm.“
Ich zuckte mit den Schultern und spürte, wie eine sogartige Unruhe sich vom Bauch aus spiralförmig nach oben drängte. Wenn sie die Nummer bis hierher verfolgen können? Und was, wenn Schröder alles kaputtgemacht hatte? Was würde dann passieren?