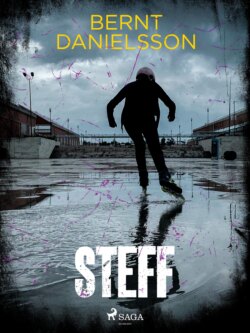Читать книгу Steff - Bernt Danielsson - Страница 7
4
ОглавлениеDer große Seufzer
„Wenn ich [kau, schmatz, kau] dich recht verstehe, dann sieht es also so aus [der ganze Unterkiefer bewegt sich ruckartig seitwärts, und dabei wird jedes Mal ein Muskel entlang des Halses sichtbar; schmatzschlürfende Geräusche], korrigier mich, wenn ich [rülps, schmatz, schluck] was falsch verstanden habe [rülps]. Gott [stöhn], war das gut. Ahh!“
Theodor Bach reckte sich nach einem Keramikbecher, der so eingeschmutzt war mit braunem Kaffeemuster, das der Karte eines sehr komplizierten Flußdeltas glich – dem Nildelta zum Beispiel.
„Wart einen Moment, ich muß erst einen [hält mit dem Zeigefinger den Löffel beiseite] Schluck [trinkt; schluck, schluck – der Adamsapfel hüpft rauf und runter] – ahh. So.“
Stephanies Blick glitt weg und suchte das Fenster. Da draußen war der Morgennebel etwas lichter geworden und hatte die Sonne durchgelassen, die durch die ungewöhnlich vielen gelbgrün schimmernden Blätter leuchtete, die immer noch an den Zweigen von zwei großen Ahornbäumen hingen. Das bleiche Licht ließ die Beerentrauben einer Eberesche aussehen wie rotglitzernde Edelsteine. Auf der Rückseite des Hauses war der Garten nicht ganz so zugewachsen, und außer den Ahornbäumen gab es einen erstaunlich großen, schwarzen, protzigen, gußeisernen Brunnen, der ganz ähnlich aussah wie der im Kungsträdgården. Der Brunnen war abgedreht und stand auf einem moosgrünen Rasen, der mit bräunlichen Blättern bestreut war. Ein Kiesweg führte zu einem Sandkasten und einem rostigen Schaukelgestell mit zwei Schaukeln aus alten Autoreifen.
Von der Küche aus konnte man auch über die Mauer sehen, auf eine feuchtglänzende Straße und einen Briefträger. Er fuhr auf einem gelben Fahrrad mit langsamen, leicht schwankenden Bewegungen vor einer tief dunkelroten Hecke.
Es sah recht nett und friedlich aus, fand sie, erheblich angenehmer, als Theodor Bach anzuschauen, der ihr seit gut einer Stunde am Küchentisch gegenübersaß und sein sogenanntes Frühstück in sich hineinstopfte, während die Übelkeit in ihrem Bauch hin- und herschwappte. ,Vielleicht ist es der Kaffee? Es schmeckt überhaupt nicht so, wie Kaffee sonst schmeckt.‘
„Ißt du immer so viel?“ fragte sie, ohne den Briefträger aus den Augen zu lassen.
„Nein, aber man soll nichts umkommen lassen. Und der Lammbraten war heute fast noch besser – unglaublich perfekt gewürzt, wenn ich [donnernder Rülpser] – ups, sorry – das sagen darf. Weißt du, molto perfettamente, der Rosmaringeschmack, den man gleichsam nur ahnt neben dem eigenhändig von mir gezogenen Thymian und etwas Worcestershiresauce. Ich hätte allerdings das Kartoffelgratin aufwärmen sollen. Ja, ja, es war sehr gut. Okay, um das Ganze zusammenzufassen: Der Vater deines Freundes ist verschwunden. Ganz einfach, oder nicht?“
„Ähm . . . doch, an und für sich schon“, sagte sie und fand, daß es ziemlich jämmerlich und nach nicht viel klang.
Eine ganze Stunde lang hatte sie dagesessen und alles erzählt, direkt und von Anfang an. Warum? Sie konnte es nicht begreifen. Wie bitte, glaubte sie etwa, daß dieser bärtige, eklige Knacker ihr helfen könnte. War er überhaupt ein „Knacker“? Wie alt war er eigentlich? Manchmal hatte er frappierende Ähnlichkeit mit einem verwirrten Fünfzehnjährigen. Merkwürdigerweise war der Glaskäfig weg, der war wohl schon verschwunden, als sie ohnmächtig wurde. Sie hörte ihre Stimme wie immer und hatte auch nicht mehr das Gefühl, neben sich zu stehen. ,Sehr merkwürdig, aber wunderbar.‘ Erzählte sie deshalb so viel? Weil es so angenehm war, die Stimme wieder normal zu hören? Oder kam es von was anderem? Daß sie Vertrauen für ihn empfand, das konnte es kaum sein. Oder doch?
Theodor Bach hatte geschmatzt und geschlungen und gegessen und genickt und kaum ein Wort gesagt. Außer einmal, als seine Augen plötzlich ihren Blick auffingen, der ansonsten immer Stellen zu finden versuchte, wo er nicht auf Theodor zu schauen brauchte, aber gerade da hatte sie ihn schnell angeschaut, weil ihre Ohren ihr mitgeteilt hatten, daß er doch tatsächlich gurgelte. Und sie hatten völlig recht – er hielt in der einen Hand ein Glas, es war etwas Weißes, Undurchsichtiges drin; er schaute zur Decke und tat genau, was ihre Ohren behaupteten: Er gurgelte. Bevor sie wegschauen konnte, hörte er auf, schluckte, starrte sie an und fragte:
„Nimmst du die Pille?“
„Was?“
„Ich habe gefragt, ob du die Pille nimmst.“
Und da wurde sie schon wieder rot. ,Was ist denn bloß los mit mir?‘ dachte sie ärgerlich.
„Ja, ist doch klar“, sagte sie störrisch und schaute in ihren Kaffeebecher.
„Gut“, nickte er zufrieden, hob noch einmal das Glas zum Mund, gurgelte wieder ein Weilchen, schluckte und fragte:
„Willst du bestimmt nichts haben?“
Er zeigte auf das letzte Stück, das er von dem Lammbraten losgeschält hatte. Sie schüttelte nachdrücklich den Kopf.
„Selber schuld. Weiter, weiter“, sagte er und legte sich das letzte Stück auf seinen Teller.
Dann hatte er sich schmatzend die Finger abgeschleckt und war in sein Essen vertieft gewesen, während sie weitererzählte. Und nun faßte er also ihre sorgfältige Berichterstattung mit dem Satz ,Der Vater von deinem Freund ist verschwunden‘ zusammen.
,Irgendwie stimmt es ja auch – aber trotzdem‘, dachte sie und schaute zu, wie der Briefträger breit grinsend einige Postkarten las, ehe er sie in den Kasten fallen ließ. ,Ganz so einfach ist es nicht.‘
Theodor Bach wußte natürlich auch, daß es nicht so einfach war. Er fand, daß alles fürchterlich kompliziert klang, und dachte darüber nach, wie er es ihr erklären sollte. Denn es war ja kein Geheimnis, daß das absolut nichts für einen autorisierten Privatdetektiv war. Schon nach einer Viertelstunde hatte er sie unterbrechen und es ihr direkt sagen wollen. Aber wie sollte er es ihr erklären – genau das war so kompliziert –, und würde sie verstehen, was er meinte?
,Wieviel versteht man eigentlich, wenn man sechzehn ist?‘
Vermutlich mehr, als die meisten glauben – genau wie man viel weniger kapiert, wenn man fast fünfundzwanzig Jahre älter ist.
,Ja, so ist es wohl.‘ Wie auch immer, sie hätte ja nicht dasitzen und eine geschlagene Stunde ihre Ausführungen herunterleiern brauchen, die sie außerdem nur mit Mühe herausbekam. Sie stotterte und stammelte, wußte nicht, wohin mit den Händen, ihr Blick flackerte fürchterlich, sie wurde ständig rot und schien alle brennenden Höllenqualen der Pubertät auf einmal zu durchleiden.
Es war natürlich ziemlich gemein, ihr nicht zu helfen, aber sie hatte so eine schöne Stimme, er hatte schon lange keine so schöne Stimme mehr gehört. ,Sie singt bestimmt sehr schön‘, dachte er. ,Vielleicht wartet da sogar eine Karriere auf sie.‘
Ihr so gegenüberzusitzen, während der Nebel sich lichtete und die Strahlen der Novembersonne mit dem Herbstlaub spielten und langsam über das verdreckte Küchenfenster glitten, den ausgezeichneten Lammbraten zu essen und dabei ihren umständlichen Ausführungen zuzuhören, kleine kristallglitzernde Schweißtropfen auf ihrer glatten Stirn hervortreten zu sehen, ihre daunenweichen Wangen anzuschauen, ihre gerade Nase die Farbe wechseln zu sehen wie eine falsch programmierte Verkehrsampel, zu hören, wie sie schluckte, Luft holte und sich gleichsam Mut erkämpfte, um mit ihrer Erzählung fortfahren zu können – ja, das war wirklich ziemlich angenehm.
,Es tut weh, wenn die Knospen aufplatzen‘ dachte er und kicherte in Gedanken, ,aber es klingt verdammt noch mal nicht schlecht. Und das Gleichnis mit der kaputten Ampel war auch gar nicht so übel. Nein, richtig gut, bisher eines der besten. Verglichen mit dem angestrengten Vergleich von der weißen Katze und dem an den Haaren herbeigezogenen Ölbohrturm ist es richtig spitzenmäßig.‘ Sie wechselte nämlich wirklich von Knallrot über eine Art Orange zu einem schwachen Grünschimmer (man konnte fast meinen, daß ihr übel war), während sie erklärte, wie alles zusammenhing.
So ungefähr hing also alles zusammen (wenn er es nicht falsch verstanden hatte):
Stephanie war mit einem Jungen zusammen (wie sie sagte), der Ricky Nilsson hieß und in die Parallelklasse der gleichen Schule wie sie ging. Sie gingen miteinander (wie sie es später nannte), schon seit Januar.
Bei ihr klang das so, als ob schon bald goldene Hochzeit gefeiert würde –, ,und für eine Sechzehnjährige ist ein gutes halbes Jahr sehr lang‘, dachte er und wurde neidisch.
Es war offenbar ein schwieriges und zugleich stürmisches Verhältnis – nicht, daß sie viele Einzelheiten erzählt hätte, aber was sie errötend berichtete, schien unglaublich viel weiter gegangen zu sein, sowohl auf körperlicher wie auf seelischer Ebene, als alles, was er von seinen Verhältnissen (,ja, Plural ist ganz richtig‘), als er sechzehn war, erinnern konnte.
Nach einem Monat des glitzernden Verliebtseins hatte es sich so zugespitzt, daß sie Schluß gemacht hatte, aber später im Frühjahr hatte es wieder gefunkt zwischen den beiden, und sie waren den ganzen Sommer über jeden Tag zusammengewesen.
Er konnte sie richtig vor sich sehen: Eng umschlungen schlendern sie über kahle Felsen irgendwo auf einer Insel draußen in den Schären, die Sonne glitzert in den Wellen und in den Metallbeschlägen des vertäuten Segelboots und allen unbegreiflichen Haken, Schrauben, Griffen und Muttern. Und dann, wenn die heißflimmernde Sonne allmählich hinter dem Horizont versinkt: täppische Zärtlichkeiten auf sonnenverbrannter Haut, die sich kräuselt, und ein junger Mensch mit Flaum auf der Oberlippe starrt erstaunt auf eine Brustwarze, die . . .
Ja, ja.
Sie gingen immer noch miteinander, auch wenn es zur Zeit gerade etwas abgekühlt und problematisch war, der Grund dafür war, was sie so umständlich zu erklären versuchte: daß Rickys Vater verschwunden war.
Theodor fand, daß man die Sache eigentlich so nicht ausdrücken dürfe, wenn ein Mensch einen Abschiedsbrief geschrieben und deutlich erklärt hatte, daß er „an einen unbekannten Ort verreisen“ würde, er es wolle und müsse, nicht die Absicht habe zurückzukommen und sie absolut nicht nach ihm suchen sollten; er außerdem hoffe, daß Ricky eines Tages verstehen würde, warum, und ihm verzeihen könnte.
,Der Typ hatte vermutlich von allem die Schnauze voll – von der Arbeit, seiner Ex-Frau, seinem Taugenichts von Sohn, der bestimmt fraß wie ein Wolf, wo doch das Essen jeden Tag teurer wurde, von dem Scheißfernsehprogramm – und war einfach abgehauen.
Ich kann ihn so gut verstehen.
Oder er hatte Selbstmord begangen – aber sie hatten offenbar noch keine Leiche gefunden, und das war immerhin ein gutes Zeichen.‘
Rickys Eltern hatten sich scheiden lassen, als er zehn war, und in den ersten Jahren hatte er bei seiner Mutter gewohnt. Aber als sie sich mit einem megawiderlichen Typ wieder verheiratet hatte, war er nach einem Haufen Ärger wieder zu seinem Vater gezogen. Und da hatte er seither gewohnt.
Stephanie zufolge verstanden sie sich prima (der Vater und Ricky also), und Ricky mochte ihn sehr gern, und er (der Vater) mochte Ricky sehr gern. Alles war also in Butter, der alleinerziehende Vater kümmerte sich um den Sohn und die Dreizimmerwohnung und das Kochen und seine Arbeit, alles ohne größere Mühe.
,Genau das habe ich mir gedacht‘, dachte Theodor und schnaubte in Gedanken verächtlich über alle alleinerziehenden Mütter und Väter, die er im Fernsehen hatte jammern und klagen hören, daß es unmöglich sei, alles zu schaffen – Arbeit, Haushalt und Kind. ,Verfluchte Querulanten. Wie man sich bettet, so liegt man.‘
Aber andererseits kann es nicht so kuschelmuschelwunderbar gewesen sein, denn sonst wäre das Folgende nicht geschehen:
Als Ricky eines Abends Anfang August nach Hause kommt, findet er den Abschiedsbrief seines Vaters und bricht zusammen. Die ziemlich hölzern geschriebenen Zeilen „schlagen seine ganze Welt in Scherben“ (der unglaublich begabte Journalist der Lokalzeitung ist für die Wortwahl verantwortlich, nicht Stephanie), und dann geht es mit unglaublicher Geschwindigkeit bergab – ja geradewegs zur Hölle. Ricky wird barsch und mürrisch und sauer und schlechtgelaunt und hoffnungslos und abweisend und störrisch und wütend und überhaupt furchtbar und gewalttätig und verärgert und trifft sich mit einer Bande shitheads (das war ihr Ausdruck, nicht Theodors), die bestimmt einen Haufen ekelerregender Sachen machen (das waren Theodors Worte, nicht Stephanies).
,Das sind bestimmt die, die in umgedrehten Basketballmützen oder Mönchskutten herumlaufen‘, dachte Theodor, ,und sie haben immer so noppige graue Hosen an mit Hängeärschen und ausgebeulten Taschen, in denen sie ihre gemeinen Waffen haben und ihre ekligen Süßigkeiten, die sie kauen, wenn sie mit ihren Armeestiefeln stampfen und nur so zum Spaß friedliche Alkis verprügeln und dabei selber mindestens drei-, wenn nicht viermal im Monat alles mögliche in sich hineinschütten, weil sie ja älter sind als diese Dreizehnjährigen, von denen im Fernsehen berichtet wurde. Ist wahrscheinlich egal, was sie in sich hineinlaufen lassen. Hauptsache, sie werden stockbesoffen und mutig genug, um den Blick von den Latschen zu heben. Und wenn sie zu fünfzehnt sind, dann trauen sie sich vielleicht, die 65jährige Tante vom Zeitungskiosk auszurauben. Sie sniffen bestimmt Klebstoff und Verdünner und testen am laufenden Band irgendwelche Drogen.‘
„Das kann passieren“, sagte Theodor und entließ einen Rülpser, der Stephanie genau im Gesicht traf, er stank nach abgestandenem Knoblauch und hatte außerdem einen scharfen, metallischen Geruch – es roch fast wie Essig, fand sie.
Wenn sie schon einmal eine frischgekochte Marinade auf der Basis von Weißweinessig gerochen hätte, dann hätte sie vielleicht sagen können, daß so Theodors Rülpser roch.
„Wie ,Das kann passieren‘?“ fragte sie spitz.
„Tja, man könnte auch sagen: So ist das Leben oder c‘est la vie oder that’s life oder . . . Ähm, ich konnte es auch einmal auf griechisch, aber das habe ich vergessen . . . Was ich damit sagen will, das ist zwar alles ziemlich traurig, aber wieso bist du auf die Idee gekommen, mich aufzusuchen?“
Sie zuckte mit den Schultern, legte die Unterarme auf die Tischkante und starrte ziellos einen braungelben Fleck auf dem blau-weiß-karierten Küchentuch an. Sie sagte nichts. Sie starrte ihn sehr lange an und war völlig stumm.
Theodor schaute sie erstaunt an und lehnte sich zurück.
„Japanischer Senf“, sagte er, mehr um etwas zu sagen, denn wenn sie nichts sagte, fühlte er sich tatsächlich etwas ,ähm . . . etwas komisch irgendwie, nicht direkt unbehaglich, aber vielleicht ein bißchen . . .‘
Peinlich berührt?
,Nein, verdammt, überhaupt nicht, aber es . . .‘
„Was?!“ rief sie aus.
„Japanischer Senf. Karashi. Stark wie der Teufel, aber . . .“
„Was redest du eigentlich?“
Ihre bisher so sanfte Stimme klang überhaupt nicht mehr unschuldig weich und honigzart. Und die großen Augen – ,vielleicht sind sie doch blau‘ – sahen direkt gefährlich aus.
„Der F-f-fleck“, stotterte er. „Du hast auf den Fleck gestarrt, es ist ein Senffleck . . .“
„Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich mich so angestrengt habe“, sagte sie und seufzte. Es war so ein richtig abgrundtiefer Seufzer, der alle Anwesenden in Theodors Seufzerabteilung vor Neid abgrundtief aufseufzen ließ.
Es war genau so ein Seufzer, den sie immer wieder hinzukriegen versuchten. Den Seufzer aller Seufzer, der ein für allemal das ausdrücken sollte, was ein Seufzer eben auszudrücken hat: Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Handlungsunfähigkeit, Verzweiflung und gleichzeitig eine Art grundsätzlicher Wut über den Zustand der Dinge, die Armseligkeit des Lebens, das unmenschliche Gesicht der Weltgeschichte, über die kurzsichtige Dummheit und Gleichgültigkeit der Menschen, über ihre unglaubliche Grausamkeit und Bosheit, über die rücksichtslose Profitgier, die die Natur verunreinigte, den Himmel vergiftete und das Leben für alle Tiere und Menschen verkürzte, und vor allem über all die unerträglichen, einfältigen Knallköppe, die einem das Leben verpesteten.
„Ich auch nicht!“ fauchte Theodor und stand auf.
„Was ,Du auch nicht‘?“ fragte Stephanie, weil sie während der umständlichen Ausführungen seiner Seufzerabteilung vergessen hatte, was sie gesagt hatte.
„Ich weiß auch nicht, warum du dich so angestrengt hast und . . .“
„Aber begreifst du denn nicht? Er muß wiederkommen, sonst geht es übel aus mit Ricky, ich muß etwas tun und . . .“
„Das Beste, was du tun kannst, ist, ihn zu vergessen“, rief Theodor, aber sie hörte nicht, was er sagte, denn in dem Moment lief er mit dröhnenden Schritten die Treppe hinunter.
Nach einigen merkwürdig kratzenden Geräuschen kam er wieder hochgelaufen. Als er sich setzte, steckte er eine lange, schmale Zigarre zwischen die Lippen und klapperte mit einer Streichholzschachtel.
„Was hast du gesagt?“
„Ich habe gesagt: das beste [pult sehr konzentriert eines von drei Streichhölzern aus der Schachtel, und es gelingt ihm nach mehreren Versuchen, es an der abgenutzten Reibfläche anzuzünden], was du tun kannst [zündet die Zigarre an und zieht so übertrieben daran, daß die Backen hohl werden], ist [die Zigarre glüht, und Theodor bläst eine große, hellgraue Rauchwolke quer über den Tisch und trifft sie mitten im Gesicht], ihn zu vergessen. Und das ist . . .“
„Ricky!?“ unterbrach sie ihn schockiert und wollte ihren Ohren nicht trauen.
„Ja, sicher. Und wenn du dann . . .“
Sie starrte ihn voller Abscheu an und hoffte, ihre Augen würden ganz fürchterlich blitzen und sehr deutlich ausdrücken, daß sie fand, er sei das Ekligste und Widerlichste, was sie je getroffen hatte – und übrigens auch das Dümmste. Sie konnte wahrhaftig nicht mehr verstehen, warum sie gefunden hatte, daß es schön war, diesem Vollidioten alles erzählen zu können. Aber das hatte sie gefunden. Auch wenn es anstrengend war und schrecklich und alles, so hatte sie doch eine Art . . . eine Art – sie konnte das richtige Wort nicht finden – empfunden.
Vielleicht suchte sie nach dem Wort „Vertrauen“, aber das wird ja heutzutage nicht mehr allzu oft verwendet, es ist also kein Wunder, daß sie es nicht fand.
Aber es spielte keine Rolle, daß sie das Wort nicht fand, im Moment haßte sie den Kerl ganz einfach, und das reichte. Als sie aufstand, schob sie den Stuhl so heftig wie nur möglich zurück.
„Vielen Dank“, unterbrach sie ihn wieder und versuchte, den Tonfall nachzuahmen, den Ricky immer den Lehrern gegenüber hatte.
„Nichts zu danken“, sagte Theodor und paffte eifrig seine Zigarre, zuckte mit den Schultern und schaute den großen Ahorn an. „Wenn du mich also nicht zu Ende reden lassen willst, sondern mich dauernd unterbrichst, dann mußt du dich eben hiermit zufriedengeben. Normalerweise nehme ich fünfhundert für eine Konsultation, aber weil du noch so jung bist und das Problem so einfach ist, gebe ich mich zufrieden, wenn ich den Hunderter und die vier Kronen bekomme, die du in der Tasche hast. Den Kronkorken kannst du behalten.“
„Glaubst du, daß ich auch nur eine . . .“, fing sie an, kam dann aber völlig durcheinander.
Sie schaute ihn an und begriff überhaupt nichts mehr – die Gedanken blieben einfach stehen und torkelten in ihrem Kopf herum und fragten immer wieder, wo denn der Notausgang sei.
„Wie . . .“, sagte sie mit flüsternder Stimme, bewegte den Kopf, so daß ihre Haare, die wie ein schwarzer, schlanker Nerz auf ihrer Schulter gelegen hatten, mit einem Ruck gegen den Rücken der Jeansjacke geschleudert wurden (sie hatte sie nicht ausgezogen – sie fühlte sich sicherer, obwohl ihr warm geworden war und sie sogar ein bißchen geschwitzt hatte, was sie sonst nie tat). Die Bewegung war in gewisser Weise dazu gedacht gewesen, die Gedanken zu entwirren und zu klären und zu sammeln, aber das taten sie nicht – im Gegenteil, sie fielen dauernd wieder um.
Wie konnte er . . .
„Wie kannst du . . .“, versuchte sie noch einmal mit der gleichen verblüfft zischenden Stimme.
„Wie ich wissen kann, daß du hundertvier Reichstaler in deiner albernen Alpengeldbörse hast? Weil ich Detektiv bin, deshalb. Und die brillante Deduktion – das bedeutet Schlußfolgerung – ist ein Beispiel für meinen unglaublichen Tiefsinn, meine unübertreffliche Urteilsfähigkeit und mein beinahe magisches Investigationsvermögen, und das sollte mehr beweisen als eine lächerliche kleine Ausweiskarte aus Plastik, nach der du gefragt hast.“
„Ich verstehe überhaupt nicht, was du sabbelst.“
„Nee, das sieht man dir an. Du siehst unglaublich bescheuert aus, wenn ich ehrlich sein soll. Setz dich hin und laß mich zu Ende reden.“
„Du hast in meiner Handtasche geschnüffelt, als ich ohnmächtig war“, sagte sie ruhig.
„Könnteschonsein“, sagte er grinsend.