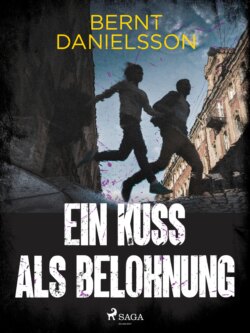Читать книгу Ein Kuß als Belohnung - Bernt Danielsson - Страница 5
1
Der Stilettpsychopath
ОглавлениеIch hatte keine Chance.
Hätte ich nicht die Kopfhörer vom Walkman aufgehabt und hätte nicht John Vollem mit seiner heiseren Stimme gerade den Song „We’re leaving this place, mate“ gesungen, dann hätte ich natürlich gehört, wie die Schrottschüssel von Lieferwagen aus der Querstraße kam.
Aber dem war, wie gesagt, nicht so.
In der nächsten Sekunde krachte das Vorderrad meines Mopeds in den großen Kotflügel, ich wurde in die Luft geschleudert, machte einen Riesensaltomortale und klatschte ein paar Meter weiter auf den Asphalt.
Ich konnte nichts denken, aber ich war ganz sicher, daß ich sterben würde.
Ich erinnere mich nur noch an die riesige Windschutzscheibe des Lieferwagens, die starken Scheinwerfer und den verdreckten Kühlergrill.
Bei meinem Flug durch die Luft wurden mir die Kopfhörer abgerissen, und John Vollem verstummte abrupt. Ich war plötzlich so hoch, daß ich über eine Hecke in ein Wohnzimmer schauen konnte, wo zwei grauhaarige alte Tanten auf einem Sofa saßen und fernsahen.
Dann kam der Asphalt auf mich zugerast.
Dann kam der Aufprall.
Erst jetzt dachte ich etwas, aber es war mehr wie ein gurgelndes Brüllen, weil es in meinem linken Knie unglaublich weh tat.
Die eine Tür des Lieferwagens wurde aufgestoßen, und ich sah, daß jemand herauskletterte. Obwohl es dunkel und diesig war und obwohl ich einen Tränenschleier vor den Augen hatte, sah ich genug, um zu denken: „Was für eine Type!“
Er hatte einen langen, schmutziggrauen Trenchcoat an, der ihm um die Jeansbeine flatterte. Unter dem orangefarbenen Schein der Straßenlampe sah er aus wie eine Art Musketier. Er stiefelte mit langen Schritten auf mich zu. Er hatte schwarze, wirre Haare und trug eine dunkle Sonnenbrille.
Sonnenbrille? dachte ich. Abends um halb acht? Am fünfzehnten Oktober?
Er stolperte über mein Moped und blieb vor mir stehen. Die schwarze Brille starrte mich an, wie ich da auf dem nassen Asphalt lag und mein Knie mit beiden Händen festhielt. Ich glaube, ich habe mich sogar hin- und hergewiegt. Vielleicht glaubte ich, daß es dann weniger weh täte.
„Kannst du nicht besser aufpassen, du blöder Eimer?!“ Er klang genauso verrückt wie er aussah. „Verdammt!!“ stöhnte er, breitete beide Arme aus und ließ sie laut klatschend wieder an den Körper zurückfallen. „Du hättest ja sterben können, du Trichtertüte!!“
Ich bekam kein Wort heraus. Mein Knie tat wahnsinnig weh, und ich bemühte mich verzweifelt, nicht zu heulen – so kindisch wollte ich mich schließlich auch nicht zeigen.
„Also wirklich, verdammte Scheiße!!“ schimpfte er weiter. „VERDAMMTE SCHEISSE! Lernt ihr denn heutzutage überhaupt nichts mehr in der Schule?!“ Er holte tief Luft und schaute in den nachtschwarzen Himmel, ehe er sich runterbeugte und mit normaler Stimme sagte: „Ist dir was passiert?“
„Das Knie!“ jammerte ich kleinlaut und spürte, wie die Tränen sich in den Augenwinkeln sammelten. „Das Knie – aua, das Knie! Ich glaub, es ist – aua!“
„Bleib ruhig liegen, ich werde es mir mal anschauen“, sagte er und hockte sich neben mich.
Was für eine Type, dachte ich immer wieder. Er war bestimmt schon über vierzig, aber der Trenchcoat, die Jeans und die wirren, ziemlich langen dunklen Haare ließen ihn etwas jünger aussehen.
Er schob die Brille hoch, so daß sie in seinem lockigen Schopf hängenblieb, und steckte die Hand in die Manteltasche. Er wühlte und wühlte, und trotz der Schmerzen im Knie fragte ich mich, was er wohl vorhatte.
„Ah!“ rief er dann mit einem Seufzer. „Hier ist es!“
Dann schaute er mich an und holte grinsend einen länglichen, schwarzglänzenden Gegenstand hervor.
Ich hatte zwar noch nie ein richtiges Stilett in natura gesehen, aber ich wußte sofort, was es war. Dann versuchte ich, mich zu beruhigen. Mit einer unglaublich gefaßten, ruhigen Gedankenstimme sagte ich mir, daß der Gegenstand natürlich eine Taschenlampe oder ein Feuerzeug oder etwas in dem Stil ist. Sei nicht so blöd und kindisch, sagte ich in Gedanken zu mir selbst, es ist doch klar, das ist kein Stilett.
Es war ein Stilett.
Er grinste mich immer noch an, als das größte Messer, das ich je gesehen habe, mit einem scheußlichen, unangenehmen Geräusch aus dem schwarzen Gegenstand herausschnellte. Es klang ungefähr so:
Plhopp!
Da geriet ich in Panik.
„ABER?! Aber?! W-w-w-as machst –!!!“ schrie ich, ruderte mit den Armen und versuchte aufzustehen. Ich hatte mein zertrümmertes Knie vergessen, ich stand unter Schock und wollte nur eins – weg.
„Immer mit der Ruhe, mein Junge“, murmelte er, beugte sich über mich und drückte mich gleichzeitig mit dem einen Knie auf den Boden. „Immer mit der Ruhe. Ich will dich nur... ich will dich nur untersuchen und eine Diagnose stellen.“
Ich konnte mich nicht befreien. Ich starrte auf meine Beine und sah, wie er den Stoff der Jeans an meinem Knie mit Daumen und Zeigefinder der linken Hand anhob. Und dann – dann sah ich das blitzende Stilett durch die Luft sausen, und dann schnitt er meine Jeans auf.
„A-a-ber!! Das sind meine besten Dobber“, jaulte ich und versuchte verzeifelt, mich zu befreien.
„Reg dich ab, verdammt noch mal. Halt still!!“ Ich verstand überhaupt nicht, warum, aber ich tat, was er sagte – ich hielt still. Ich legte den Kopf auf den naßkalten Asphalt und starrte mit leerem Blick ins Dunkel. Aha, dachte ich, in so jungen Jahren also gerate ich an einen Stilettpsychopathen, der meinem allzu kurzen Leben ein Ende setzt. Genau so, wie man es so viele Male im Kino und im Fernsehen gesehen hat. Verrückte und Psychopathen haben mir schon immer Angst gemacht, eben gerade weil sie verrückt sind. Denen kann doch in den Sinn kommen, irgend jemand ohne jeden Grund abzumurksen. Aber jedesmal, wenn ich so einen Film gesehen hatte, konnte ich mich damit beruhigen, daß so etwas ja nicht in Wirklichkeit passiert – auf jeden Fall nicht hier in Schweden. Aber es passierte in Wirklichkeit.
Ich hob den Kopf und schaute ihn an. Der große schmutzige Trenchcoat lag wie ein Zelt um ihn herum. Er starrte auf mein Knie – oder das, was noch davon übrig ist, dachte ich.
„Hmmm...“ brummte er besorgt und schob die Sonnenbrille runter.
„Was ist denn?!“ krächzte ich. „Muß ich genäht werden?“
„Was? Genäht? Nee, nee...“ murmelte er und schüttelte den Kopf. Er wandte mir seine schwarzglänzende Brille zu und schob die gigantische Messerschneide zurück. „Kein Grund zur Sorge“, sagte er und lächelte. „Du hast dich nur ein bißchen aufgeschürft.“
„Mich ein bißchen aufgeschürft?! Was soll das denn heißen. Ich bin doch mehrere Meter hoch in die Luft geflogen und –“
„Reg dich ab. Ich habe einen Verbandskasten im Auto. Das kriegen wir schon geregelt. Aber steh jetzt auf, du wirst doch ganz naß, wenn du da liegst.“ Er steckte beim Aufstehen das Stilett in die Tasche, drehte sich um und ging zum Lieferwagen. Die Absätze klackerten metallisch auf dem Asphalt.
Absatzeisen, dachte ich, typisch. Das sind bestimmt solche schrägen Cowboystiefel.
Ich setzte mich auf. Ich seufzte und stöhnte und brummte und zog die Nase hoch. Mit halbgeschlossenen Augen schaute ich vorsichtig auf mein Knie. Ich wollte es mir anschauen, aber gleichzeitig absolut nicht sehen. Und in so einer Situation schaut man mit halbgeschlossenen Augen – man macht die Hälfte von beidem, gewissermaßen. Ich war fest davon überzeugt, eine blutige, vermatschte Wurst mit herausragenden Knochensplittern zu sehen.
Ich war sehr erstaunt, als ich sah, daß das Knie immer noch ganz war. Nur viele kleine, rote Punkte auf der Haut. Man konnte nicht einmal behaupten, daß es Blutstropfen waren, es sah eher aus wie Tau – Bluttau. Aber es tat weh. Sehr weh.
Ich kam langsam hoch, setzte den linken Fuß auf und spürte sofort einen Stich im Knie. Ich machte einen Schritt. Das Bein blieb dran. Es tat fürchterlich weh, aber vielleicht, dachte ich, vielleicht komme ich doch um eine Amputation herum, wenn ich ein bißchen Glück habe.
Ich humpelte zum Lieferwagen. Der Irre im Trenchcoat war hinters Steuer geklettert und hatte den Zündschlüssel abgezogen. Er kam wieder heraus und ging mit flatternden Rockschößen zur hinteren Tür.
Ich starrte auf mein gewesenes italienisches Moped. Es lag auf dem regenglatten Asphalt, und der gespenstische organgefarbene Schein der Straßenlampe glitzerte auf dem Metall. Ich hatte es erst seit einem halben Jahr, und jetzt war es ganz kaputto. Finito mopedo. Sempre ruinato. Das Vorderrad sah aus wie eine Acht, und die vordere Radgabel war zu einer Schere zusammengedrückt worden und hatte fast alle Speichen abgeklemmt.
Was wird Mama sagen? dachte ich. Von Papa gar nicht zu reden.
Dann fiel mir ein, daß dieser Stilettpsychopath natürlich alles bezahlen mußte. Natürlich, selbstverständlich. Und das bedeutete, daß ich ein ganz nagelneues Moped bekommen würde.
Das Knie tat gleich ein bißchen weniger weh.
Ich humpelte zur hinteren Tür des Lieferwagens, die jetzt offenstand. Er war hineingeklettert und machte einen schrecklichen Krach da drinnen. Ich konnte nur seinen Mantel erkennen, der wie eine gräuliche Fledermaus im Dunkel herumflatterte.
„Hör mal, du, wie können das ja wohl im guten regeln, oder?“ Er klang genauso zerstreut wie unser Chemielehrer Jansson, wenn er so ein bescheuertes Experiment aufbaut.
„Was?!“ rief ich schockiert.
„Ja, verdammt – das wird doch sonst so kompliziert, und außerdem kann es ziemlich teuer werden für dich.“
„Teuer?!“ brüllte ich.
„Ja, klar... hmmm...“ Es klirrte und polterte da drinnen, klang fast so, als ob er eine Kiste mit Flaschen umgestoßen hätte. Er fluchte und knurrte vor sich hin. „Wo zum Teufel ist er bloß hingekommen? Aber hör mal. Wenn wir so sagen: Du kriegst ’nen Fuffi von mir, dann kannst du dein Moped reparieren, und wir vergessen den Rest. Da hast du ihn!“
Was ist das bloß für ein Vollidiot? dachte ich. Sehe ich vielleicht aus wie zwölf? Macht er sich lustig über mich? Mein Gott, wie lange wird man noch wie Dreck behandelt, nur weil man „jung“ ist? Wenn er glaubt, daß ich so bescheuert bin, dann hat er sich verrechnet, das kann er sich merken, mich behandelt man nicht so, mich nicht, dachte ich.
„Was hast du gesagt?“ schrie ich und versuchte, so richtig außer mir zu klingen, so wie mein Vater manchmal am Telefon. „Du mußt selbstverständlich für alles löhnen, ist doch wohl logo!“ „So, so, und das bildest du dir ein?“ sagte er ruhig, und es klang fast so, als ob er lachen würde.
Plötzlich sprang er heraus und landete direkt neben mir. Er hatte eine viereckige Holzkiste in der Hand, ich sah ein rotes Kreuz auf dem Deckel. Er sagte nichts, schaute mich nur mit einem merkwürdigen Blick und einem etwas schiefen Lächeln an. Dann kratzte er sich mit einem schabenden Geräusch unterm Kinn. Vor einigen Tagen schon hätte er sich rasieren müssen, dachte ich. Sein Blick ließ mich nicht los, und ich spürte, daß ich etwas sagen mußte.
„Aber das ist doch klar“, sagte ich. „Das ist doch eine Einbahnstraße!“
Seine bartstoppelkratzende Hand hielt inne, das Lächeln gefror, und die Mundwinkel rutschten langsam nach unten.
„Einbahnstraße?“ rief er dann aus, und es klang zutiefst erstaunt. „Bist du da ganz sicher?“
„Und ob. Ich wohne schließlich hier. Und außerdem ist die Straße, aus der du gekommen bist, auch Einbahnstraße – in die gleiche Richtung.“ Er starrte mich mit halboffenem Mund an und sah ziemlich bescheuert aus. „Da hinten steht ein Schild“, sagte ich etwas verwirrt und zeigte mit einem steif ausgestreckten Arm in die Richtung. Sein Blick folgte meinem Arm, und die Hand nahm das Kinnkratzen wieder auf.
„Sind das alles beides Einbahnstraßen? Verdammte Scheiße...“
Er dachte einen Moment nach, dann zuckte er mit den Schultern. „Aber – na ist auch egal. Jetzt wollen wir mal sehen!“
Er stellte die Kiste ab, drehte sich und packte mich mit beiden Händen um den Bauch. Bevor ich auch nur blinzeln konnte, hatte er mich hochgehoben und auf die Ladefläche gesetzt (oder wie immer das bei einem Lieferwagen heißt), so daß ich da mit baumelnden Beinen saß.
Ich kam mir total lächerlich vor. Mit einem einzigen Handgriff hatte er mich auf das Niveau eines Kindergartenbabys erniedrigt. Es war schrecklich. Ich merkte, wie mir glühheiß im Gesicht wurde, und ausnahmsweise war ich froh, daß es Oktober und stockdunkel war und die Straßenlampen im Vorort nicht so dicht standen.
„Zieh die Jeans runter“, sagte er ruhig und machte die Verbandskiste auf.
„Aber mein Gott!!“ explodierte ich. „Fahr mich doch nach Hause! Ich wohne nur ein paar Häuser weiter!“
„Nein, nein, nein“, sagte er bestimmt und mit ruhiger Stimme. „Kommt überhaupt nicht in Frage. Guck mal. Das Verbandspaket aus der Armee! Hier gibt es einen Vorrat, das kann ich dir sagen! Und eine Flasche Jod! Ich muß zuerst den Schaden reparieren, den ich dir zugefügt habe.“
Ich seufzte und verstand nicht, warum ich tat, was er mich geheißen hatte – aber ich tat es. Ich machte den Knopf auf, zog den Reißverschluß runter und dann die Jeans bis unters Knie.
Das darf doch wohl nicht wahr sein, dachte ich. Da sitze ich in der offenen Tür eines schrottigen, alten Dodge-Ram-Lieferwagens mit heruntergelassenen Hosen in nicht allzu sauberen Unterhosen, und das alles an einem diesigen Oktoberabend.
Er schob die Sonnenbrille in die Stirn und inspizierte mein Knie mit gerunzelten Augenbrauen. Dann nahm er einen Wattebausch aus der Kiste, schraubte den Deckel einer braunen Flasche ab, die aussah, als würde sie aus einem Apothekenmuseum stammen. Er legte die Watte über die Öffnung, kippte die Flasche, und dann betupfte er mein blutbesprenkeltes Knie. Ich zuckte unfreiwillig zusammen – nicht weil es weh tat, sondern weil es so kalt war.
„So, so, das ist gar nicht schlimm“, sagte er mit gekünstelter, saudummer Stimme. „Braver Bub.“
Gleich zieh ich ihm eins über die Rübe, dachte ich.
„Wir müssen es ganz gründlich saubermachen“, redete er weiter. „Damit keine Infektionisten reinkommen.“
Infektionisten? Was redet der bloß?
„So... so. Das sieht sehr gut aus“, murmelte er zufrieden. „Kein Grund zur Sorge.“
„Und woher willst du das wissen?“ fragte ich störrisch. „Bist du vielleicht Arzt?“
„Genau“, sagte er, und es klang so ernst und sachlich, daß ich ganz durcheinander kam.
Er nahm noch einen Wattebausch und wiederholte die Prozedur.
„Wie heißt du denn überhaupt?“ fragte er, ohne aufzuschauen. „Kevin.“
„Kevin? Klingt nicht sonderlich schwedisch.“
„Meine Mutter ist Engländerin.“
„Ah. Old Britain. I see, young man.“
Ich habe zwar schon mal schlechteres Englisch gehört – aber nicht sehr oft.
Mit einem Ritsch riß er die Verpackung des Verbands auf und zog ein dunkelgrünes Stoffteil mit langen, baumelnden Bändern heraus. Die eine Seite war weiß, und die legte er vorsichtig auf mein Knie. Dann wickelte er die Stoffbänder herum und machte eine total alberne Schleife.
„So! Was für ein entzückendes Kniepäckchen. Das solltest du per Express an deine Liebste schicken.“
Ich verstand überhaupt nicht, wovon er redete. So ein peinsamer Vollidiot, dachte. Und doch... Ich fand ihn zwar so daneben, wie ich noch nie jemanden getroffen hatte, gleichzeitig fand ich ihn auch, ja, gar nicht so... daneben. Oder: er war natürlich voll daneben, aber irgendwie anders... Und er hatte was, das ich –
Weiter kam ich nicht in meinen Gedanken.
„Viel besser, als Ohren zu schicken!“ sagte er grinsend und schlug den Deckel des Verbandskastens zu.
„Wie besser als Ohren?“ murmelte ich und zog vorsichtig die Jeans wieder hoch.
„Hast du noch nie was von van Gogh gehört? Vincent?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Dem Künstler? Dem mit den Sonnenblumen? Aber du mußt doch schon mal was von Vincent van Gogh gehört haben?“ Als ich wieder den Kopf schüttelte, zuckte er hilflos mit den Schultern. „Unglaublich. Aber wie auch immer, er hat sich mal das eine Ohr abgeschnitten, dann hat er es in ein Päckchen gepackt und an eine Braut geschickt, auf die er scharf war.“
„Und warum?“ fragte ich und zog den Hosenladen zu.
„Gute Frage. Er war vielleicht betrunken und wahnsinnig, ist doch klar.“ Er warf den Verbandskasten achtlos in den Lieferwagen, er polterte umher und stieß klirrend an leere Flaschen. „Verdammt, ich muß sie irgendwann mal abgeben... Wie alt bist du überhaupt?“
„Üchzehn“, sagte ich undeutlich und hoffte, daß er nicht nachfragen, sondern glauben würde, siebzehn, mindestens aber sechzehn gehört zu haben. Ich hatte keinerlei Lust, darüber zu reden. „Und wie heißt du?“ fragte ich schnell und schaute ihn an. Mir wurde eiskalt vor Schreck, weil er wieder in der Manteltasche wühlte, mein Herz schlug die Voodootrommel. Stilett, Stilett!
„Schröder“, sagte er ruhig und bekam mit einiger Mühe seine Hand wieder aus der Tasche. Er nahm eine Zigarette aus einem blauen Paket und steckte sie in den Mundwinkel.
„Schröder?“
„Ja, genau. Schröder“, nickte er und strich ein Streichholz an. Er hielt schützend die Hände um die Flamme und zündete die Zigarette an. Es fing fürchterlich zu stinken an. „Raymond Schröder“, sagte er, machte einen tiefen Zug und warf das Streichholz weg. „Aber du kannst zu mir sagen, was du willst.“ Ich will am liebsten überhaupt nichts zu dir sagen, dachte ich. Ich will nur hier weg.
„Das... das klingt auch nicht sonderlich schwedisch“, sagte ich und rutschte ein Stück von der stinkenden Zigarette weg. „Doch, sehr sogar“, sagte er mit einem halbunterdrückten Lachen. „Es ist ein richtig ehrbarer, uralter schwedischer Name. Was Schwedischeres als die Einwanderer Schröder aus Deutschland gibt es überhaupt nicht.“
Es klang, als sei er selbst der Meinung, etwas unglaublich Witziges gesagt zu haben.
Dieser Meinung war ich nicht.
Er nahm noch einen tiefen Zug und stieß den Rauch mit einem lauten Geräusch durch Mund und Nase aus – genau mir ins Gesicht. Ich konnte mich gerade noch wegducken.
„Ahh!“ stöhnte er gekünstelt. „There’s nothing like fresh air mixed with tobacco, sagte schon Humpy, bevor er Lungenkrebs bekam und vorzeitig starb.“ Er klappte den Trenchcoatkragen hoch und hob die Schultern, als würde er frieren. „Nein, wir können hier nicht die ganze Nacht rumlümmeln. Wir haben noch was zu tun. Du mußt mir helfen, den Weg zum Skiftesväg zu finden. Du kannst das bestimmt besser als ich. An und für sich wohne ich auch hier in der Gegend, aber ich kann nur den Weg nach Täby Zentrum und in die Stadt – ansonsten bin ich completely lost.“
„Aber – ich muß doch heim“, protestierte ich.
„Papperlapapp!“ schnaubte er. „Es dauert nicht lang, und ich bringe dich dann nach Hause. Los jetzt!“