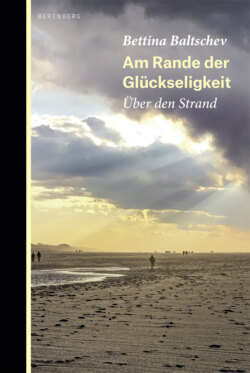Читать книгу Am Rande der Glückseligkeit - Bettina Baltschev - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prolog
Оглавление»So weit das Auge reicht.« Diese Redewendung muss hier erfunden worden sein. Kein Hindernis hält meinen Blick auf, kein Haus, keine Hütte und kein Boot, kein Strandkorb, kein Schild und kein Pfahl. Dass trotz dieser Aussicht nur wenige Menschen an den Balg im äußersten Osten von Schiermonnikoog finden, liegt daran, dass er fernab des einzigen Dorfes liegt. Zwar ruckelt dreimal am Tag ein Traktor über den großen Strand der Nordseeinsel hierher, einen kantigen Kasten mit zwei Dutzend Leuten hinter sich her ziehend, aber die bleiben nur eine halbe Stunde, dann bläst der Fahrer zur Rückkehr. Ich bin zu Fuß gekommen, und je weiter ich lief, desto ruhiger wurde mein Atem, obwohl der Seewind mir ordentlich ins Gesicht blies und sich die Salzluft tief in meine Lungen setzte. Bald war außer Wind und Wellenschlag nichts mehr zu hören, es schien, als hätten selbst die Möwen aufgegeben. Ein Sanderling war mein letzter Begleiter.
Er verließ mich, lange bevor ich über den schwarz-weißen Turnschuh stolperte, der halb vergraben im Sand lag, das Leder von einem rosa schimmernden Algenfilm überzogen.
Die Soldaten müssen ihn übersehen haben. In Kompaniestärke waren sie angerückt, um den Strand aufzuräumen, der einer Müllhalde glich, nachdem ein Orkantief – vom Finnischen Meerbusen kommend – sich in einem Hoch über Großbritannien verfing. Die Nordsee hatte so gewütet, dass haushohe Wellen hartnäckig gegen den eisernen Koloss geknallt waren und er bald zu schwanken begann. Erst leicht, dann stärker, bis sich die ersten Container über die Reling des Schiffes schoben, das der Reeder drei Jahre und fünf Monate zuvor nach seiner vierjährigen Enkelin Zoe benannt hatte. (Nach der Schiffstaufe im Hamburger Hafen war sie fröhlich mit einem Plüschtier den Kai entlanggerannt.) Als die Container schließlich aufbrachen und ihre Fracht dem Meer übergaben, wurde sie im Rhythmus der Gezeiten an die Strände der friesischen Inseln gespült. Es ist nur ein Turnschuh, denke ich und bin doch irritiert, weil ich an diesem Ort nicht mit zivilisatorischen Spuren gerechnet habe und mehr noch, weil der Schuh mich daran erinnert, dass auch dieser Strand seine Unschuld längst verloren hat.
Nun hocke ich im nassen Sand, ganz nah am Wasser, dessen milchiges Blau in der Ferne zu Himmel wird, und wünschte, ich könnte dem Weltenlauf Einhalt gebieten, alle Havarien, die der MSC Zoe genauso wie meine eigenen, für einen Moment vergessen. Dazu kommt man doch an den Strand, nicht wahr? Um uit te waaien, wie die Niederländer das nennen, sich vom Seewind durchpusten zu lassen, den Kater vom Vorabend im Meer zu versenken und alle schweren Gedanken und schlechten Stimmungen gleich mit. Und wenn man Glück hat, weht einem derselbe Wind frische Ideen zu, Zuversicht und Gottvertrauen. Mir gelingt es an diesem Ort immerhin, die Strände meines Lebens zu sortieren. In blassen Farben zeichnen sie sich am Horizont meiner Erinnerungen ab. Binz, Zandvoort, Varengeville-sur-Mer, Cadiz, Sperlonga, Heraklion … Mein Europa besteht nicht zuletzt aus Stränden.
Wobei ich bald bemerke, dass die Erinnerung mir ein Schnippchen schlägt und keinen Unterschied macht zwischen realen und fiktiven Gestaden. Mehr noch, manche der erfundenen sind sogar gegenwärtiger, vielleicht weil ich sie besuchen kann, ohne aufbrechen zu müssen, ein Griff ins Bücherregal genügt. Schon blitzen Szenen von zwei Stränden auf, die gegensätzlicher nicht sein können. Einer liegt an der Côte d’Azur, wo die siebzehnjährige Cécile mit ihrem Vater und dessen junger Geliebten Elsa den Sommer verbringt und dabei keinen einzigen Gedanken an den Ernst des Lebens verschwendet. Herrlich! Als ich Bonjour Tristesse von Françoise Sagan zum ersten Mal las, war ich fast genauso alt wie Cécile, das Mittelmeer für mich unerreichbar und würde es auch bleiben, wenn ich nicht plante, das Land für immer zu verlassen. Aber dafür war ich noch zu jung, in den 1980er Jahren in der DDR. Umso sehnsüchtiger träumte ich mich nach Südfrankreich, inhalierte jede Zeile dieses kleinen frivolen Romans, während es im Erfurter Neubauviertel nicht weniger sommerlich heiß war als an der Côte d’Azur. Auch der Himmel war nicht weniger blau über der Moskauer Straße, aber es fehlte das Meer, der Wind, der Sand, der Duft der Pinien, es fehlte an so vielem, was den süßen Sommer Céciles ausmacht: »Ich war vom frühen Morgen an im Wasser; es war frisch und durchsichtig, und ich grub mich hinein und tobte mich aus. Ich wollte mich von allen Schatten und allem Schmutz der Stadt reinigen. Dann streckte ich mich im Sand aus, ergriff eine Handvoll und ließ ihn in einem weichen, gelblichen Strahl durch meine Finger rinnen. Er verrinnt wie die Zeit, sagte ich mir – was für ein einfacher Gedanke, und wie angenehm es war, einfache Gedanken zu haben! Es war Sommer.« Und Sommer ist es auch am Strand von Travemünde, der mir seinerzeit zwar geografisch näher, aber gleichfalls so unerreichbar war, dass mir nur blieb, mit Thomas Manns Buddenbrooks zu reisen und gemeinsam mit Morten Schwarzkopf, Sohn des Lotsenkommandeurs, und Tony, Tochter des Konsuls, selige Stunden am Ostseestrand zu verbringen. Wie Cécile ist auch Tony an diesem Ort im Glück. »Es ist merkwürdig, daß man sich an der See nicht langweilen kann, Morten. Liegen Sie einmal an einem anderen Orte drei oder vier Stunden lang auf dem Rücken, ohne etwas zu tun, ohne auch nur einem Gedanken nachzuhängen …« Dass Morten, ihre erste und vermutlich einzige wahre Liebe, aus Standesgründen nicht ihr Ehemann werden darf und sie stattdessen zwei windige Kaufmänner heiraten wird, die arme Tony ahnt es in diesem Moment noch nicht.
Ich gebe zu, was die amourösen Verwicklungen angeht, so war ich mir im Alter von Cécile und Tony noch längst nicht im Klaren darüber, welche Variante – die tragisch-ernsthafte oder die heiter-verspielte – ich bevorzugen würde. Unbedingt aber wollte ich wie die beiden ans Meer, wollte einfachen oder gar keinen Gedanken nachhängen und – natürlich – der Liebe begegnen. Wie prosaisch wirken dagegen die Erinnerungen an meine ersten realen Strände, keine Liebe weit und breit, stattdessen Wind und Doppelstockbett. In den Familienferien auf Usedom wehte uns in einem großen Haus mit weißen Bodenfliesen der Strand ins Zimmer und in die Kleider. Der Gang hinunter ans Meer wurde vom Sturm verleidet. Im Ferienlager auf Rügen war der Ausflug an den Strand ein Großmanöver, das mit dem hoffnungslosen Versuch begann, hunderte Kinder in Reih und Glied aufzustellen. Dennoch erreichten wir früher oder später das Meer und schlugen uns in abgezählten Gruppen hinein, während die Betreuer beteten, dass wir vollzählig und lebendig zurückkehren würden. Doch dauerte es nach diesem Sommer nicht mehr lang und mir standen Céciles und Tonys Strände offen, die ich seltsamerweise nie besuchen sollte, vielleicht um der Enttäuschung zu entgehen, dass die Wirklichkeit der Fiktion nicht selten unterliegt. Stattdessen zog ich in das Land, das sich am Strand erfunden haben muss, so viel Land haben die Niederländer dem Meer abgerungen. Ich wanderte über die Strände zwischen Domburg und Texel und wurde süchtig nach der großen blassen Weite, die mir – nur so kann ich es mir erklären – in den ersten Jahren meines Lebens offensichtlich gefehlt hatte. Warum sonst kehre ich bis heute immer wieder zurück, zu jeder Jahreszeit, bei Wind und Wetter, mehr noch seit ich am Strand von Bergen aan Zee tatsächlich der Liebe begegnet bin (heiter-verspielt)?
Diesmal also der Strand von Schiermonnikoog, einer der größten auf dem Kontinent, der zudem noch immer wächst, weil die vor der Insel liegenden Sandbänke sich langsam, aber stetig an Land schieben. Ich bin mittlerweile nicht mehr allein auf dem Balg, der Traktor aus dem Dorf ist gekommen, dem kantigen Kasten entsteigen Leute in bunten Jacken und schweren Schuhen. In alle Richtungen schwärmen sie aus, fotografieren die Landschaft und sich darin, während der Fahrer eine Zigarette raucht. Man sieht ihm an, dass er sich fragt, was es hier schon zu sehen gibt außer Wasser, Sand und einem großen Nichts. Und er hat ja recht, so ein Strand macht für sich selbst genommen herzlich wenig her. Nichts ist öder als eine endlose Fläche grauen, weißen oder gelben Sediments, auf das farblose Wellen schlagen, unaufhörlich und immerzu. Aber nichts ist eben auch verführerischer, nichts lässt mehr Raum für Visionen und Sehnsüchte als gerade dieser Ort, dieses fluide Grenzgebiet zwischen den Elementen, in dem wir sehen, was wir sehen wollen. Ein Strand ist für uns ein Gefüge aus Erinnerungen, Erfahrungen und Erwartungen. Wir sehen, um mit Michel Foucault zu sprechen, einen »anderen Raum«, eine realisierte Utopie, und unser Staunen über den großen leeren Balg ist auch deshalb so groß, weil wir eine Art Urstrand erleben. Hier fehlt es an allem, was anderswo zur Norm geworden ist, an Zeichen kultureller Aneignung, an Überresten von Geschichte, die sich unübersehbar über die Strände geschoben und sie zu Schauplätzen moderner Zivilisation gemacht haben.
Der Traktorist hat aufgeraucht und ruft seine Leute zusammen, einige wollen bleiben und später zu Fuß zurück ins Dorf. Ob sie es sich gut überlegt haben, fragt er, aber das haben sie. Auch ich mache mich auf den Rückweg, bin uitgewaaid genug, um einen Plan zu fassen. Von Schiermonnikoog, dieser »Insel der grauen Mönche«, werde ich an Strände reisen, die mehr als andere zu Geschichtsorten geworden sind. Ich will verstehen, wie es der Mensch vermochte, sich die öden Landschaften an den Rändern Europas zu erobern, Spuren im Sand zu hinterlassen, die auch das stärkste Orkantief nicht verweht.