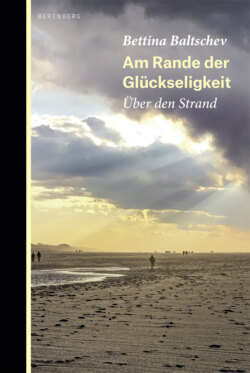Читать книгу Am Rande der Glückseligkeit - Bettina Baltschev - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Scheveningen »Aber ansonsten war es ein tobendes Stürmchen«
ОглавлениеEin Junge sitzt in leuchtend blauer Badehose am Strand. Selbstvergessen greift er in den Sand und lässt ihn auf den spitz zulaufenden Hügel vor sich rieseln. Es ist eine unscheinbare Geste, die man bei Menschen am Strand immer wieder sieht, ein Ausdruck wohliger Trägheit, wenn Hände nichts anderes zu tun haben, als sich zu Sanduhren zu formen. Der Sand in Scheveningen eignet sich dafür besonders gut, er ist fein und ganz hell, im trockenen Zustand bildet er eine weißgraue, sanft hügelige Fläche, die in der Sonne glitzert und in der man tief versinkt. Wird sie nass, von Flut oder Regen, ist der Sand braun, schwer und vorn am Wasser von ungleich langen und tiefen Gräben durchzogen, in die das Meer rhythmisch einfährt, mit jeder Welle aufs Neue. Dort, wo der kleine Junge sitzt, ist der Sand trocken, er schaut nicht auf seine Hände, sondern guckt mal aufs Meer, mal um sich her und ist ganz still, ganz bei sich. Niemand stört ihn, niemand ruft ihn. Irgendwo zwischen dem bunten Badevolk, das etwas entfernt von ihm unter Sonnenschirmen hockt, werden wohl seine Eltern sein, nur ab und zu den Blick hebend, ob der Junge noch da ist. Aber keine Sorge, das ist er.
Wie überall an der holländischen Küste lehnt sich der Strand von Scheveningen breit und flach gegen die Promenade, auch bei Flut lässt er genug Raum für Besucher aller Art, denen, die am Meeressaum entlangwandern, genauso wie denen, die kommen, weil sie gerade nicht mehr wandern wollen. Junge Leute sitzen auf Handtüchern, ältere auf mitgebrachten Klappstühlen, in Familie, einzeln oder zu zweit, immer der Nordsee zugewandt, die in graugrünen Wogen friedlich ans Ufer schwappt. Ganz vorn gräbt eine Kindergartengruppe sehr konzentriert einen halbrunden Kanal, alle tragen leuchtende Westen und Mützen, damit kein Kind abhandenkommt. Die meisten Leute haben sich unweit vom Kurhaus und von De Pier niedergelassen, der zweistöckigen Seebrücke, die sich als Food Court präsentiert und an deren Ende sich ein Riesenrad dreht. Auch die Strandlokale sind hier nicht weit, die um den Titel des angesagtesten Beachclubs wetteifern, mit exotischen Namen, viel Holz, Metall und weichen Polstern, in deren Ritzen sich der Sand sammelt. Die bunten Drinks, die hier serviert werden, funkeln in der Sonne, es riecht nach Gras, Barbecue und patat, holländischen Pommes. Den kleinen Jungen aber scheint das alles nicht zu interessieren, sein Sandhügel wächst stetig, und ich wüsste zu gern, was er gerade denkt. Ganz sicher stellt er sich keine großen Fragen, die ihn aus seiner Selbstvergessenheit herausholen könnten. Werde ich mich später an diesen Tag am Meer erinnern? Warum sitze ich so sorglos am Strand? Was ist eigentlich ein Strand?
Schon die Antwort auf diese letzte Frage ist einfach und kompliziert zugleich. Einfach, wenn man sie einem Geologen stellt, der nüchtern erläutern wird, dass ein Strand nicht mehr ist als ein flaches Gelände zwischen Festland und Meer (und kurz darauf zu einem detaillierteren Vortrag anhebt, der eigene Bände füllt). Komplizierter wird es, legt man die Frage einem Anthropologen vor, denn wie überall ist auch am Strand der Mensch das Problem. Weil er ihn eben nicht nur körperlich durchwandert oder sich mit Handtuch und Sonnenschirm im Sand postiert, sondern weil er seine psychische und emotionale Verfasstheit mitbringt, seine komplexen und egozentrischen Ideen über die Welt. Mit ihnen wird der Strand, wie der französische Kultursoziologe Jean-Didier Urbain schreibt, zu einem privilegierten Ort, »wo sich die Gesellschaft zur Schau stellt, mit ihren Riten und Symbolen, ihren festlichen Bräuchen und Konventionen, ihren Sehnsüchten und Normen, ihren Regeln und deren Überschreitungen, ihren Strategien der Koexistenz und den Codes des Sich-Niederlassens, ihrer Organisationslogik und schließlich ihres Gefühlsspektrums«.
Ich lasse mich Richtung Süden wehen, zum Fischerdorf, das Scheveningen lange war. In Gedanken schiebe ich das Wort hin und her, Strand, Strand, Strand, Strand. Man muss es nur oft genug aussprechen, dann bekommt es einen seltsam fremden Klang und man beginnt sich zu fragen, was das eigentlich für ein Wort ist, bei dem man schon am Anfang über drei Konsonanten stolpert und das, wenn wir ehrlich sind, nicht zu den schönsten deutschen Wörtern gehört. Es ist jedenfalls kein Zufall, dass es in fast allen germanischen Sprachen gleich geschrieben, aber überall ein bisschen anders ausgesprochen wird. Denn während wir Deutschen Sch-trand sagen, sprechen es beispielsweise die Niederländer und Schweden so aus, wie es dasteht: s-trand (in Island geht man übrigens an den s-trönd). Und einmal gedanklich im hohen Norden angekommen, liegt man, was die Herkunft des Wortes betrifft, schon vollkommen richtig, denn Matrosen bringen es im 13. Jahrhundert von ihren Reisen nach Skandinavien mit. Hierzulande spricht man seinerzeit eher von Gestade oder Ufer, doch macht der Strand die Runde und taucht kurze Zeit später auch schriftlich auf. In der preußischen Landeschronik des Nikolaus von Jeroschin heißt es Anfang des 14. Jahrhunderts im schönsten Ostmitteldeutsch: »bi einem wazzirvlize na / daz ist genant di Treidera, / uf des meris strande« (an einem Fluss namens Treidera, am Meeresstrand). Die romanischen und slawischen Sprachen leiten ihre Bezeichnungen für den Strand dagegen von plaga ab, dem lateinischen Wort für Raum oder Gegend, das im Französischen zu plage, im Spanischen zu playa, im Italienischen zu spiaggia und im Russischen zu pljasch wird. Und schließlich ist da noch das englische beach, das sich längst in allen Sprachen der Welt eingenistet hat. Beach verweist ursprünglich weniger auf das feste Ufer als auf das nasse Davor, denn es lässt sich auf das altenglische bece zurückführen, das einen Strom bezeichnet und mit dem deutschen Bach oder dem niederländischen beek verwandt ist. Im Englischen gibt es zwar auch das Wort strand, doch nur in Irland wird es für den sandigen Streifen am Meer verwendet. Engländer denken bei Strand vermutlich zuerst an eine Straße in London, die im Mittelalter die City of London mit der City of Westminster verbindet und am Ufer der noch nicht in Kaimauern gezwängten Themse liegt. Und auch dieser Strand hat sich in die Literaturgeschichte eingeschrieben, weil hier im 19. Jahrhundert Dutzende Buchhändler und Verlage zu finden sind, die die literarische Prominenz anziehen. Unter ihnen George Eliot, die hier wohnt, und Virginia Woolf, die hier flaniert. Und als Benjamin Bass, ein litauischer Immigrant, 1927 im New Yorker East Village eine Buchhandlung eröffnet, nennt er sie nach eben jener legendären Straße in London: Strand Bookstore. Ein Laden, der mit den längsten Bücherregalen der Stadt mittlerweile selbst zur Legende geworden ist.
Auf der anderen Seite des Atlantik, knapp sechstausend Kilometer nordöstlich von New York, werden, je südlicher ich komme, die Häuser am Boulevard von Scheveningen nach und nach kleiner, kantige Betonbauten werden von Seevillen der Gründerzeit abgelöst und irgendwann taucht das alte Scheveningen auf. Unterwegs erinnern auf der Promenade, die hier schlicht Strandweg heißt, alle paar hundert Meter große Tafeln mit historischen Bildern daran, wie sich das Fischerdorf zum Seebad ausgewachsen hat. Feest aan Zee. 200 jaar badplaats Scheveningen Den Haag heißt es da, doch die Tafeln sind nicht mehr ganz neu. Gezählt werden die Jahre nach 1818, als hier das erste Badehaus eröffnet wurde, genau an der Stelle, wo heute das Kurhaus steht, ein rot-weißer Palast, letzter Zeuge einer mondänen Vergangenheit. Man feiert die Geschichte des Seebades, doch die Geschichte des Strandes, will sagen die, in der der Mensch sich in der Landschaft zeigt, ist wie überall viel älter. Da sind zuerst die Fischer aus dem Dorf, für die der sandige Streifen am Meer ihr täglicher Arbeitsplatz ist. Wie ihre Vorväter auch holen sie aus der Nordsee, was sich verspeisen lässt, und weil es keinen Hafen gibt, sind es hier zumeist boomschuiten, für diese Gegend typische Segelschiffe mit besonders flachem Boden, die die Fischer, wenn sie vom Meer zurückgekehrt sind, an den Strand ziehen, um gleich vor Ort ihren Fang zu verkaufen. Doch es kommen auch Abenteurer an diesen Strand, die ihn weniger der Nähe zum Meer als der weiten leeren Fläche und des Windes wegen schätzen. So erlebt Scheveningen bereits über zweihundert Jahre vor Errichtung des ersten Badehauses eine Art Vorspiel auf dem Strande und wird zur Kulisse eines Aufsehen erregenden Spektakels, das den anwesenden Zuschauern eine Ahnung von der Zukunft gibt.
Auf einem Segelwagen lassen sich im Jahr 1602 drei Dutzend Männer mit der für das beginnende 17. Jahrhundert höllisch anmutenden Geschwindigkeit von vierzig Stundenkilometern über den Strand blasen, um zwei Stunden später Petten zu erreichen, ein Dorf rund neunzig Kilometer nördlich von Scheveningen. Gebaut hat diesen Segelwagen der Flame Simon Stevin, Naturwissenschaftler, Ingenieur und Erfinder in einer Person. Dass er sein avantgardistisches Fahrzeug gerade in Scheveningen ausprobieren darf, verdankt er seinem Freund, dem Statthalter Fürst Moritz von Oranien, in den Niederlanden besser bekannt als Maurits van Oranje. Dessen Vertrauen in Simon Stevin ist groß genug, um bei der Jungfernfahrt den Segelwagen selbst zu besteigen, begleitet von einigen unerschrockenen europäischen Diplomaten und dem Philosophen und Völkerrechtler Hugo Grotius. Der ist zu diesem Zeitpunkt zwar erst neunzehn Jahre alt, hat sich aber schon einen Ruf als Wunderkind erworben, das mit elf an der Universität von Leiden studiert und nur wenig später elegante lateinische Verse dichtet. Man stelle sich also vor, wie ein bis dahin nie gesehenes Gefährt voller nobler Herren an Netze knüpfenden Fischern und ihren Kunden am holländischen Strand entlangrast. Es werden wohl einige Kreuze geschlagen und Stoßgebete ausgerufen worden sein. God zij met ons! Doch wider Erwarten kommen die Segler tatsächlich heil in Petten an. Der Segeltörn zu Lande wird zum Triumph, die Nachricht davon verbreitet sich weit über die Landesgrenzen hinaus und hält sich, vielleicht auch, weil es einmal eine gute Nachricht ist, lange im kollektiven Gedächtnis. Noch 1760 lässt Laurence Sterne in seinem Tristram Shandy Onkel Toby die Sprache auf Simon Stevin bringen und darüber diskutieren, ob es nicht praktisch wäre, auch in England solche Wagen zu bauen, »denn es würde nicht nur bei Eilvisiten, wie sie beim weiblichen Geschlecht nun eben in der Regel einmal anfallen, ungemein förderlich sein, – vorausgesetzt, der Wind zeigte sich gefällig, – sondern es wäre auch von famoser Wirtschaftlichkeit, lieber die Winde einzuspannen, welche nichts kosten und nichts fressen, als Pferde, welche (hol sie der Teufel) ein Erkleckliches kosten und fressen.« Weit kommt Onkel Toby mit seinem Vorschlag jedoch nicht, Tristrams Vater widerspricht seinem Bruder vehement, schließlich würden doch gerade die »Konsumption« und die »Manufaktur« den Handel ankurbeln. Der Plan, Pferde durch Segelwagen abzulösen, so das abschließende Urteil, tauge rein gar nichts. In Holland dagegen ist man stolz auf die Erfindung. Willem Isaacsz. van Swanenburg hält sie in einem prächtigen Kupferstich fest, den er mit einem langen Gedicht des jungen Hugo Grotius umrahmt: aen den doorluchtichste Vorst Maurits van Nassauwen (an den durchlauchtigsten Fürst Moritz von Nassau). Und Hugo Grotius belässt es nicht bei einem Gedicht, sondern greift das Thema immer wieder auf, in unzähligen Reimen, deren Quintessenz sich in vier Zeilen findet, in denen er sich wünscht, auf solch einem Wagen einmal um den Erdball getragen zu werden.
Door de winden voortgedragen
langs de golven, op den grond,
Geef my enkel zulk een wagen,
En ik vaer den aerdbol rond.
Die imposante Ausfahrt des Stevin’schen Segelwagens ist so erfolgreich, dass er in den folgenden zwei Jahrhunderten immer wieder eingesetzt wird. Beim Betrachten des Bildes auf den Archivseiten des Amsterdamer Rijksmuseums frage ich mich, wie weit die Fantasie des Simon Stevin wohl gereicht haben mag. Ob er sich seinerzeit vorstellen kann, wie vierhundert Jahre nach seinem Abenteuer tausende Strandsegler über den holländischen Sand jagen, mit Geschwindigkeiten, bei denen selbst dem furchtlosen Ingenieur schwindlig werden würde?
Stevins jüngster Passagier lässt sich derweil nicht nur von technischen Wundern inspirieren, sondern auch von den Wundern der Natur. So erwähnt Hugo Grotius in einem seiner Segelwagen-Gedichte einen walvis, einen Wal, der eines Tages am Strand von Katwijk angespült wird und »so groß wie der ganze Strand« gewesen sein soll. Bereits zuvor, im Jahr 1598, hatte Grotius die Strandung eines Pottwals erlebt und dabei bemerkt, dass dies dem gewöhnlichen Volk wohl ein Zeichen für Unheil sein müsse. Inwieweit das seine eigene Interpretation ist, mit der er sich von seinen Zeitgenossen nur abzusetzen sucht, sei dahingestellt, doch natürlich verfehlt der Anblick solch eines riesigen Tieres seine Wirkung nicht. Auf einem Kupferstich von Jacob Matham scheint allerdings die Neugier der Menschen weit größer zu sein als die Ehrfurcht. Männer mit Hut und Maßband besteigen den Wal, einer untersucht die riesigen Zähne, rundherum drängeln sich Zuschauer, darunter viele Frauen und Kinder, es herrscht eine wahre Volksfeststimmung. Schließlich kann ein Wal dem Gläubigen nur gefährlich werden, wenn er lebendig und in der Lage ist, den Menschen zu verschlingen, gerade so wie Jonas, der seine Untreue gegenüber Gott mit drei angstvollen Tagen im Bauch eines »großen Fisches« bezahlen muss.
Was Hugo Grotius betrifft, so ist es eine traurige Volte des Schicksals, dass ausgerechnet der Mann, der sich auf Simon Stevins Segelwagen wagt, Wale bedichtet und sich in seinen weit bedeutenderen Schriften zum Völkerrecht unter anderem Gedanken darüber macht, wem nach einem Schiffbruch an den Strand gespülte Fracht gehört, an den Folgen just solch eines Unglücks stirbt. Auf dem Weg von Schweden nach Frankreich gerät sein Schiff im August 1645 auf der Ostsee in einen schweren Sturm und strandet vor der Küste Pommerns. Obwohl Besatzung und Passagiere gerettet werden können, fährt der Schock dem bereits von Krankheit gezeichneten Grotius so sehr in die Glieder, dass er zwar seine Reise fortsetzt, aber am 28. August 1645 in Rostock an Herzversagen stirbt. So bleibt ihm auch die Gelegenheit verwehrt, den von ihm befahrenen und bewanderten Strand auf den Leinwänden seiner Landsleute zu betrachten.
Denn nur wenige Jahre nach Grotius’ Tod entdecken die holländischen Maler des Goldenen Zeitalters den Strand als lohnendes Motiv. Sie stellen ihre Staffeleien schon zwischen den Dünen auf, als diese Landschaft jenseits der Fischerei kaum von menschlichem, geschweige denn von künstlerischem Interesse ist. So idyllisch uns heute die Gemälde von Jan van Goyen, Adriaen van de Velde oder Jacob van Ruisdael erscheinen, so revolutionär müssen sie ihren zeitgenössischen Betrachtern vorgekommen sein. Waren denen doch bisher vor allem Seestücke präsentiert worden, stürmische Wogen, Schiffbrüche, das Pathos der Elemente. Nun also große ruhige Landschaften, Flüsse und Bäume, Sand und sanfte Meereswellen, reinste Kontemplation.
Jan van Goyen malt den Strand von Scheveningen gleich mehrfach, von Den Haag aus, wo er lebt, hat er den kürzesten Weg. Seine Strandansichten sind auffallend lebendig, es wimmelt von Fischern und Händlern, Pferden und Hunden, Wagen und Booten. Ob es Morgen oder Abend ist, lässt sich am Licht erkennen, das die Landschaft mal grau, mal golden färbt. Adriaen van de Velde kommt 1658 aus Amsterdam nach Scheveningen und hält eine sommerliche Strandlandschaft unter lichten Wolkenfeldern fest, Frauen und Kinder stehen barfuß bei Fischern, boomschuiten liegen im Sand, ein Reiter galoppiert von links ins Bild, rechts steht ein einzelner Herr und blickt übers Meer. Es ist eine behagliche Szenerie, die sich aber erst wirklich erschließt, denkt man die politischen Zeitläufte mit. Hatte doch nur zehn Jahre vor der Entstehung dieses Gemäldes der Westfälische Frieden auch den Achtzigjährigen Krieg und mit ihm die spanische Fremdherrschaft der Niederlande beendet. Nach Jahrzehnten kriegerischer Auseinandersetzungen und ständiger Gefahr eines Angriffs über See kann die Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen, aufatmen und sich auf ihre nationalen Eigenheiten besinnen. Die flache holländische Strandlandschaft, der weite Blick übers Land und übers Meer gehören unbedingt dazu und weisen im übertragenen Sinne auf das Selbstbild einer toleranten Gesellschaft, in denen alle Stände gleich viel wert sind. »Strand, Himmel, Sonne und prächtige Wolkenbilder rücken in den Fokus der Malerei. Das Strandbild übernimmt die Aufgabe, das niederländische Ideal einer miteinander in Freiheit, Gleichheit und Harmonie lebenden Gesellschaft darzustellen und zugleich die Schönheit des Landes zu feiern«, schreibt die Kunsthistorikerin Susan Müller-Wusterwitz. Die holländischen Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts widmen sich so detailliert dem weiten Himmel und seinen Wolkenformationen, dass Potsdamer Geoforscher vierhundert Jahre später meinen, darin die Wetterkapriolen der Kleinen Eiszeit erkennen zu können. Vor allem Jacob van Ruisdael gilt ihnen als Virtuose der wirklichkeitsgetreuen Darstellung meteorologischer Erscheinungen. In der Tat ist das graublaue Wolkengebirge auf van Ruisdaels Gemälde Strand bij Scheveningen besonders imposant. Vielleicht ist es ein Herbsttag, die See ist bewegt, die Menschen am Strand tragen warme Kleider. Sie stehen beieinander, schauen aufs Meer, wo ein Segelboot schaukelt. Eine ruhige schöne Szene, die abseits politischer und meteorologischer Deutungen auch eine voller Gottvertrauen ist, das seinerzeit auf diesem immer noch recht unberechenbaren Sandstreifen durchaus nicht selbstverständlich ist, verläuft hier eben nicht nur eine geografische und geologische Grenze, sondern auch eine theologische, denn ein Leben ohne Gott ist im Goldenen Zeitalter nicht vorgesehen.
Doch auch wenn die Menschen in Nord-und Südholland sich früh an ihre flachen, breiten, leicht zugänglichen Strände wagen, überwiegen andernorts Furcht und Respekt vor dem Niemandsland, in dem eigene Gesetze herrschen, zum Beispiel am friesischen Wattenmeer. »Noch um 1600 wurden die Leichen von Zauberkundigen, Ketzern oder ehrlosen Soldaten in Wasserläufe geworfen, im Watt oder in Deichen begraben, vermutlich ebenfalls um die Rückkehr ihrer verirrten Seelen unter die Lebenden zu verhindern. Böse Geister, die in die Gemeinschaft der Lebenden eingedrungen waren, wurden verbannt, indem man sie auf das Deichvorland oder an den Meeresrand trieb«, schreibt der niederländische Historiker Otto S. Knottnerus. Dabei unterscheiden die Küstenbewohner kaum zwischen natürlichen und übernatürlichen Gefahren, ist die Angst vor Krankheiten, Stürmen und Überschwemmungen doch genauso groß wie die vor Meeresungeheuern und göttlicher Bestrafung. Zudem ist die schon erwähnte Geschichte von Jonas im Bauch des »großen Fisches« jedem Christenmenschen so gegenwärtig wie die der Sintflut, mit dem entscheidenden Unterschied, dass die tatsächlich jeden Menschen treffen kann: »Denn siehe, ich will eine Sintflut mit Wasser kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin ein lebendiger Odem ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen.« Wie leicht sich auf diese zwei Sätzen ein Angstgebäude errichten lässt, das über Jahrhunderte auf stabilem Fundament steht, beweisen Luthers Tischreden, in denen von einem »Meerwunder« berichtet wird, das einst zum Papst gebracht wurde. Als das Wesen weder essen noch trinken wollte, ließ der Papst es zurück ins Wasser werfen. Auf den Jubel des Papstes, wie »wunderbarlich« Gott »unter den Kreaturen auf Erden« sei, antwortet das Wesen: »Viel wunderbarlicher in dem Wasser!« Der Kommentar Martin Luthers lässt keine Zweifel zu: »Das ist der Teufel gewesen, denn er wohnet in den Wassern und großen Wäldern. Der Meerwunder hat man mehr gesehen, und es sind gewißlich Teufel.« Gehen wir ruhig davon aus, dass Luther zeitlebens keinen Fuß an irgendeinen Meeresstrand gesetzt hat. Was allerdings auch niemand von ihm erwartet, da er dreihundert Kilometer von der Küste entfernt zur Welt gekommen ist und damit keinen Grund hat, sich freiwillig teuflischen Gefahren auszusetzen. Die armen Menschen, die es qua Geburt an die Nordsee verschlagen hat, bekommen dagegen oft genug eine Ahnung, wie sich eine teuflische, pardon, eine göttliche Sintflut anfühlt. Vergeht doch im 17. und 18. Jahrhundert fast kein Jahrzehnt, in dem der »Blanke Hans« sich nicht wie ein Derwisch austobt. Allein die sogenannte Weihnachtsflut in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 1717 lässt die Deiche entlang der gesamten Nordseeküste brechen, von Dänemark bis in die nördlichen Niederlande, und gilt als größte Flutkatastrophe der europäischen Neuzeit. Über elftausend Menschen sterben, bei den Überlebenden sorgt der Tod zahlloser Rinder, Pferde, Schweine und Schafe für eine Hungersnot. Als der friesische Geistliche Conrad Joachim Ummen 1718 über die Ereignisse berichtet, spricht schon der Titel seines Büchleins Bände: Die Mit Thränen verknüpffte Weynachts-Freude Jeverlandes. Oder Eine ausführliche Nachricht der hohen Wasser-Fluht. Es folgen lange klagende Verse voller Fassungslosigkeit.
Und ach daß Jeverland auch solche Noht erlebet!
Ach daß der Wellen Macht durch unsre Dämme bricht!
Wovon das ganze Land mit großer Furcht erbebet.
Ach daß ein stummer Feind durch unser Herze sticht!
Die Wohlfahrt ist dahin, verborgen alle Wonne!
Man siehet nun nicht mehr die helle Glückes-Sonne!
Doch so tief der Schmerz bei Ummen auch sitzt, es gibt Hoffnung, Trost und einen Hinweis darauf, wie man sich mit dem Feind aussöhnen könnte. Nur vier Jahre nach der verheerenden Weihnachtsflut erscheint der erste Teil von Barthold Heinrich Brockes’ mehr als 5500 Seiten umfassender Gedichtsammlung Irdisches Vergnügen in Gott, einem Mammutwerk, einer groß angelegten Mission der Erweiterung des, um mit Jean-Didier Urbain zu sprechen, menschlichen Gefühlspektrums gegenüber dem christlichen Schöpfer. Denn der, so die Idee, begegnet uns eben nicht nur in Sturmfluten, sondern in allen natürlichen Dingen, weshalb wir ihm nicht ängstlich, sondern ehrfurchtsvoll entgegentreten dürfen und sollen. Allein das Gedicht Gottes Größe in den Wassern klingt bereits viel freundlicher und optimistischer als die Zeilen des leidgeplagten Conrad Joachim Ummen.
Ach Gott! unendlichs All, Du Brunnquell aller Dinge,
Gib, daß ich noch einmahl, was Dir gefällig, singe
Vom feuchten Element! Es sey, o Gott, das Meer
Ein Spiegel abermahl von Deiner Größ’ und Ehr!
Es folgen unzählige Verse, die das Meer zunächst auch als Ort des Grauens voller »Wunder-Thier’« und »Wallfisch-Heere« beschreiben. Doch ein paar Gedichte später hält der kluge Dichter inne und fragt sich, ob da nicht doch ein Wesen wäre, das größer und mächtiger als jedes Meeresungeheuer ist, das uns nicht nur des Meeres Brausen, Heulen, Brüllen beschert, sondern eben auch seinen spiegelglatten, im Sonnenlicht ruhenden Glanz. Ein Glanz, der sich auf das Davor des Meeres überträgt, wo Brockes endlich auch am Strand göttliche Spuren entdeckt.
Die Sandes-Körner selbst und Theilchen unsrer Erden,
Sind ebenfalls ja wirklich Creaturen,
Worinn, wenn wir den Geist mit unserm Blick verbinden,
Wir mancherley Vergnügen finden, (…)
Es kommet jeder Sand-Korn mir
Als wie ein kleines Glied
Der allgemeinen Mutter für.
Nun, so mag sich manch Küstenbewohner bald denken, wenn der liebe Gott sich auch in einem Sandkorn findet, warum soll ich mich dann nicht an den Strand wagen und einmal ein paar der abermillionen Körnchen durch meine Finger rieseln lassen? Der Junge mit der blauen Badehose, der in Scheveningen am Strand sitzt, ahnt in seiner Unschuld gar nicht, welche historische Errungenschaft seine kleine Geste bedeutet und welche geistigen Anstrengungen seiner Vorfahren es brauchte, um sie ihn überhaupt ausführen zu lassen.
Als ich vom Dorf Scheveningen zurückkehre, ist das Kind tatsächlich noch da. Seine Mutter hat sich zu ihm gesetzt. Sie schickt den Jungen mit einem Becher zum Meer, um Wasser zu holen, damit sie seine kleinen Hügel in eine Sandburg verwandeln können. Vorsichtig formen sie die Festungsmauern, zeichnen Fenster hinein und heben den Burggraben aus.
Ich dagegen breite unweit von ihnen mein Handtuch aus und frage mich, wie viele Gemälde holländischer Meister man wohl betrachtet haben muss, bevor man selbst so weit ist, sich frisch und frei den meteorologischen Erscheinungen auszusetzen? Die Niederländer sind fraglos frühe Vögel, doch nach und nach beginnen auch Menschen aus meeresferneren Gebieten ihrer eigenen Anschauung zu vertrauen und sich ihres Verstandes zu bedienen, wie es Immanuel Kant als Leitmotiv der Aufklärung ausgibt. Ein Mann, der die Anschauung zu seinem Lebensprinzip erklärt hat, ist Georg Forster. Er kommt nach Scheveningen bereits einige Jahre bevor es offiziell zum Seebad erklärt wird, übrigens begleitet von einem jungen Mann namens Alexander von Humboldt. Statt der fernen Länder, die sie schon bereisten und noch bereisen werden, wollen die Herren die Auswirkungen der Französischen Revolution auf den Heimatkontinent besichtigen. Von Mainz, wo Georg Forster zu diesem Zeitpunkt lebt, geht es über Lille und Antwerpen nach Den Haag, das, so zitiert der Autor ein populäres zeitgenössisches Bild, »schönste Dorf Europas«. Entlang einer »schönen schnurgeraden Allee von großen schattigen Linden und Eichen« fährt Forster auch ans Meer, wo es vor allem die Ruhe ist, die ihm augenfällig wird und die er bereits von den Bildern der holländischen Meister kennen könnte. Und obwohl der Naturkundler Forster am Strand von Scheveningen nichts findet, was ihm wert wäre aufzuheben, erfasst er mit geschultem Blick sofort die geologischen und botanischen Gegebenheiten: »Das Meer, welches in Holland überhaupt nichts mehr ansetzt, hat im Gegentheil hier einen Theil vom Strande weggenommen, und die Kirche, die sonst mitten im Dorfe lag, liegt itzt außerhalb desselben unweit des Meeres. Die vier Reihen von Dünen, etwa eine halbe Viertelmeile weit hinter einander, die man hier deutlich bemerkt, unterscheiden sich durch verschiedene Grade der Vegetation, welche sich in dem Maaße ihrer Entfernung vom Meere und des verringerten Einflusses der Seeluft vermehrt.« Nachzulesen sind diese Zeilen in den Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich im April, Mai und Juni 1790, das zehn Jahre später auch auf Französisch erscheint, was sein Autor allerdings nicht mehr erlebt. Sechs Jahre zuvor ist Georg Forster im revolutionären Paris einer Lungenentzündung erlegen. Aber vielleicht fühlen sich seine französischen Leser ja von der Lektüre inspiriert, ihr Gefühlsspektrum dem Strand gegenüber zu überdenken, das sich zwischen zögerlich bis verweigernd zu bewegen scheint, obwohl sie in drei Himmelsrichtungen über unendliche Kilometer eigenen Strand verfügen. Doch anders als in den Niederlanden ist das französische Festland offensichtlich groß genug, um die Meeressäume ein Leben lang zu meiden. Wer einen weiten Blick sucht, könnte ebenso einen der zahlreichen Hügel und Berge besteigen, wo man zumindest festen Boden unter den Füßen hat. Warum sich die Franzosen von den Gestaden lieber fernhalten, erklärt sich der französische Historiker Alain Corbin in seinem Prachtband Meereslust. Das Abendland und die Entdeckung der Küste so: »Das Gefühl der hier entstandenen Übereinstimmung zwischen Gott und dem Menschen genügt nicht, um den Gedanken an eine dauernde Bedrohung durch das Wasser aus dem Bewußtsein zu vertreiben. Insbesondere die Franzosen, die wenig Verständnis für die technischen Fertigkeiten der Holländer und die in Kauf genommenen Risiken zeigen, fürchten sich oft schon bei der bloßen Vorstellung, auf diesem ›Überschwemmungsboden‹ zu verweilen.« Regelrecht erstaunt nimmt man in Frankreich zur Kenntnis, dass man auf solch labilem Grund durchaus nicht die Ruhe verlieren muss. So steht zum Beispiel Denis Diderot, als er in den Jahren 1773 und 1774 die Niederlande erkundet, in Scheveningen tatsächlich das erste Mal in seinem Leben am Meer und schreibt darüber in seinem Bericht Voyage en Hollande: »Scheveningen war zu allen Jahreszeiten der Ort, an dem ich am liebsten spazieren ging.« Ihn rühren vor allem die Fischer und deren Frauen, von denen er annimmt, ihre Liebe sei »so rein wie zu Zeiten Evas«, allein weil sie einander so herzlich umarmen, sobald die Boote an Land gezogen sind. Mehr noch aber ist Diderot von der republikanischen Wirklichkeit Hollands angetan, von Religionsfreiheit und Handelsgeist, so sehr, dass für ihn selbst die meisterhafteste Malerei nicht mithalten kann. »Sollte der Handelsgeist diese fantastischen Künstler in ihrer Entwicklung behindert haben? Wie talentiert sie auch sein mögen, ihre Gemälde zeugen selten von einem Sinn für Geschmack, erhabenen Ideen oder Originalität.«
Die Niederländer beeindruckt solche Mäkelei kaum, sie hofieren ihre Meister, die Künstler wie die Ingenieure, die hunderte Quadratkilometer Überschwemmungsboden trockenlegen, das Meer zähmen und ihm mehr und mehr Land abtrotzen. Gemäß der Devise »Gott schuf die Erde, aber die Niederländer schufen die Niederlande« lassen sie sich den Schlaf höchstens von brechenden Deichen rauben und erkennen die göttliche Grenzziehung zwischen menschenfreundlichem Festland und menschenfeindlichem Meer schlicht nicht an, wie Alain Corbin schreibt: »Die Reise nach Holland sorgt im Abendland für eine zunehmende Bereitschaft, das Schauspiel des Meeres mit Bewunderung zu betrachten und Küstenspaziergänge zu unternehmen. Der ›Tourist‹ des klassischen Zeitalters identifiziert die Niederlande mit dem Meer. (…) Tatsächlich hat der Holländer es gewagt, dem Meer Grenzen zu setzen. Dabei hat er das Werk des Schöpfers nicht beeinträchtigt, sondern es mit Gottes Segen vollendet.« Jawohl, mit Gottes Segen und noch mehr technischem Verstand, der seinen Ausdruck nicht nur in rasanten Segelwagen findet, sondern auch und vor allem im Wasserbau. Dessen Entwicklung hängt selbstredend eng mit den topografischen Gegebenheiten zusammen, die zugleich dafür sorgen, dass der holländische Strand sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne leichter zugänglich ist als anderswo. Die Gemälde der holländischen Meister deuten es mit ihren weiten Himmeln bereits an, anders als in einer bergigen oder felsigen Landschaft, hinter der die See unvermittelt auftaucht, wird der Besucher der niederländischen Küste nicht plötzlich überwältigt, sondern kann sich dem erhabenen, dem schaurig-schönen Anblick allmählich nähern. Denn auch wenn das Land klein ist, hinter den Stränden lässt es der Natur ihren Raum. Zwar hat sich Den Haag immer dichter an den Strand gebaut, und die Tram aus der Stadt hält heute gleich hinterm Kurhaus, doch an großen Abschnitten der holländischen Strände durchstreift man auf dem Weg zum Meer vor allem breite Dünenlandschaften. Dicht bewachsen von Flechten, Moosen und niedrigen Buschwäldern, bilden sie die natürliche Vorbühne des Strandes, wo die Luft mit jedem Meter salziger wird, wo einem allmählich der Geruch der Nordsee in die Nase und das Rauschen in die Ohren dringt. Wenn schließlich alle Sinne in Habachtstellung sind, hebt sich hinter dem letzten hohen Hügel der Vorhang zum prächtigen Naturschauspiel. Das Meer ist da und das Herz schlägt ruhig.
Je auf ihre Weise tragen Naturkunde, Glaube, Malerei und Philosophie also dazu bei, auch bei den Menschen, die keine Fischer sind und das Meer nur vom Erzählen kennen, die gefährlichsten Meereswogen ihrer Vorstellungen zu glätten, die stürmischsten Winde ihrer Fantasien einzufangen und ihnen eine Einladung ans Meer ins Ohr zu flüstern, die an die vielzitierte Zeile Friedrich Hölderlins erinnert: »Komm! Ins Offene, Freund!« Und ja, langsam folgen noch die Strandfernsten dieser Aufforderung, kommen erst vereinzelt, dann immer zahlreicher ins Offene, ins Weite und Frische. Als 1818 in Scheveningen das erste Badehaus eröffnet wird und damit der erste badplaats in den Niederlanden entsteht, hinken die Holländer damit anderen Ländern sogar einige Jahre, ja Jahrzehnte hinterher. Angesichts ihrer Geschichte ist das durchaus erstaunlich, liegt aber wohl gerade an der Selbstverständlichkeit, mit der sie bereits angekommen sind, wohin andere erst aufbrechen müssen. Wer braucht schon ein exklusives Seebad, um Menschen ans Meer zu locken, die längst schon da sind? Anderswo in Nordeuropa ist man vor der Wende zum 19. Jahrhundert dabei, den Strand vom gefährlichen Niemands- in berückendes Jedermannsland umzuwidmen. Als Avantgardisten dürfen sich in diesem Falle die Engländer fühlen, die den Reiz ihrer eigenen Küsten entdecken, verschlafene Fischerdörfer zu seaside resorts ausbauen und öde Orte in Vergnügungsoasen verwandeln. In Deutschland braucht es dagegen erst einen prominenten Fürsprecher dieser neuen Form der Freizeitgestaltung, der sich in Georg Christoph Lichtenberg auch findet. Der Naturwissenschaftler und Schriftsteller aus dem meerfernen Darmstadt hatte England bereits mehrfach bereist, als er 1793 einen Aufsatz mit der Frage Warum hat Deutschland noch kein großes öffentliches Seebad? überschreibt und darin ausführt: »Allein wo sind die Orte, die, wie etwa Brighthelmstone, Margate und andere in England, in den Sommermonathen an Frequenz selbst unsere berühmtesten einländischen Bäder und Brunnenplätze übertreffen? Ich weiß von keinem. Ist dieses nicht sonderbar?« Um seine Leserschaft zu überzeugen, zieht Lichtenberg alle Register: »Der Anblick der Meereswogen, ihr Leuchten und das Rollen ihres Donners, der sich auch in den Sommermonathen zuweilen hören läßt, gegen welchen der hochgepriesene Rheinfall wohl bloßer Waschbecken-Tumult ist; die großen Phänomene der Ebbe und Fluth, deren Beobachtung immer beschäftigt ohne zu ermüden; die Betrachtung, daß die Welle, die jetzt hier meinen Fuß benetzt, ununterbrochen mit der zusammenhängt, die Otaheite [heute Tahiti] und China bespühlt, und die große Heerstraße um die Welt ausmachen hilft; und der Gedanke, dieses sind die Gewässer, denen unsre bewohnte Erdkruste ihre Form zu danken hat, nunmehr von der Vorsehung in diese Grenzen zurück gerufen, – alles dieses, sage ich, wirkt auf den gefühlvollen Menschen mit einer Macht, mit der sich nichts in der Natur vergleichen läßt, als etwa der Anblick des gestirnten Himmels in einer heitern Winternacht. Man muß kommen und sehen und hören.« Obwohl Cuxhaven an der Nordsee Lichtenberg geeignet scheint, es den Engländern nachzutun, zögert man dort so lange, bis die Konkurrenz an der Ostsee schneller ist. Seit 1793 trägt Heiligendamm den Titel »erstes deutsches Seebad«, weil ein fixer Arzt, Samuel Vogel, seinen Herzog, Friedrich Franz I. von Mecklenburg, vor allen anderen von der modernen Idee überzeugt. Dem ist zwar an der Gesundheit der Badegäste weniger gelegen als an deren Geldbeutel, aber am Ende kommen beide zu ihrem Recht, und wer nach Doberan an den Heiligen Damm reist, findet dort fortan sowohl das kräftigende Bad am Morgen als auch die Spielbank am Abend. Und Samuel Vogels 1817 formulierte Allgemeinen Baderegeln zum Gebrauche für Badelustige überhaupt und diejenigen insbesondere, welche sich des Seebades in Doberan bedienen, sind durchaus nicht gealtert. So lautet seine Regel Nummer 1: »Die beste Zeit zum kalten Bade ist des Vormittags in einer früheren oder späteren Stunde, wie sie dem Badegaste am angenehmsten und bequemsten ist, nüchtern oder nach einem leichten Frühstücke, und nach erfolgter natürlicher Leibesöffnung.« Es folgen Hinweise, man möge nicht überhitzt, schwindlig oder krank ins kalte Wasser steigen, sich nach dem Bade gehend oder reitend bewegen und es möglichst täglich wiederholen, bis schließlich die jahrhundertelange Annäherung des Menschen an den Überschwemmungsboden, das Niemandsland, das Grenzgebiet Strand in Regel Nummer 5 kulminiert: »Mit je mehr Frohsinn, Heiterkeit, Vertrauen und Hoffnung man sich dem Neptun in die Arme wirft, desto glücklicher geht, bey sonst gleichen Umständen, das Baden von Statten.« Mittlerweile haben sich übrigens auch die Franzosen ihres Zögerns und Zweifelns entledigt, die ersten stations balnéaires eröffnen an der normannischen Atlantikküste. Obwohl die Hafenstadt Dieppe für sich den Titel »erstes französisches Seebad« in Anspruch nimmt, sind es bald Trouville-sur-Mer und Deauville, die ihr den Rang ablaufen, weil dort die haute société der Hauptstadt »kleine Fluchten« in Form von luxuriösen Hotels mit eigenem Strandzugang erwarten.
Am Strand von Scheveningen wird heutzutage niemandem der Weg versperrt und selten dreht sich überhaupt einer nach dem andern um. Ein paar Surfer zerren neongrüne Bretter ins Meer. Ein mittelalter Mann massiert den Rücken seiner nackten Frau. Technobässe aus einer Boombox, die vier Jungs vor ihren nackten Füßen in den Sand gestellt haben, verfangen sich im Wind und kommen gegen das große Meerrauschen nicht an.
Mit den Niederländern als Vorhut und Nachzüglern zugleich wird also in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an den nordeuropäischen Küsten ein neues Kapitel aufgeschlagen, das Alain Corbin als die »Erfindung des Strandes« beschreibt. Denn mit Eröffnung der Seebäder ist der Strand nicht mehr nur das schmale sandige Grenzgebiet des Kontinents, sondern rückt mehr und mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit derer, die ihn bisher schlicht ignorierten und / oder denen die ungezähmte Natur an sich suspekt war. Denn ist nicht der Mensch vor allem deswegen die Krönung der Schöpfung, weil er sich über sie erhebt? Doch je mehr sich Stadt und Land(schaft) auseinanderentwickeln, desto mehr wird die Natur in all ihrer Vielfalt zur eigenen Sehnsuchtskategorie, und gerade am Meeresufer, so Alain Corbin, »angesichts der Leere des Ozeans und der Verfügbarkeit des Strandes, kann das moderne Subjekt sich selbst entdecken, seine eigenen Grenzen erfahren«. Wobei dieses Subjekt selbstredend das adlige und großbürgerliche meint, denn alle anderen sind leider zu beschäftigt, um sich selbst zu entdecken. Wer jedoch Zeit und Muße hat, kann nun am Strand in kindliches Verhalten zurückfallen, kann beim Muschelnsammeln und Sandburgenbauen eingeübte starre Etikette ablegen und ganz nebenbei sein Gefühlsspektrum ausloten. Mit fester Hand werden die Strände auf den Landkarten der Städter eingezeichnet und ihre Vorzüge notiert, die Weite, das Licht, die kühle Brise.
Illustriert werden diese Karten einmal mehr von zeitgenössischen Malern, deren Strandansichten nun, Ende des 19. Jahrhunderts, nicht mehr nur vom vermeintlichen Idyll des Fischhandels und der gefahrlosen Weite der See zeugen, sondern eben auch von jenem neuen Müßiggang am Meer. So reiten auf Ezeltje rijden langs het strand von Isaac Israëls drei kleine Mädchen auf Eseln über den Strand von Scheveningen, ihre hellen Kleidchen und roten Hütchen lassen darauf schließen, dass es höhere Töchter sind, die einen vergnüglichen Nachmittag verbringen. Auch auf den Bildern Max Liebermanns, der zwischen 1870 und 1910 fast jedes Jahr einige Sommermonate an der niederländischen Küste verbringt, spielen Kinder sorglos im flachen Wasser, gut gekleidete Männer reiten auf Pferden, zart gebaute Frauen flanieren in langen Kleidern über den Strand. Manchmal sind sie in das milde Licht eines heißen Sommertags gehüllt, manchmal türmen sich herbstliche Wolken über den Spaziergängern. Obwohl es einige Bilder von Liebermann aus Scheveningen gibt, war sein liebster Strand wohl der von Katwijk, gut zwanzig Kilometer nördlich. Wo sich im 17. Jahrhundert die Leute noch um einen angespülten Wal versammelten, findet sich zweihundert Jahre später eine kleine Künstlerkolonie zusammen, zu der neben Max Liebermann die Niederländer Bernard Blommers, Jan Toorop und einige Vertreter der Düsseldorfer Malerschule gehören.
Doch das im wahrsten Sinne des Wortes größte Strandgemälde aller Zeiten stammt von Hendrik Willem Mesdag. Vierzehn Meter hoch und hundertzwanzig Meter breit, kann man sich davon regelrecht umhüllen lassen, hat es doch die Form eines – im 19. Jahrhundert besonders populären – Panoramas. Zu finden ist es in der Den Haager Zeestraat. Einst Ausfallstraße zum Meer, liegt sie heute mitten in der Stadt, und eine schmale Holztreppe führt im Rondell des Panorama Mesdag hinauf auf die kleine Plattform, die einem Strandpavillon auf einer hohen Düne nachgebildet ist. Um den Pavillon herum ist echter Sand aufgeschüttet, Büschel unechten Sandhafers ragen heraus, hier und da liegt angespültes Strandgut herum, alte Kisten und Taue. Mit ein bisschen Fantasie und leicht zusammengekniffenen Augen bekommt man so tatsächlich das Gefühl, sich im Scheveningen des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu befinden. An einem sommerlichen Strand wartet ein Dutzend Fischerboote auf die Flut, im Wasser liegen immer noch und immer wieder boomschuiten, die Kavallerie ist zu einer Übung angerückt. Eine Fischersfrau schaut einer malenden Dame über die Schulter, die sich mit einem weißen Schirm vor der Sonne schützt und in der Hendrik Willem Mesdag seine Frau Sientje verewigt haben soll.
Als das Panorama am 1. August 1881 eröffnet wird, ist unter den Besuchern ein junger Mann, dessen Ruhm den von Mesdag und aller anderen Maler von Scheveningen eines Tages noch einmal überstrahlen wird: Vincent van Gogh. Der berichtet seinem Bruder Theo in einem Brief: »Dann habe ich mit ihm [Theóphile de Bock] zusammen das Panorama von Mesdag gesehen, ein Werk vor dem man allen Respekt haben muss. Ich dachte dabei an einen Satz, ich glaube von Bürger oder Thoré, über die Leçon d’anatomie von Rembrandt: Le seul défaut de ce tableau est de ne pas avoir de défaut.« Der einzige Fehler dieses Werkes ist, dass es keinen Fehler aufweist – ein Satz, der Vincent van Gogh möglicherweise Ansporn ist, denn nur ein Jahr später steht er selbst malend am Meer. Strand van Scheveningen bij kalm weer misst gerade 35,5 mal 49,5 Zentimeter und zeigt drei vertäute Boote, vor denen vier Menschen stehen, links zwei Frauen mit weißen Kopftüchern, rechts zwei Männer. Es ist Ebbe, die grau-gelben Farben des Strandes gehen in die Farben des Meeres über, die wiederum in die Farben des Himmels. 1882 ist Vincent van Gogh neunundzwanzig Jahre alt und wird noch acht Jahre leben, in denen all seine Meisterwerke entstehen. Gerade ist er wieder zu seinen Eltern nach Etten in Brabant gezogen, aber in Den Haag wohnt seine Cousine Ariëtte (Jet) Carbentus, deren Mann Anton Mauve ebenfalls Maler ist, van Gogh ermutigt und ihm Unterricht gibt. Am 19. August 1882 schreibt van Gogh an seinen Bruder, wie er Wind, Sturm und Regen beobachtet. Auch mit Worten kann der Mann, der als Maler alle Vorstellungen seiner Zeit sprengt, die aufgewühlte See präzise erfassen. »Es war doch so schön in Scheveningen dieser Tage. Das Meer war vor dem Sturm selbst noch imposanter als in dem Moment, als es tatsächlich stürmte. Während des Sturmes sah man die Wellen viel weniger und gab es weniger den Effekt von Furchen in einem gepflügten Feld. Die Wellen folgten einander so schnell, dass die eine die andere verdrängte und durch den Aufprall der Wassermassen eine Art flugsandiger Schaum entstand, der die ersten Meter des Meeres in eine Art Dunst hüllte. Aber ansonsten war es ein tobendes Stürmchen, um so tobender und, wenn man länger zusah, um so eindrucksvoller, weil es so wenig Lärm machte. Das Meer hatte die Farbe von schmutzigem Seifenwasser. Da war an der Stelle eine kleine Pinke, die letzte in einer Reihe, die einzige dunkle Gestalt.« Vincent van Gogh ist davon überzeugt, dass die Kunst, die Malerei, weit über das Gesagte hinausgeht. »Im Malen ist etwas Unendliches, ich kann es Ihnen nicht so gut erklären, aber gerade für den Ausdruck von Stimmungen ist es herrlich.«
Fast dreihundert Jahre liegen zwischen dem rasenden Segelwagen von Simon Stevin und diesen Zeilen von Vincent van Gogh. Ob die beiden Männer sich wohl etwas zu sagen hätten, würden sie einander in einem zeitlosen Raum begegnen? Könnten sie einander erklären, was sie sehen, was sie empfinden, am Strand von Scheveningen? Wo der Sturm, der die Segel von Simon Stevins futuristischem Wagen antreibt und Vincent van Gogh den Sand auf die Leinwand bläst, Anfang des 17. Jahrhunderts aus derselben Richtung weht wie Ende des 19. Jahrhunderts und auch der Blick zum Horizont der gleiche ist. Doch so sehr haben sich die Weltbilder in den drei Jahrhunderten verändert, haben die globalen Eroberungen, die Revolutionen und Kriege, die Erfindungen und Entdeckungen die Wahrnehmung der Menschen verschoben, dass Simon Stevin und Vincent van Gogh einander sehr fremd sein müssten, noch dazu wo der eine Wissenschaftler, der andere Künstler ist. Was gibt es hier zu fühlen, würde der eine vielleicht fragen. Was gibt es hier zu rasen, würde der andere sich vielleicht wundern, bevor sie wieder ihrer Wege gehen. Simon Stevin, in Gedanken schon beim nächsten Experiment, fährt zurück in die Stadt, wo sein Studierzimmer wartet. Vincent van Gogh, nach neuen Motiven Ausschau haltend, rückt seine Leinwand noch etwas näher ans Meer.
Im Scheveningen von heute ist es mittlerweile Abend geworden, die Dämmerung hat eingesetzt und hüllt die modernen Hochbauten links und rechts vom Kurhaus in gnädiges Licht. Von den religiösen Gefühlen, die das Meer und seine Ufer bei unseren Ahnen auslösten, zeugt nur mehr ein unscheinbares Büdchen auf der Strandpromenade. In mehreren Sprachen wirbt es für die Bibel und bietet allerlei erbauliche Heftchen an, für die sich kaum jemand interessiert. Der Gedanke, dass eine Sintflut nahen könnte, um uns für unsere Sünden zu strafen, scheint niemanden mehr recht zu beeindrucken. Meeresungeheuer landen frisch gegrillt und in mundgerechten Portionen auf dem Tisch, dazu ein kaltes Glas Weißwein und Elektrobeats. Der Strand hat sich geleert, auch der kleine Junge mit der blauen Badehose ist längst nicht mehr da. Trotzdem will es mir nicht aus dem Kopf gehen, wie er dort im Sand saß. Ich suche die Stelle, aber Wind und Wasser haben ihre Pflicht getan und den Strand ordentlich aufgeräumt. Erst viel später, ich bin nur noch in Gedanken am Strand von Scheveningen, fällt mir ein Gedicht von Ida Gerhardt in die Hände, der Grande Dame der niederländischen Dichtung. Een naam in schelpen (Ein Name in Muscheln) muss sie gerade für solch einen kleinen Jungen geschrieben haben, beginnt es doch in tiefer Achtung für ein Kind, das unverletzbar nach dem Meer verlangt, ohne es die anderen merken zu lassen.
Mijn diepste eerbied geldt een kind
dat onaanrandbaar naar de zee
verlangt, en het niet merken laat
aan anderen.
Der Tag vergeht, das Kind baut eine Sandburg. Erst als die Sonne fort und der Tag um ist, bricht es endlich auf, lässt seine Bastion zurück, auf die es mit Muscheln seinen Namen gelegt hat. Die Schaufel in der Hand, geht es schweren Schrittes hafenwärts.
En het vermant zich, en verlaat
zijn burcht aan zee, het bastion
waarop zijn naam in schelpen staat,
en dat – hij weet het – nog vannacht
als het tij opzet wordt geslecht.
Het neemt zijn schop op en het gaat
op stroeve voeten havenwaarts.
Ach Kind, denke ich, nimm es dir doch nicht zu sehr zu Herzen. Du kannst morgen wiederkommen, du kannst neue Sandburgen bauen. Und wenn du größer bist, fahren wir zusammen nach England hinüber.