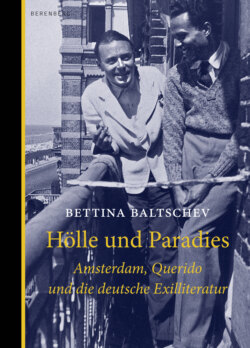Читать книгу Hölle und Paradies - Bettina Baltschev - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Keizersgracht 333:
Der Ermöglicher
ОглавлениеDas ehemalige Verlagshaus in der Keizersgracht 333
Im Vergleich mit anderen Grachtenhäusern in Amsterdam ist dieses hier ein eher unscheinbarer Bau, vier Etagen graubrauner Backstein, kein verspielter Giebel, kein Hinweis auf die Erbauer in Form eines Schiffs, eines Fischs oder eines Ährenkranzes über dem Eingang. Die mannshohen Fenster im Hochparterre geben den Blick frei auf einen tiefen Raum, in dessen Mitte ein großer Esstisch steht, darauf ein paar Zeitschriften, eine Sonnenbrille, ein Kaffeebecher, ein Strauß langstieliger weißer Rosen im Endstadium. Es ist ein privates Stillleben, und obwohl kein Mensch zu sehen ist, fühle ich mich ertappt und flüchte die Treppenstufen zurück auf die Straße. Denn eigentlich wollte ich nur bestätigt finden, was ich längst schon wusste: Bücher werden hier nicht mehr gemacht. Doch die Adresse ist so legendär, dass Fritz Landshoff sogar seine Memoiren nach ihr benennt: Amsterdam, Keizersgracht 333.
Im April 1933 wird der junge Verleger aus Berlin hier von dem Menschen erwartet, in dessen Auftrag Nico Rost ihn am Vortag aufgesucht hatte, von Emanuel Querido. Doch Querido empfängt ihn nicht allein, neben ihm steht Alice van Nahuys, seine engste Mitarbeiterin. Deren Kompetenzen gehen weit über die einer persönlichen Assistentin, Sekretärin oder Lektorin hinaus, weshalb ihr offizieller Titel auch directrice lautet, Direktorin. Überhaupt ist sie eine eindrucksvolle Erscheinung, wie Fritz Landshoff sich erinnert: »Sie war groß, elegant, gutaussehend, energisch, sehr belesen und beherrschte vier Sprachen fließend (Holländisch, Französisch, Englisch und Deutsch). Da Querido kaum fremde Sprachen verstand und sie gar nicht sprach, war seine ungefähr dreißig Jahre jüngere Mitarbeiterin unser Dolmetscher. Sie war unserer geplanten Verlagsgründung offenbar sehr geneigt.« Kein Wunder, schließlich verspricht ein neuer Verlag auch ihr neue Möglichkeiten, neue Begegnungen und frischen Wind in der täglichen Arbeit. Ganz so jung, wie Landshoff sie einschätzt, ist sie allerdings doch nicht mehr. Mit 39 Jahren ist sie sieben Jahre älter als Fritz Landshoff und 23 Jahre jünger als Emanuel Querido, der ihr seit der Gründung des niederländischen Verlages 1915 über die Jahre immer mehr Verantwortung übertragen hat.
Dennoch darf man sich nicht täuschen lassen, wenn Querido neben seiner directrice fast ein wenig unscheinbar wirkt. Am Ende wird er das letzte Wort behalten. Bis dahin überlässt er ihr jedoch gern die Konversation, denn, wie gesagt, Fremdsprachen sind seine Sache nicht. Auch »groß, elegant und gutaussehend« sind übrigens keine Attribute, die auf ihn zutreffen. Arie, Emanuel Queridos einziger Sohn, beschrieb das Äußere seines Vaters einmal so: »Sein Haar war dunkelblond, seine Augen hellblau und von einer außergewöhnlichen Klarheit; sein Gesicht war rund und hatte etwas Sanftes, beinahe Weibliches an sich, das durch sein weiches Haar noch unterstrichen wurde und dem auch sein kurzer Schnurrbart nur wenig Männliches hinzufügen konnte. Seine Erscheinung war stets sehr akkurat; er machte immer einen ›sauberen‹ Eindruck, stolz war er vor allem auf seine Hände, die sehr klein, aber muskulös waren, breit und kräftig, und die er immer sorgfältig pflegte. In seiner Kleidung kam die merkwürdige wankelmütige – oder ambivalente – Haltung zum Ausdruck, die er damals – und eigentlich sein ganzes Leben – einnahm.«
Wankelmütig, ambivalent? Emanuel Querido ist einer der erfolgreichsten Verleger der Niederlande und wird zum Ermöglicher eines bedeutenden deutschen Exilverlages – welchen Grund sollte dieser Mann haben, nicht stabil und selbstbewusst durchs Leben zu gehen? Queridos Biograf Willem van Toorn glaubt, dass sich die Unsicherheit des Verlegers aus seiner Herkunft erklärt. Querido habe immer mit der begrenzten kleinbürgerlichen Welt der sephardischen Einwanderer gehadert, die in Amsterdam vor allem in Diamantschleifereien und anderen kleinen Handwerksbetrieben beschäftigt sind, so wie Emanuels Vater. Dabei schafft der es immerhin, mit der Familie aus der Jodenbuurt in ein weniger enges Quartier am Stadtrand zu ziehen – im Judenviertel zwischen Kloveniersburgwal und Prins Hendrikkade drängen sich sieben Mal mehr Menschen als anderswo in der Stadt. Seine drei Söhne David, Emanuel und Israël schickt Aron Querido auf eine Privatschule, zum Musikunterricht, zu Theater- und Zirkusvorstellungen, und die ganze Familie profitiert vom Modernisierungsschub, der das westliche Europa zur Jahrhundertwende erfasst und der sich in Amsterdam unter anderem in markanten städtebaulichen Veränderungen niederschlägt.
Das Antlitz von Amsterdam, wie wir es heute kennen, bekommt Ende des 19. Jahrhunderts die entscheidenden Konturen. 1889 etwa wird der Hauptbahnhof eröffnet, Amsterdam Centraal Station. Mit seinen roten Backsteinen, den beiden Türmen und farbigen Verzierungen erinnert er eher an ein Schloss als an einen Bahnhof. Die Pracht soll wahrscheinlich jene Gemüter beschwichtigen, die seinen Standort bereits vor dem Richtfest für komplett ungeeignet halten. Denn es ist schon wahr, kommt man vom Stadtzentrum und will zum Hafen oder umgekehrt, dann steht die Centraal Station wie ein großer roter Riegel im Weg, alle Fußgänger, Rad- und Autofahrer landen in einer Sackgasse und müssen auf Schleichwegen um den Bahnhof herum kurven. Erst seit einigen Jahren wird durch umfängliche Baumaßnahmen versucht, die Logistik zu verbessern. Das ist vor allem nötig, seit die westlichen und östlichen Hafengebiete als Wohnquartiere erschlossen werden und auch Amsterdam-Noord, ein lange vernachlässigtes Viertel hinter dem Hafen, immer beliebter wird.
Dass die Centraal Station unübersehbar dem vier Jahre zuvor eröffneten Rijksmuseum ähnelt, ist übrigens kein Zufall, sind doch beide Gebäude nach Entwürfen des Architekten Pierre Cuypers erbaut, roter Backstein, weit sichtbare Türme, viele dekorative Elemente. 1902 folgt, nicht weniger prächtig, aber ganz im Jugendstil, der Bau des American Hotels am Leidseplein, geplant von einem Neffen Pierre Cuypers’. 1903 schließlich wird die Beurs van Berlage vollendet, die markante Börse am Damrak, benannt nach ihrem Erbauer Hendrik Petrus Berlage. Anders als Pierre Cuypers mit seinen verspielten Giebeln, Nischen und Rundbögen setzt Berlage auf schlichte Flächen und Zweckmäßigkeit, wofür er 2016 in einer Ausstellung als Godfather of Dutch Design gefeiert wird.
Man muss sich Amsterdam in den Jahren zwischen 1880 und 1900 also als eine große Baustelle vorstellen, eine Stadt im Aufbruch, die den internationalen Vergleich nicht scheut. Vielleicht war Emanuel Querido, geboren 1871, ja bei einer der feierlichen Eröffnungen dabei, am Bahnhof, am Museum oder am Hotel, hat aus der Ferne zugeschaut, wie sich die Bauherren in Frack und Zylinder gegenseitig zuprosten, die dazugehörigen Damen ihre neuesten Kleider vorführen und eine Kapelle das passende Ständchen spielt. Aber vielleicht ist er auch viel zu beschäftigt, sein eigenes Leben wieder und wieder umzubauen. Denn so verheißungsvoll die Zukunft für andere auch scheinen mag, Emanuel Querido braucht fast drei Jahrzehnte, bis er für sich den richtigen Platz findet und zu dem erfolgreichen Verleger wird, der auch noch Kapazitäten für einen deutschen Exilverlag hat.
Knapp ein halbes Jahrhundert bevor Emanuel Querido und Alice van Nahuys Fritz Landshoff in der Keizersgracht 333 willkommen heißen, soll Querido zunächst dem Vater in dessen Fach folgen und ebenfalls Diamantschleifer werden. Doch der Ehrgeiz des Sohnes reicht nicht aus, dem elterlichen Wunsch zu entsprechen. Ein vorgeschobenes Augenleiden erlöst ihn wie auch seinen ein Jahr jüngeren Bruder Israël vom Los des Handwerkerdaseins. Beide treten in die sozialdemokratische Partei ein, ziehen durch die Cafés der Stadt und schließen Freundschaft mit Dichtern, Gewerkschaftern und der städtischen Bohème, deren Protagonisten den Geruch der großen Welt von ihren Ausflügen nach Paris mitbringen. Die Querido-Brüder haben literarische Ambitionen, von denen sie allerdings zunächst nicht leben können, weshalb Israël sich als Literaturkritiker versucht und bei Emanuel kurzzeitig der absonderliche Plan aufkommt, Turnlehrer zu werden. Der Plan scheitert jedoch schon an der Eignungsprüfung, und Emanuel muss sich von seinen Eltern, bei denen er noch wohnt, immer wieder fragen lassen, was denn nun aus ihm werden soll. Ein zweites schwarzes Schaf in der Familie können sie nicht gebrauchen, diese Rolle hat nämlich schon Emanuels älterer Bruder David übernommen, der durch die Casinos der Stadt zieht und von weiß Gott welchen Einkünften lebt. Und der jüngere Bruder, dem Emanuel besonders nahesteht, feiert schon bald mit naturalistischen Romanen über das Leben der »einfachen Leute« literarische Erfolge, die ihn zeitweise zu einem der bekanntesten Schriftsteller der Niederlande werden lassen. Dabei müsste Israël nicht einmal von seinen Buchverkäufen leben, hat er doch eine Frau aus wohlhabenden Kreisen geheiratet, die ihn großzügig aushält und auch seine vielen Freunde beköstigt, die im Haus am Rembrandtplein ein und aus gehen. Man braucht nur wenig Phantasie, um sich auszumalen, wie die Brüder sich mehr und mehr von einander entfremden, wie die Arroganz des einen und der Neid des anderen unüberwindbare Gräben entstehen lassen. Denn auch Emanuel Querido hat sich bereits so ausführlich an einem Roman versucht, dass im Laufe von über zwanzig Jahren ein ganzer Zyklus daraus geworden ist. Zehn Bände umfasst Het geslacht der Santeljano’s (Das Geschlecht der Santeljanos) über eine Einwandererfamilie aus Portugal. Aber auch wenn der Umfang eindrucksvoll ist, Leser findet dieses Opus magnum, das Querido unter dem Pseudonym Joost Mendes verfasst, kaum.
Und so führt Emanuel Querido lange Zeit ein Leben, das man heutzutage wohl prekär nennen würde. Es ist ein Suchen nach dem richtigen Ort, der richtigen Aufgabe, ein ständiges Infragestellen der eigenen Person und Position. Nur, was Anfang des 21. Jahrhunderts als Selbstfindung durchgeht, gilt zu Beginn des 20. Jahrhunderts als unstet, als wankelmütig und ambivalent, und wahrscheinlich fühlt sich auch Querido selbst nicht wohl damit. Er weiß, dass er Talent hat, nur eben noch nicht recht wofür. Sicher ist bloß, dass seine Bestimmung »irgendetwas mit Büchern« zu tun haben sollte. Zunächst arbeitet er in einer Buchhandlung mit. Später eröffnet er seine eigene. Die liegt an der Amstel, unweit der Universität, und wird bald Treffpunkt von Studenten und Gelehrten, die ihre freien Stunden plaudernd und diskutierend bei den Queridos verbringen, denn mittlerweile ist auch Emanuel verheiratet und wohnt mit seiner Frau Jane über dem Geschäft. 1901 wird Arie geboren. Ein Jahr später reicht es Emanuel Querido nicht mehr, Bücher nur zu verkaufen. Er beginnt, auch welche zu verlegen. Vor allem sozialistische und »fortschrittliche« Literatur liegt ihm am Herzen, aber so richtig gut laufen die Geschäfte nicht, von einer Schopenhauer-Gesamtausgabe erscheint lediglich der erste Band.
Um finanziell nicht völlig einzubrechen, lässt sich Emanuel Querido schließlich als Bürokraft in einem Theater anstellen. Wie deprimierend das sein muss für einen Mann Ende dreißig und mit »Hang zum Höheren«, man kann es sich lebhaft vorstellen. Dann schon lieber Einkäufer in der Buchhandlung des gerade eröffneten Warenhauses Bijenkorf am Dam. Der Name legt bereits nahe, wie es hier zugeht, summend und geschäftig wie in einem Bienenkorb. Während 1914 im Rest von Europa der Erste Weltkrieg losbricht, geht das Leben in den Niederlanden gezellig weiter. Emanuel Querido steht in Amsterdam »zwischen Bonbons und Lingerie«, blickt auf das täglich anschwellende Gewimmel und langweilt sich maßlos. Die Damen und Herren der besseren Amsterdamer Gesellschaft ziehen an ihm vorbei und sind auf der Suche nach dem neuesten Duft und dem letzten Modeschrei. Sie können es sich leisten, Holland hält sich neutral aus den Kriegshandlungen heraus und wird, anders als das eigentlich ebenfalls neutrale Belgien, auch nicht vom deutschen Militär überrollt. Aber erst wenn das Bedürfnis nach Schönheit gestillt ist und sich in der Tasche noch eine Lücke findet, darf es für die Herrschaften im Bijenkorf vielleicht auch noch ein Buch sein. Keine allzu schwere Lektüre bitte, etwas Unterhaltsames gern, etwas Schöngeistiges für abends am Kamin oder sonntags am Strand. Wenn die Damen und Herren nur wüssten, was in dem Mann an der Kasse vorgeht, der sie höflich, aber distanziert bedient, der hier nur steht, weil er Geld braucht. Nicht einmal ein Jahr hält Emanuel Querido es im Bijenkorf aus, dann geht er einfach nicht mehr hin, die Kündigung folgt auf dem Fuße. Querido ist 44 Jahre alt und wahrscheinlich denkt er sich, jetzt oder nie. Viel zu verlieren hat er nicht, in den Krieg ziehen muss er auch nicht, also gründet er 1915 eine Verlagsgesellschaft, Em. Querido’s Uitgevers-Maatschappij. Um die Kosten zu minimieren, bittet er beim renommierten Verlag Holkema & Warendorf um Unterschlupf und kann so auf dessen klingende Adresse zurückgreifen: Keizersgracht 333. Bald darauf lässt sich Querido von dem berühmten Architekten Hendrik Petrus Berlage ein dynamisch geschwungenes Signet aus den Lettern E und Q entwerfen, das von nun an alle sorgsam aufgemachten Bücher aus seinem Hause ziert. Wer ein Buch von Querido kauft, soll nicht nur ein gutes, sondern auch ein schönes Buch in der Hand halten.
Seine directrice Alice van Nahuys hatte Emanuel Querido übrigens im Warenhaus kennengelernt und abgeworben, ihr Talent fürs Geschäftliche, für Fremdsprachen und ihren jugendlichen Geist kann er gut gebrauchen. Schon das erste Programm der beiden besteht aus acht Büchern, darunter die Biografie von Jean Jaurès, jenem französischen Sozialisten, der 1914 in einem Pariser Café von einem Nationalisten ermordet worden war. Der verlegerische Durchbruch folgt jedoch erst 1918 mit Het vuur (Das Feuer), dem Kriegstagebuch des französischen Schriftstellers Henri Barbusse. Dass das Buch von der Justiz als pornografisch eingestuft wird, belebt die Nachfrage enorm.
Der Plan geht auf. Schon nach wenigen Jahren gehört Em. Querido’s Uitgevers-Maatschappij zu den erfolgreichsten Verlagen der Niederlande. Der Literaturwissenschaftler August Lammert Sötemann, der die Verlagsgeschichte von 1915 bis 1990 notiert hat, bringt es mit einem schlichten Satz auf den Punkt: »De uitgeverij was een goudmijn« – der Verlag war eine Goldmine. Eine Mine, in der Querido unermüdlich arbeitet und seine wertvollen Stücke persönlich in den Buchläden abliefert, wie sein Sohn Arie hinzufügt: »Mit der schweren und immer wieder herzlich verfluchten Tasche – ›dem Murmeltier‹ – zog er durch das ganze Land, überfiel die Buchhändler und quasselte ihnen den Laden voll.«
Und endlich, 1930, wagt sich Emanuel Querido daran, sein eigenes Werk noch einmal anzubieten. Ein Rotterdamer Verlag hatte die zehn Bände von Het geslacht der Santeljano’s bereits verlegt, nun also soll die ausufernde – und durchaus autobiografische – Familiengeschichte um die Brüder Ko und Daan eine Chance im eigenen Verlag bekommen. Doch Queridos blumige Sprache verlangt dem Leser einen langen Atem und Abstraktionsvermögen ab, um hinter der romantischen Zeichnung einer Familienchronik den Zeitgeist der Jahrhundertwende zu erkennen. Die Nachfrage nach dem Epos ist deshalb auch im zweiten Anlauf mäßig. Nur Israël Querido liest das Werk seines Bruders aufmerksam, fühlt sich von der vermeintlich realistischen Darstellung der eigenen Person diffamiert und wettert öffentlich über Emanuel. Ein Akt, der die Männer, die längst auf sehr unterschiedlichen Umlaufbahnen unterwegs sind, noch weiter auseinandertreibt. Möglicherweise hätten sie sich ja zusammengerauft, wäre ihnen klar gewesen, wie wenig Zeit ihnen bleiben sollte. Israël, der sich dem Prinzip live fast, die young verschrieben hat, stirbt im August 1932 mit 59 Jahren – zuckerkrank, herzkrank, eine nervenkranke Frau und einen geistig behinderten Sohn hinterlassend. Auch historisch betrachtet überlebt Emanuel seinen Bruder, denn während sein Name mit dem Verlagshaus überdauert, werden die Bücher von Israël heute so gut wie nicht mehr gelesen.
Dennoch, mit Emanuel, dem erfolgreichen Verleger, und Israël, dem zu Lebzeiten berühmten Schriftsteller, ist das Geschlecht der Queridos, seit Anfang des 17. Jahrhunderts in der Stadt, endgültig in den bürgerlichen Sphären von Amsterdam angekommen. Religion spielt in ihrem Leben nur noch am Rande eine Rolle, genauso wie die Herkunft ihrer Vorfahren von der iberischen Halbinsel. Sie betrachten sich als Amsterdamer und werden als solche auch akzeptiert, ein bisschen dickköpfig und vorlaut, aber mit großem Herzen, hilfsbereit und zupackend, wenn Not am Mann ist, dabei den eigenen Vorteil nie ganz aus dem Auge lassend. Nur der portugiesische Name ist ihren Landsleuten zu kompliziert, weshalb sie sich die Aussprache kurzerhand mundgerecht zurechtbiegen. Aus Emanuel wird »Maan« und aus »Kerído«, dem portugiesischen Wort für »Liebling«, wird »Kwérido«. Unter den deutschen Exilschriftstellern kursiert schließlich der Kosename »Queri«.
Der junge Verleger Fritz Landshoff kennt all diese Geschichten noch nicht, als er im April 1933 Emanuel Querido und Alice van Nahuys in die Verlagsräume in der Keizersgracht 333 folgt. Wie diese Räume aussehen, lässt sich in Bruno Franks Roman Die Tochter nachlesen, der 1943 in Mexiko erscheint. Durch eine Erbschaft zu Vermögen gekommen, eröffnet seine Protagonistin Elisabeth im galizischen Städtchen Dnestr eine Buchhandlung, wo sie auch deutsche Exilliteratur verkauft. »Aus Amsterdam gelangte die gehetzte Literatur auf Elisabeths Regale am Ringplatz. Sie setzte ihren Ehrgeiz darein, daß nichts davon fehlte.« Weil jedoch der Versand der Bücher von Holland nach Galizien umständlich ist und viel Korrespondenz erfordert, beschließt Elisabeth eines Tages, nach Amsterdam zu reisen, um den Verlag und die Verleger kennenzulernen, den Deutschen Herrn Auerbach und den Holländer van Lennep. Hier setzt die Beschreibung der Keizersgracht 333 ein: »Das Haus, ein hundertjähriger feiner Ziegelbau, blickte mit seiner hohen und schmalen Front nach der Gracht. Ulmen spiegelten ihr gezahntes Blattwerk im lautlosen Wasser. Droben das Zimmer im dritten Stock, zu dem man Elisabeth wies, schallte vor Tätigkeit. Die Arbeitenden waren beengt von Bücherstapeln und versandbereiten Paketen. Jemand diktierte. Zwei Schreibmaschinen klapperten durch die offenen Fenster in die Stille hinaus. Herr Auerbach kam aus seinem Privatkontor und streckte ihr die Hände entgegen. Dieses Kontor war ein Kämmerchen; ein Schreibtisch hätte nicht Platz gefunden. Statt dessen sah man neben dem Fenster ein altmodisches Stehpult, wirr mit Papieren bedeckt. Zwischen den Regalen und Büchertürmen blieb gerade Raum für zwei Stühle.«
Doch bevor Herr Auerbach alias Fritz Landshoff von diesem Kämmerchen aus Bücher zu verlegen beginnt, nimmt er erst einmal im weit geräumigeren Büro von Emanuel Querido Platz. Alice van Nahuys setzt sich mit Papier und Bleistift dazu, springt zwischen dem Niederländischen und Deutschen hin und her, vermittelt hier, erklärt dort und erweist sich schon beim ersten Gespräch als unersetzlich. Nach nur zwei Stunden herrscht Einigkeit, ein kurzes Schreiben wird aufgesetzt und dann ist er tatsächlich in der Welt, der Querido Verlag. Emanuel Querido reicht Fritz Landshoff zum Zeichen des Einverständnisses die Hand. Dann lädt er ihn und seine directrice zum Essen ein.