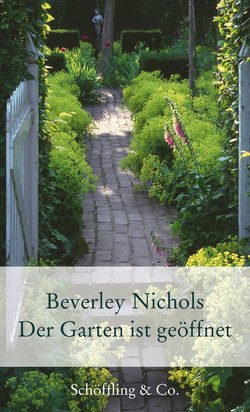Читать книгу Der Garten ist geöffnet - Beverley Nichols - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI Das Wüten des Winters
»Das Wetter in England« – schrieben meine Freunde den ganzen bitterkalten Winter über mit ermüdender Eintönigkeit – »ist absolut unbeschreiblich.« Und fuhren damit fort, es in aller Ausführlichkeit zu beschreiben.
Ich selbst konnte dabei nicht mitreden, da ich mich auf einer Vortragsreise durch Amerika befand, wo das Wetter, wie alle annahmen, nicht »unbeschreiblich« war. In gewisser Weise hatten sie recht. Nichts wäre mir leichter gefallen, als den Tornado zu beschreiben, der genau im Augenblick meiner Ankunft mit minus 25 Grad Celsius über Detroit herfiel, mich im wahrsten Sinn des Wortes packte und in einen mit Schneematsch gefüllten Rinnstein katapultierte, wo ich von einer Ambulanz aufgelesen und ins Krankenhaus abtransportiert wurde, damit man mich röntgen und bandagieren und mir eine Spritze gegen Kiefersperre verpassen konnte, eine Vorsichtsmaßnahme, die wohl verhindern sollte, dass meine Zähne auf dem Podium, auf dem ich eine Stunde später erwartet wurde, urplötzlich anfingen zu klappern, um sich dann unlösbar ineinander zu verbeißen.
Ähnlich leicht wäre es mir gefallen, die Eiseskälte zu beschreiben, die den ganzen mittleren Westen erfasst hatte. »Wie tief ist der Boden gefroren?«, fragte ich nach einem meiner Vorträge eine Dame aus Cleveland. Sie hatte ganz in Schwarz gekleidet in der ersten Reihe gesessen und mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil sie aussah, als habe sie etwas verloren. Ihre Antwort verriet mir, dass das tatsächlich der Fall war. »Mindestens einen Meter zwanzig tief, wie ich zufällig weiß«, antwortete sie. »Ich habe nämlich gerade meine Köchin beerdigt.« Die Stars der amerikanischen Bühne, Alfred Lunt und Lynn Fontane, konnten diese Aussage sogar noch überbieten. In ihrem Garten, versicherten mir die beiden, war der Boden viel tiefer gefroren, und sie mussten nicht auf so extreme Maßnahmen wie das Beerdigen einer Köchin zurückgreifen, um das in Erfahrung zu bringen.
Doch derartige Details behielt ich in meinen Briefen nach Hause für mich, denn im Lauf der Wochen zeigte sich, dass es dort tatsächlich ziemlich schlimm aussah. In abgelegenen Gegenden mussten Soldaten eingesetzt werden, im Dartmoor fielen die sonst so robusten Ponys einfach tot um, und in Richmond, nur ein paar Meilen von meinem Cottage entfernt, fror die Themse zum ersten Mal seit Menschengedenken komplett zu. Zufälligerweise war auch der Mississippi zugefroren, aber in Amerika rechnet man mit diesen Dingen, in England nicht. In England ist das Wetter oft trübselig und immer unvorhersehbar, aber selten melodramatisch. Ein Beispiel, das mir die missliche Lage meiner Freunde zu Hause am deutlichsten vor Augen führte, erreichte mich mit dem Brief einer befreundeten alten Dame, die in einem einsamen Cottage in den Downs von Sussex lebte. Sie machte sich schreckliche Sorgen um die armen Vögel, schrieb sie, und hatte sie so gut es ging gefüttert, obwohl das nicht immer leicht war, weil die Straßen auf dem Land manchmal tagelang unpassierbar waren. Trotzdem waren die Vögel immer schwächer geworden und hatten teils kaum noch die Kraft wegzufliegen, nachdem sie an den Brotrinden und Speckschwarten herumgepickt hatten.
»Inzwischen jedoch«, schrieb sie, »ist mir klar geworden, wie dumm ich war. Sie brauchten nämlich nicht nur Futter, sondern auch Wasser. Also habe ich Schüsseln aufgestellt und Teelichter darüber gehängt, die gerade so viel Wärme abgeben, dass das Wasser nicht friert. Die Konstruktion ist ein durchschlagender Erfolg, und ich kann nur hoffen, dass mein Vorrat an Teelichtern noch eine Weile reicht.« Es war der letzte Brief, den ich je von ihr erhielt. Ein paar Tage später fand man sie vor der Tür ihres Cottage, wo sie ausgerutscht und hingefallen war. Neben ihr lag eine dick vereiste Packung Teelichter. So lange es im guten alten England noch solche Charaktere gibt, kann es trotz des Wetters kein so furchtbar schlechter Ort zum Leben sein.
Aber was war mit dem Garten?
Das war die Frage, die ich mir zunehmend beunruhigt stellte, als immer mehr Briefe eintrudelten, die von tragischen, komischen oder kaum glaubhaften Ereignissen berichteten. Als Gärtner hatte ich einen sehr persönlichen Grund für diese Frage, denn seit ich das erste Mal einen Garten betrat, war ich von den Winterblühern geradezu besessen. Stolz hatte ich immer geprahlt, in jedem Garten, den ich je angelegt hatte, sei ich an jedem einzelnen Tag des Jahres in der Lage gewesen, ein Sträußchen für meinen Schreibtisch zu pflücken, und seien es nur ein paar kretische Schwertlilien, Iris unguicularis (syn. I. stylosa), deren noch geschlossene Knospen ich aus Schneewehen ausbuddelte. (Trotz jahrelanger Propaganda meinerseits gibt es immer noch viel zu viele Gärtner, die diese Blumen nicht in ihrem Garten haben, obwohl man sie tatsächlich aus halbmeterhohen Schneewehen retten und ins Haus holen kann, wo sie ihre orchideenartigen Blüten binnen einer Stunde öffnen.) Aber was, wenn der Schnee anderthalb Meter hoch lag, was anscheinend mancherorts der Fall war, und was, wenn sich der Frost bis unter die Wurzeln vorgekrallt hätte? Mein Freund und langjähriges Faktotum, Mr Gaskin, hatte geschrieben, er hätte sich über den Rasen zum Gewächshaus vorgraben müssen wie zu einer belagerten Festung. Als einen Punkt von noch größerer Wichtigkeit hatte er hinzugefügt, was er im Hinblick auf die sanitären Bedürfnisse von Four und Five tun solle, sei ihm ein absolutes Rätsel.
Four und Five sind meine kätzischen Gefährten, sechzehn und achtzehn Jahre alt.1 Normalerweise benutzen sie bei einem Kälteeinbruch, wenn der Boden gefroren ist, die aufgeschütteten Kohlen im Geräteschuppen, aus dem sie mit geschwärzten Pfoten und leicht hochnäsigen Gesichtern wieder zum Vorschein kommen, wie Damen in einem Restaurant, dessen Toiletten nicht allerhöchsten Ansprüchen genügen. Nun jedoch waren auch die Kohlenberge zu einer stahlharten, eisigen Masse erstarrt, und sie waren gezwungen gewesen, die Sandkiste zu benutzen, die sie unter normalen Umständen verschmähten. Doch selbst die war gefroren, mit dem Ergebnis, dass Four in die Badewanne »gemacht« hatte. Das war nun wirklich eine Schlagzeile wert, die durch die Tatsache, dass ein dreißig Zentimeter langer Eiszapfen den Warmwasserhahn der Wanne zierte, in die Four »gemacht« hatte, noch mehr Dramatik gewann.
Konnte nach all diesen Extremen überhaupt noch etwas vom Garten übrig sein, auch wenn es endlich angefangen hatte zu tauen? Nun … bald würde ich es wissen.
Der Rückflug nach England verlief ereignislos. Zumindest kam es mir dank der besänftigenden Eigenschaften eines Zaubertrunks, den mir mein New Yorker Freund Dr. Morgenbesser verordnet hatte, so vor. Dieses erstaunliche Elixir sieht aus wie Crème de Menthe und schmeckt auch so, hat aber eine bedeutend wohltuendere Wirkung: Obwohl das Flugzeug jeden Augenblick zu explodieren droht, sinkt man nach einem einzigen Schlückchen entspannt in seinen Sitz, auf dem Gesicht ein Lächeln, das dem nicht unter Drogen stehenden Beobachter leicht dümmlich vorkommen muss. »Es besteht kein Grund zur Beunruhigung«, krächzt die Stimme des Piloten über den Lautsprecher – eine Bemerkung, die normalerweise selbst das wackerste Herz mit Angst und Schrecken erfüllt. Man selbst jedoch nickt in einem Nebel wohlwollender Zustimmung vor sich hin. Was bitte sollte Grund zur Beunruhigung sein? Sicher, eins der Triebwerke ist ausgefallen, Blitze umzucken den Rumpf, es riecht durchdringend nach Kerosin und von hinten sind ein paar sehr eigenartige Geräusche zu vernehmen, die sich nicht ausschließlich auf die Gruppe betrunkener Russen zurückführen lassen, die, wahrscheinlich mit irgendwelchen infernalischen Apparaturen ausgerüstet, in letzter Minute an Bord kamen. Aber Beunruhigung? Was für ein absurder Gedanke! Nichts ist beunruhigend. Alles ist gut in der besten aller Welten, und Tod, wo ist dein Stachel? Das Kinn sackt nach unten, und kurz bevor man wegdämmert fragt man sich, wieso man drei Sicherheitsgurte umhat, die allesamt ein wenig verschwommen aussehen.
Aber eigentlich hatte ich vor, ein Gartenbuch zu schreiben. Also wollen wir kurz vor Mitternacht in London landen, wo der Mond hell am Himmel steht. Wir wollen über schmale, gewundene Straßen heimwärts fahren und alle Empfindungen durchleben, die jedem rückkehrenden Reisenden vertraut sind. Wir wollen in die baumgesäumte Straße einbiegen, die am menschenleeren Common von Ham vorbeiführt, und das Gattertürchen zum winzigen Vorplatz vor der Haustür öffnen. Und dann, bevor wir unseren Hausschlüssel zücken oder das Licht einschalten, wollen wir uns bücken, mit kalten Fingern auf der nassen Erde herumtasten, den Strunk einer geliebten Pflanze packen und kräftig daran ziehen.
Erleichtert seufzen wir auf. Denn beim Ziehen leistete der Strunk erbitterten Widerstand und rührte sich keinen Millimeter. Vielleicht, vielleicht war es um die Dinge ja doch nicht ganz so schlecht bestellt, wie wir befürchtet hatten.
Dieses eigenartige Verhalten ist vermutlich typisch für den rückkehrenden Reisenden, wenn dieser gleichzeitig auch Gärtner ist. Das Bedürfnis, sich zu vergewissern, was mit den Blumenbeeten los ist, lässt alle anderen Belange in den Hintergrund treten. Ich kannte einmal einen Mann, dessen Frau ihm genau deswegen mit Scheidung drohte. Er war drei Monate weg gewesen, und sie hatte ihm während seiner Abwesenheit ein Baby geschenkt. Merkwürdigerweise nahm sie an, dass er nach seiner Rückkehr als Allererstes zu ihr und dem Baby kommen und ihnen seine Aufwartung machen würde. Weit gefehlt. Sein dringendstes Anliegen war, über den Rasen zu laufen und einen kürzlich gepflanzten chilenischen Feuerbusch, Embothrium coccineum, in Augenschein zu nehmen. Sie fand dieses Verhalten unnormal. Manche Frauen haben eben einfach keinen Sinn für Prioritäten.
Zurück zu unserem Strunk, der sich nicht rühren wollte. Das war so wichtig, weil es sich um eine Zitronenverbene, Lippia citriodora, handelte, die in dem Ruf steht, nur in den geschütztesten Regionen unserer Insel winterhart zu sein. Hätte sie nach all den Monaten arktischer Temperaturen den Geist aufgegeben, wären auch die Wurzeln hinüber gewesen, und sie hätte sich wie ein verfaulter Zahn aus dem Boden rupfen lassen, da es, wie bereits gesagt, angefangen hatte zu tauen. Die Tatsache, dass die Zitronenverbene fest im Boden verankert blieb, empfand ich als glückliches Omen für eine ganze Reihe anderer Pflanzen, deren mögliches Dahinscheiden mir Sorgen bereitete.
Und während wir immer noch auf der Türschwelle stehen, wollen wir kurz innehalten, um unsere gärtnernden Mitmenschen an eine Lektion zu erinnern, die sie oftmals vergessen:
PRAKTISCHER HINWEIS
Jedes Jahr werden in Tausenden von Gärten landauf, landab wertvolle Pflanzen umgehackt und ausgegraben und auf den Abfall geworfen, weil ihre Besitzer irrigerweise annehmen, sie seien tot, während noch massenhaft Leben in ihnen steckt. Diese Tragödie könnte verhindert werden, würden sich die Gärtner, statt die übliche Technik anzuwenden, ein Stück Rinde abzuschaben, um zu sehen, ob der Zweig darunter noch grün ist, einfach bücken und an der Pflanze ziehen und das auch weiterhin tun. Denken Sie an die Zitronenverbene. Das ganze Frühjahr und den größten Teil des Sommers über sah sie mausetot aus; der kahle Strunk über der Erde zeigte nicht das geringste Lebenszeichen, und die meisten Leute hätten das Ding ausgegraben und weggeworfen. Aber wir zupften immer weiter, und jedes Zupfen versicherte uns, dass irgendwo unter der Erde noch Leben herrschte und die Pflanze ums Überleben kämpfte. Und dann wurden wir gegen Ende Juli von einem kleinen grünen Blatt belohnt, das einen noch süßeren Duft zu verströmen schien als üblich, als wolle es sich für unsere Geduld bedanken.
Diese Erfahrung wiederholte sich im ganzen Garten. Das vielleicht eindrucksvollste Beispiel lieferte eine Gruppe Torfmyrten oder Scheinbeeren, die so todkrank aussahen, dass sie Schwermut um sich herum verbreiteten. Zupfen verriet uns zwar, dass die Wurzeln noch lebten, aber da die Haupttriebe unverkennbar abgestorben waren und nichts als Braun zu sehen war, als wir ein Stück Rinde abschabten, wollte ich sie schon abschneiden, um von Grund auf neu anzufangen. Mr Page hielt mich davon ab, und tatsächlich brachten Ende Juni selbst diese braunen »abgestorbenen« Zweige die schrillgrünsten Blätter hervor.
Die Moral: Geben Sie die Hoffnung erst auf, wenn sie todsichere Beweise dafür haben, dass die Pflanze nicht mehr lebt, und wenn sie den größten Teil des Jahres warten müssen. Und zupfen Sie immer weiter.
Wir stehen immer noch auf der Schwelle, während der Garten im Mondlicht träumend auf uns wartet. In einer schattigen Ecke liegt vielleicht noch ein Rest Schnee, und obwohl wir unbedingt wissen wollen, was in unserer Abwesenheit vorgegangen ist, verharren wir noch ein wenig länger, bevor wir die Tür öffnen, denn wir haben uns anscheinend in eine praktische Stimmung hineingeredet, von der man nie weiß – jedenfalls mir geht es so –, wie lange sie anhält. Machen wir also das Beste daraus. Denn unser Experiment mit der Zitronenverbene lehrt uns eine Lektion von beachtlicher Tragweite, die wir genauso gut hier und jetzt lernen können.
Auf die Gefahr hin, völlig überkandidelt zu klingen, behaupte ich, dass der harte Winter vom gärtnerischen Standpunkt aus betrachtet mehr Positives als Negatives hatte, und zwar, weil er so viel zu unserem Kenntnisstand beitrug. Er zwang uns, viele akzeptierte Vorstellungen von der vergleichsweisen Robustheit einer ganzen Reihe von Pflanzen zu revidieren; manchmal so drastisch, dass zahlreiche Verfasser von Gartenbüchern, unter ihnen auch die Verfasser von Versandkatalogen, so manches umschreiben müssen, wenn ihre Aussagen auch weiterhin einen praktischen Wert haben sollen.
Lassen Sie mich das anhand meines eigenen Gartens verdeutlichen, angefangen bei den Fuchsien. Ich habe gerade ein paar Recherchen über diese wundervollen Pflanzen angestellt, und von einer einzigen Ausnahme abgesehen, beharren alle Experten darauf, dass Fuchsien in den Wintermonaten – und denken Sie daran, diese Leute schrieben über normale Winter – mit Laub oder Asche oder beidem geschützt werden müssen. (Die Ausnahme ist ein ganz bestimmter Gärtnereibesitzer, der von seinen eigenen Erzeugnissen derart angetan ist, dass er einen dazu überreden könnte, Kakteen auf einem Eisberg anzupflanzen, wenn er sich dadurch einen Verkauf verspräche. Alle anderen waren sich in Bezug auf die Notwendigkeit dieses Winterschutzes einig, mehrere ergingen sich sogar in ominösen Andeutungen über besonders milde Landstriche, vorzugsweise nicht allzu weit weg vom Meer.)
Nun gut … meine Fuchsien erhielten überhaupt keinen Winterschutz und machten sich hinterher besser als je zuvor. Zugegeben stehen die meisten von ihnen halbwegs günstig, im Schatten eines alten Birnbaums, trotzdem bekommen sie ihren Anteil an den eisigen Ostwinden ab, die jede Kälte noch durchdringender machen. Aber sie erhielten nicht einmal den Trost einer kleinen Handvoll Asche oder eines einzigen Farnwedels. Das lag in keiner Weise an irgendeiner Nachlässigkeit seitens Mr Page, der wochenlang in Leatherhead festsaß. Als es ihm dann endlich gelang, sich durch die Schneestürme zum Garten vorzukämpfen, kam er nachvollziehbarer Weise zu dem Schluss, dass die Fuchsien längst hinüber waren. Waren sie aber nicht und führten uns damit effektvoll vor Augen, dass viele Pflanzen robuster sind als ihr Ruf. Noch deutlicher aber zeigte uns dieser Winter, dass eine gleichermaßen große Zahl lange nicht so zäh ist, wie wir gedacht hatten.
Betrachten wir die unvergleichliche Familie der Rhododendren. Der »gewöhnliche« Rhododendron, von dem die ganze lange Linie der Aristokraten abstammt, ist natürlich der pontische Rhododendron, Rhododendron ponticum, der unsere Wälder im Juni lila färbt. Der ein oder andere Gartensnob rümpft vielleicht die Nase über die Ponticums, und es gibt ein paar alberne Frauen, die die Farbe für »vulgär« halten – was nur beweist, aus welch grobem Holz sie selbst geschnitzt sind, denn was könnte schöner sein als das Gestöber dieser Blüten zwischen dunstverhangenen Silberbirken. Es ist, als hätte Manet sich ein Gemälde von Corot vorgenommen und es mit dem Feuer seines energischeren Pinsels aufgefrischt.
Aber ob »gewöhnlich« oder nicht, meine Ponticums zeigten nichts von der Zähigkeit, die man von denen, die sozusagen bäuerlicher Herkunft sind, erwartet hätte. Überall auf den britischen Inseln wurden gerade sie am stärksten in Mitleidenschaft gezogen. Einige wurden gänzlich hingemeuchelt, andere sahen so braun und verdorrt aus, dass sie den ganzen Sommer über eine Beleidigung für das Auge darstellten. Währenddessen schüttelten ihre blaublütigen Verwandten, insbesondere die großartige Familie der x Loderi, den Schnee mit arroganter Herablassung von ihren Zweigen.
Hier ein Paradebeispiel. Als ich den Garten im vergangenen Mai für Besucher öffnete, stahl ein sehr schön gewachsener Rhododendron x Loderi ›King George‹ allen anderen die Show. Kurz vor dem Besucheransturm standen Mr Page und ich bewundernd davor, und er sagte: »Hätte jemand in Februar gesagt, dass dieser Strauch heute so aussehen würde, hätte ich gelacht. Noch vor vier Monaten waren die Blätter so fest zusammengekrampft wie eine Faust, die Zweige bogen sich unter Unmengen von Schnee, der dann auch noch fror … Es konnte einem das Herz brechen. Und sehen Sie ihn sich jetzt an!«
Die Aufforderung war überflüssig. Man konnte gar nicht anders, als ihn sich anzusehen. Auch jetzt bogen sich die Zweige unter Schneemassen, aber es war der Schnee ihrer Blüten, weiß wie mondbeschienene Seide; und die Blätter, die sich mit tropischer Üppigkeit entfalteten, glänzten wie Weintrauben. Der Strauch war so schön wie eine Braut, und wieso er ausgerechnet nach König George V. benannt wurde, gehört zu den Rätseln der gärtnerischen Namensgebung. Denn dieser Monarch, wenn auch im Privaten untadelig und im öffentlichen Leben gewissenhaft, hatte nur wenig Romantisches. Vielmehr denkt man bei ihm an Bärte und Schlachtschiffe, und die wenigen Echos seiner Stimme, die uns überliefert blieben, besitzen nicht viel Melodisches. Während dieses berückende Pflanzenwesen die ganze Luft um sich herum zum Klingen brachte. Eines Tages sollte irgendwer eine Abhandlung über die Benennung von Pflanzen schreiben, wenn auch nur, um die Tatsache zu beklagen, dass viele wunderbare Blumen die Namen von Frauen tragen, die klingen, als hätten sie ihr ganzes Leben am Spülbecken verbracht.
Unsere praktische Stimmung lässt allmählich nach. In ein paar Minuten werden wir sie wieder einfangen, aber erst möchte ich mich dem Luxus hingeben, einen der vielen Gründe zu erläutern, weshalb die Rhododendren für mich einen so einzigartigen Zauber besitzen. Wir alle wissen – oder sollten zumindest wissen –, dass die Blüten, sobald sie welken und vergehen, abgeknipst werden müssen, um die Blütenbildung fürs nächste Jahr anzuregen. Dieses Vorgehen nennt man »ausbrechen«. Aber manchmal greife ich dem Prozess des Verblühens ein wenig vor und rüttele an den Zweigen, sodass einige der Blütenblätter vor ihrer Zeit abfallen. Tut man das, eröffnet sich einem auf der Stelle eine magische Welt. Die Blütenblätter lösen sich und breiten sich in rosigen, weißen, elfenbeinfarbenen und scharlachroten Mustern auf dem Boden aus. Dann bückt man sich und arrangiert sie vorsichtig um, so als knie man zu Füßen einer wunderschönen Frau und ordne die Falten ihres Kleides, während sie für ihr Porträt posiert. In den Monaten Mai und Juni finden sich überall im Garten diese kleinen Farbtümpel, und obwohl die Sonne ihnen allmählich den Glanz raubt und es den Anschein hat, als verblassten sie in den Boden hinein, auf dem sie liegen, kann einen das kaum traurig stimmen. Denn sie kehren nur nach Hause zurück, in die gute Erde unter den schützenden Armen der Mutter, die sie gebar.
Nun können wir dieses Kapitel mit einer Liste jener Pflanzen und Sträucher aus meinem eigenen Garten beenden, die dem Wüten des Winters zum Opfer fielen. Die Liste ist nicht lang, aber vielsagend und gelegentlich überraschend. Vielleicht hat sie einen gewissen Wert für alle, die noch am Anfang ihres gärtnerischen Lebens stehen und sich von dem, was sie in den Gartenkatalogen lesen, entweder in die Irre führen lassen oder aber – was wahrscheinlicher ist, denn Versandgärtnereien sind absolut ehrenwerte Institutionen – die in ihnen geäußerten Warnungen störrischerweise missachten.
Die Liste ist alphabetisch geordnet und beginnt mit …
Azara microphylla, ein eher seltener, eleganter kleiner Winterblüher, dessen Loblied ich schon einmal gesungen habe. Angepflanzt haben wir die Azara wegen des süßen Vanilledufts ihrer kleinen weißen Blüten, die sich normalerweise ab Januar öffnen. An sonnigen Vormittagen gibt es nichts Aufregenderes als diesen exotischen Duft, der durch die schneidend kalte Luft wabert. Gerade habe ich nachgesehen, was ich damals über dieses betörende Geschöpf schrieb: »Die Azara ist nicht sehr robust, aber auch nicht über Gebühr empfindlich. Ihre eine Grundbedingung ist eine Mauer, falls möglich sogar eine Mauerecke, weil sie Wind hasst.«
Anscheinend war diese Einschätzung einigermaßen zutreffend. Um auf der sicheren Seite zu sein, hatten wir zwei Azaras gepflanzt, im Abstand von einem guten Meter voneinander. Eine von ihnen gab den Geist auf; die andere verlor zwar die meisten Blätter, trieb im April aber munter aufs Neue aus. Falls Sie also im nächsten Januar zufällig die Ham Gate Avenue entlangspazieren und von einem unerwarteten Vanilleduft betört werden, wissen Sie, wo er herkommt. Und vielleicht finden Sie es das Risiko wert, in Ihrem eigenen Garten auf das Überleben der Azara zu setzen.
Ceanothus. Wir hatten zweieinhalb verschiedene Säckelblumen, manchmal auch kalifornischer Flieder genannt, von denen nur eine überlebte. Bitte wundern Sie sich nicht über die angegebene Zahl: Die »halbe« Pflanze wuchs im kleinen Vorgarten meiner Nachbarin Mrs Poyser, hatte ihre hübschen Arme aber so zuvorkommend in meinen Garten hineingereckt, dass ich sie zum Teil als mein eigen betrachtete. (Es sollte mehr dieser erfreulichen nachbarschaftlichen Kooperation geben.) Jedenfalls wurde dieser schöne alte Strauch von den eisigen Winden, die über den Common fegten, zu Tode gepeitscht. Falls Sie sich also eine Ceanothus zulegen wollen, würde ich diese Sorte von meiner Liste streichen, es sei denn, Sie können ihr eine sehr geschützte Ecke bieten. Der korrekte Name lautet Ceanothus dentatus, gezähnte Säckelblume.
Selbst wenn Sie eine geschützte Ecke zu bieten haben, können Sie auch Ceanothus x Burkwoodii von Ihrer Liste streichen. Meine stand in einer der begehrtesten Ecken des Gartens und schied trotzdem dahin, schnell und unwiderruflich.
Bleibt nur … Ceanothus ›Autumnal Blue‹. Sie begrüßte den Frühling mit allen Anzeichen eines floralen Katers, obwohl sie im Schutz einer Mauer wuchs. Aber im Lauf des Jahres bewies das energische Wachstum, das sie an den Tag legte, dass sie triumphierend aus einer Prüfung hervorgegangen war, die sie aller Wahrscheinlichkeit nach nie wieder wird ertragen müssen. Ja – Autumnal Blue ist auf jeden Fall Ihre beste Wahl.
Cryptomeria japonica elegans, eine wunderschöne Sicheltanne, deren fiedrige Nadeln das herbstliche Feuer so intensiv einfangen, dass man das Gefühl hat, sich die Hände daran wärmen zu können. Ich hielt sie für robust; offensichtlich ist sie das nicht. Der Winter ließ ihr Feuer erlöschen und meuchelte sie ein für alle Mal dahin. Trotzdem glaube ich, dass sie mit einem Minimum an Schutz überlebt hätte.
Übrigens verhielten sich sämtliche Koniferen irgendwie unerwartet. Einige der Lawsons Scheinzypressen, auch Oregonzeder genannt, von denen ich gedacht hatte, sie seien so abgehärtet wie königliche Leibgardisten, sahen bis weit in den Sommer hinein frostverbrannt und jämmerlich aus, während die aristokratischeren Goldzypressen, Chamaecyparis Lawsoniana lutea, alles relativ unbeschadet überstanden.
Escallonia. Allmählich glaube ich, dass nur die Iren perfekte Escallonias hinbekommen. Ob sie das verdienen, ist eine andere Frage. Wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, kann man nie entscheiden, was dieses irritierende, paradoxe, unberechenbare und bewundernswerte Völkchen verdient, und kann nur bestätigen, dass sie nie bekommen, was sie verdienen und umgekehrt. Irgendwann habe ich mal geschrieben: »Frauen, Elefanten und Iren vergessen niemals eine Kränkung.« Diese tiefgründige Bemerkung möchte ich hier ergänzen durch – »Escallonias auch nicht«.
Meine jedenfalls haben die Kränkung des harten Winters, um den es in diesem Kapitel geht, nicht vergessen. Hätte ich mehr Platz, würde ich mich jetzt vielleicht zu fantasievollen Analogien zwischen Gartenbau und Geschichte hinreißen lassen … Die erwähnten Escallonias stammten jedenfalls aus irischen Gärtnereien, und ihr Verhalten war fast exzessiv irisch. Wenn man dachte, sie seien tot, brachten sie urplötzlich ein kleegrünes Blatt und eine Blüte hervor, die so stolz daherkam wie eine Flagge. Ging man dann in allerfreundlichster Absicht hin, um ein bisschen Hilfestellung zu leisten, welkten die Blüten und die Blätter vergilbten. Auch wenn ich es selbst sage – die lang andauernde Liebe-Hass-Beziehung zwischen Briten und Iren ließe sich kaum treffender auf den Punkt bringen.
Die einzige Escallonia, die britische Gärtner bedenkenlos anpflanzen können, ist die Hybride Escallonia x langleyensis. Mag sein, dass sie weder die Anmut noch den rosigen Schimmer noch die Finesse meiner irischen Sorten besitzt, die tot und dahin sind. Aber sie trotzt Wind und Wetter und ist einigermaßen berechenbar.
Pieris formosa Forrestii. Sie ist, zu unserem großen Bedauern, von uns gegangen.
Ehe ich fortfahre, möchte ich die Pieris beschreiben, damit Sie verstehen, wieso ich von »Bedauern« spreche. Nichts ist ärgerlicher, als über Dinge zu lesen, die man sich nicht bildlich vorstellen kann.
Die Pieris, die zu den Lavendelheiden oder Schattenglöckchen gehört, ist eins der spektakulärsten in der Natur vorkommenden Beispiele für den Triumph von Blatt über Blüte. Wenn ich es recht bedenke, kann ich mich nicht einmal richtig erinnern, was für Blüten sie überhaupt hervorbringt. Aber die Blätter schillern und schimmern und gehören zu den magischsten der vielen Laternen, die im April in den Wäldern entzündet werden. Wenn Sie in der Nähe Londons leben und sich zur Isabella Plantation im Richmond Park begeben, können Sie das Leuchten dieser kleinen Laternen sehen, das selbst den trübsten Nachmittag erhellt. Die oberen Blätter sind von einem leuchtenden, ganz leise von Zimt überhauchten Kirschrot, und sie behalten diese Farbe wochenlang bei und sehen dabei so festlich aus, dass manche Leute sie für Blüten halten. Aber offensichtlich waren sie zu zart für die Attacken, denen sie ausgesetzt waren. Trotzdem bestelle ich noch eine und werde ihr eine Polyethylendecke zur Verfügung stellen, oder besser noch ein kleines Zelt.
Rosmarin. Der praktisch totale Kollaps aller Rosmarine auf den ganzen britischen Inseln gehört zu den schmerzlichsten und verwunderlichsten Phänomenen dieses Winters. Irgendwie hatte ich immer angenommen, Rosmarin sei so zäh wie Lavendel, vielleicht weil es so viele Erinnerungen an Cottage-Gärten gibt, in denen der Rosmarin Hecken von bis zu anderthalb Metern Höhe bildet. In Garden Open Today sang ich ausführliche Loblieder auf die Rosmarine und erwähnte mehrere vergleichsweise ungewöhnliche Sorten, die mir besondere Freude bereitet hatten, insbesondere Rosmarinus officinalis albus, Rosmarinus officinalis rosea und Rosmarinus officinalis ›Tuscan Blue‹. Zu meiner Ehrenrettung kann ich sagen, dass ich über die letztgenannte Sorte schrieb: »Für meinen Geschmack zu empfindlich.« Aber ich dachte, die beiden anderen würden den Stürmen eines strengen Winters standhalten. Offensichtlich nicht. Wenn Sie also eine Vorliebe für Rosmarin haben, sollten Sie sich an den Liebling früherer Zeiten halten, Rosmarinus officinalis angustifolius. In meinem Garten starben selbst bei dieser Sorte alle oberirdischen Teile ab, aber die Wurzeln überlebten.
Ehe wir die Rosmarine verlassen, möchte ich Sie noch auf die charmante Herkunft des Namens aufmerksam machen. Wie üblich war mein Informant mein alter Freund Marius mit seiner enzyklopädischen Gelehrsamkeit. Ich hatte immer gedacht, der Name gehe auf irgendeine Dame aus dem sechzehnten Jahrhundert zurück, eventuell bei Shakespeare, die, immerzu mit einer weißen Schürze angetan, durch Cottage-Gärten wandelt und Rosmarinzweige in ihren altmodischen Flechtkorb legt. Weit gefehlt. Der Name leitet sich vom Lateinischen ros ab, »Tau«, weil sich in der Nähe des Meeres, wo der Rosmarin gern wächst, der Tau über Nacht auf den Blüten sammelt, und von marinus, was natürlich »Meer« bedeutet. Diese Art von Information, beiläufig während eines Spaziergangs durch den Garten fallen gelassen, ist dazu angetan, selbst liebste Freunde zu irritieren.
Damit wären wir am Ende unserer Liste der Todesopfer angelangt, ausgenommen ein paar wenige Unglücksraben im Gewächshaus, auf die wir in einer Minute eingehen werden. Der Leser stimmt uns vielleicht zu, dass wir uns alles in allem ganz gut geschlagen haben, und ich könnte mir vorstellen, dass das auf die meisten britischen Gärten zutrifft.
Das Gewächshaus war zweifellos kalt, aber nicht so kalt, wie wir befürchtet hatten. Eingangs erwähnte ich bereits, dass Mr Gaskin Schwierigkeiten hatte, sich durch den Schnee bis dorthin vor zu graben, und die einzige künstliche Wärme, die es abbekam, stammte von einem kleinen, billigen Ölofen, der weniger als sechs Liter Paraffin die Woche verbrauchte. Trotzdem lag die tiefste Temperatur, die im ganzen Winter gemessen wurde, nur knapp unter dem Gefrierpunkt. Wenn wir bedenken, dass in der ganzen Umgebung fast minus 18 Grad herrschten und die dünnen Glasscheiben ständig von einer Serie heftigster Schneestürme attackiert wurden, können wir uns zu diesem erstaunlichen Ergebnis nur gratulieren, auch wenn der ein oder andere Leser vielleicht meint, dass es fast zu erstaunlich ist, um wahr zu sein.
Aber es stimmt. Unser Erfolgsgeheimnis, das unsere Verluste auf ein Minimum beschränkte – ein paar Duftpelargonien, eine Schmucklilie und eine Schönmalve –, liegt in dem Wort »Polyethylen«. Damit nämlich hatte Mr Page in seiner Weisheit das Innere des Treibhauses schon Anfang des Winters ausgekleidet. Ich habe viel Abfälliges über Polyethylen gesagt, wenn es dazu benutzt wird, Teiche auszukleiden, weil es mich in diesem Zusammenhang stark an feuchte Unterwäsche erinnert – in den triefendnassen Schubladen sehr alter Gentlemen. Daher möchte ich nun seine Tugenden im Gewächshaus preisen. Als Isolation sowohl gegen Hitze als auch gegen Kälte ist es von unschätzbarem Wert; ohne es wäre die Temperatur um weitere zehn Grad abgesackt. (Genau das geschah unter den exakt gleichen Bedingungen in einem nicht mit Polyethylen ausgekleideten Gewächshaus eines Nachbarn.) Polyethylen ist nicht direkt schön, aber es ist auch nicht hässlich, und die Vitalität meiner Pflanzen beweist, dass es keine lebenswichtigen Lichtstrahlen abhält. Das Einzige, was eventuell gegen seine Verwendung spricht, ist die Tatsache, dass sich gelegentlich eine Biene darunter verirrt und sich in Panikzustände hineinsteigert. In diesem Fall muss man nur eine der Reißzwecken entfernen und die Biene wegscheuchen, was nun wirklich keine besonders herkulische Leistung ist.
Ein letztes Wort zum Seerosenteich. Wie Sie vielleicht bereits gemerkt haben, ist Wasser die Grundlage meiner Gartenphilosophie.
Keine der Wasserpflanzen im Seerosenteich wurde von der außergewöhnlichen Härte des Winters auch nur im Geringsten in Mitleidenschaft gezogen.
(Das gehört wirklich zu den Anlässen, da man es einem Autor verzeihen kann, dass er zu Kursivschrift greift, um die Bedeutung des Gesagten hervorzuheben.)
Die Wurzeln dieser wundervollen Pflanzen steckten monatelang in einer soliden Eisschicht fest. Störten sie sich daran? Überhaupt nicht. Im April leuchteten die goldenen Rosetten der Calthas, der gefüllten Sumpfdotterblume, intensiver denn je; es wurde Mai, und die schlanken Speere der Iris laevigata, der japanischen Sumpf-Schwertlilie, reckten sich himmelwärts, und ihre Blüten, die an Meißner Porzellanmalerei erinnern, entfalteten sich bereits. Im Frühsommer bildeten die Seerosen – die Sorten Laydekeri und Albatros – Blütenteppiche in Rosa und Weiß; und im August boten die Hechtkräuter mit ihren zeigefingerartigen Blättern ein leuchtendes Schauspiel in Hyazinthenblau. Von allen Schlachten im Garten, die die Blumen siegreich ausfochten, war die Schlacht um den Seerosenteich die wackerste und beeindruckendste.
PRAKTISCHER HINWEIS
Dies ist vielleicht ein guter Augenblick für ein paar Worte über Kleingewächshäuser. Anders als Mr Page bin ich nicht direkt »gegen« sie, aber sie haben ihre Nachteile und Grenzen. Diejenigen aus Glas gehen früher oder später unweigerlich kaputt, und dann steht man vor einem Wust aus gesplitterten Scheiben und verbogenem Draht, der dienstagnachmittags, wenn die Müllabfuhr kommt, unweigerlich zu gerunzelten Stirnen und Gebrummel führt. Die aus Plastik haben die Angewohnheit, bei jedem stärkerem Wind davonzufliegen. Das vielleicht Langweiligste an ihnen ist jedoch, dass sie nicht für Ecken und Winkel geeignet sind. Falls Sie immerzu endlose Reihen Frühsalat in langen, geraden Rillen anpflanzen, sind die Kleingewächshäuser wie für Sie gemacht. Aber wenn Sie es, wie die meisten Amateurgärtner, auch mit kleinen, unebenmäßigen Stellen zu tun haben, beispielsweise einem schiefen Dreieck mit empfindlichem, eben erst nach draußen gepflanztem Rosmarin, werden Sie sich fragen, ob die Dinger wirklich die Mühe wert sind.
Hier kommen wir nun zu Mr Pages Polyethylen-Erfindung, die nicht simpler, billiger oder effektiver sein könnte. Alles, was wir tun müssen, ist Folgendes: Wir suchen uns ein paar Farnwedel, breiten sie dick über die Pflanze oder das Fleckchen Erde, das wir schützen wollen, schneiden ein passendes Stück Polyethylen zurecht, legen es über die Farnwedel und befestigen es mit ein oder zwei Backsteinen. Falls kein Farn zur Hand ist, tut es auch ein Eimer Herbstlaub. Natürlich können wir diese Technik nicht bei hohen Pflanzen anwenden, aber für niedrige, oder für empfindliche Zwiebeln wie die von Hakenlilien, Amaryllis oder allen Schmucklilien, ist sie von unschätzbarem Wert. Das Polyethylen bildet eine Art Minizelt, das fast so effektiv ist wie ein Gewächshaus und weit weniger unansehnlich als ein Kleingewächshaus. Bei ungewöhnlicher Trockenheit oder an besonders sonnigen Tagen, wenn der Winter sich seinem Ende nähert, können wir das Polyethylen ein Stückchen anheben und den Pflanzen ein bisschen Wasser geben.
Für diese und, wie wir noch sehen werden, zahlreiche weitere Erfindungen von ähnlicher Genialität, verdient Mr Page, wie alle mir beipflichten werden, den Dank der ganzen Menschheit.
1 Lesern, die einen Blick auf die Widmung geworfen haben, wird aufgegangen sein, dass Four und Five nicht mehr unter uns weilen. Sie hatten ein hohes Alter erreicht, als sie sich von dieser Welt verabschiedeten. Four wurde neunzehn Jahre alt, Five seufzte sich an seinem einundzwanzigsten Geburtstag in den Schlaf. Aber beide sind mir so lebhaft in Erinnerung, dass ich nicht in der Vergangenheitsform über sie schreiben will.