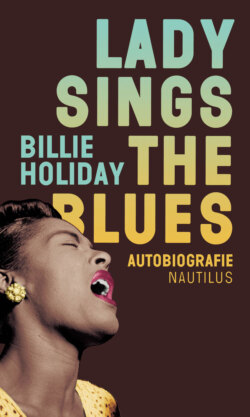Читать книгу Lady sings the Blues - Billie Holiday - Страница 6
2. Ghost of Yesterday
ОглавлениеIm Sommer 1927 sprach alle Welt von Lindberghs Flug nach Paris, als ich es allein von Baltimore bis nach New York schaffte.
Nach meinem Rausschmiss aus dieser katholischen Anstalt hatten meine Mutter und ich von Baltimore die Nase voll. Außerdem wollten wir nach der Sache mit Mister Dick auch mit Untermietern nichts mehr zu tun haben, sodass meiner Mutter nichts anderes übrig blieb, als wieder irgendwo als Hausmädchen zu schuften. Da sie jedoch in Baltimore nicht mal die Hälfte von dem bekam, was sie im Norden verdient hatte, nahm ich meinen Eimer und den Schrubber und zog ebenfalls wieder von Haus zu Haus, um das fehlende Geld aufzutreiben, damit wir zusammenbleiben konnten.
Es war schon lange dunkel, als ich eines Nachts nach Hause kam. Ich hatte den ganzen Tag gearbeitet und nur neunzig Cent verdient. Meine Mutter sah mich an und fing mit einem Mal an zu weinen, so zerschlagen sah ich aus. Ich versuchte, sie zu trösten und sagte, dass es mir gutginge, aber sie hörte nicht auf, immer wieder vor sich hin zu sagen: »Es muss doch irgendwo etwas Besseres für uns geben.« Doch wenn es etwas Besseres gab, dann nicht hier in Baltimore, das wussten wir beide, sondern oben im Norden.
Also zog sie los, und ich ging zurück in das kleine Haus, um wieder mit Cousine Ida und ihrem Mann, Großvater und Großmutter und meinen kleinen Cousins Henry und Elsie zusammenzuleben und auf den Tag zu warten, wo meine Mutter mich nach New York holen würde.
Obwohl das Zusammenleben mit Ida genauso verlief wie früher und obwohl ich das Ende davon kaum erwarten konnte, fand ich die Art, wie es aufhörte, abscheulich. Sie war wirklich eins der schlimmsten schwarzen Weibsbilder, die je auf Gottes Erde gelebt haben, aber ihren Tod habe selbst ich ihr nicht gewünscht. In unserer Familie gab es die Veranlagung zum Kropf. Meine Mutter hatte auch einen, aber der von Ida war mit Abstand der Schlimmste. Ein furchtbar großes Ding, das ihr vom Kinn bis auf die Brust hing. Eines Tages hatte sie einen Erstickungsanfall, und der Einzige, der da war und ihr hätte helfen können, war ihr Mann, der sich jedoch halb bewusstlos gesoffen hatte. Sie fiel auf die Knie, japste nach Luft und verreckte schließlich wie ein Köter. Der Arzt sagte, dass es ausgereicht hätte, wenn ihr Mann sich aufgerafft hätte, um das Fenster zu öffnen und etwas frische Luft reinzulassen. Doch selbst dafür hatte er nicht mehr genug Kraft gehabt. So gemein sie auch war, diesen Tod hatte ich ihr nicht gewünscht.
Damals behielt man die Verstorbenen wegen der Totenwache und der anderen Trauerzeremonien immer noch für zwei Wochen im Haus. Ida und ihr Mann waren Baptisten und machten meiner Mutter und mir immer das Leben schwer, weil wir katholisch waren. Ständig rissen sie blöde Witze über meine Mutter mit ihren Kerzen und dem Herumgerutsche vor dem Altar. Als ich mich nun weigerte, Ida noch einmal aufgebahrt anzusehen, dachten alle, dass es etwas damit zu tun hätte. Sie ließen mich einfach nicht in Ruhe und schließlich, als ich mich immer noch nicht in die Nähe traute, wurde ich gepackt und einfach über den Sarg gehalten. Man zwang mich, sie anzusehen, und mir wurde speiübel.
Ida war gerade gestorben, und niemand kümmerte sich um Henry und Elsie, von mir ganz zu schweigen. Da schrieb meine Mutter, dass ich nach New York kommen sollte. Ich machte noch die fünfte Klasse fertig, und als ich nach dem letzten Schultag nach Hause kam, band mir mein Großvater eins von diesen riesigen Schildern um den Hals, auf denen steht, wie man heißt und wo man hin will, und Großmutter machte mir einen Korb mit Brathähnchen und gekochten Eiern zurecht. Es war so viel zu essen, dass Lindbergh damit spielend über den Atlantik gekommen wäre. Dann brachte mich Großvater zum Zug. Ich hatte eine Fahrkarte nach Long Branch, wo mich meine Mutter abholen wollte. Sobald ich jedoch im Zug saß, entschloss ich mich, Long Branch hin, Long Branch her, irgendwie nach Harlem zu kommen. Ich nahm also mein Erkennungsschild ab und beschloss, in New York auszusteigen, dort die U-Bahn nach Harlem zu nehmen, mich dort ein bisschen rumzutreiben und dann meine Mutter zu verständigen.
Ich war zwar erst dreizehn, aber schon mit allen Wassern gewaschen. Ich reiste zwar ohne Gepäck, von dem Fresskorb mal abgesehen, aber immerhin reiste ich. Als ich in New York an der Pennsylvania Station ausstieg, war ich mitten in der größten Stadt, die ich je gesehen hatte. Ich ließ mir Zeit, alles aufzusaugen, schlenderte umher und schaute mir die großen Gebäude an. Ich muss schon ein seltsames Bild abgegeben haben, wie ich so mit großen Augen herumtapste, meinen kleinen Koffer und den Korb mit den Esssachen immer dabei.
Es war schon dunkel, als mich eine Sozialarbeiterin entdeckte und sofort wusste, dass ich abgehauen war. Diese Frau von der Fürsorge war eine Weiße, aber sie war unbeschreiblich nett. Sie fragte mich, wo ich herkäme, wie ich hieß, wo ich hinwollte, wer meine Mutter wäre und all so ein Zeug. Ich aber sagte nichts, nicht mal meinen Namen. Niemand würde mich davon abhalten, nach Harlem zu kommen. Es stellte sich heraus, dass sie dem Kinderschutzbund angehörte. Sie wollte mich zu ihrem Vereinsgebäude mitnehmen, aber es war schon spät, und das Haus hatte schon geschlossen, was sich später als mein großes Glück herausstellen sollte. Sie nahm mich also mit, kaufte mir etwas zu essen, und dann brachte sie mich zu einem feinen Hotel, wo sie mir ein Zimmer mit einem eigenen Bett besorgte. Dieses Hotel haute mich um. Jahre später bin ich noch einmal zurückgekommen, um mir alles noch mal anzusehen, da musste ich allerdings feststellen, dass es nur ein CVJM-Heim war, während ich mich damals wie im Waldorf Astoria fühlte. Diese Frau war so nett, dass ich versuchte, einen Job bei ihr zu bekommen.
»Ich werde für Sie arbeiten«, sagte ich, »ich werde Ihr Haus sauber halten, die Treppen putzen und den Fußboden schrubben.« Als sie mich jedoch nach meinem Namen fragte, blieb ich weiterhin stumm. Sie machte einen sehr klugen Eindruck auf mich, denn sie lächelte mich nur an, als ich meinen Namen nicht sagen wollte und meinte: »Ich kenne dich. Du bist gerissen.«
Am nächsten Morgen nahm sie mich mit zum Kinderschutzbund. Es war schön dort. Es gab gutes Essen, und es waren viele Kinder da, die nichts anderes zu tun hatten als zu spielen. Hinter dem Haus lag ein eingezäunter riesiger Spielplatz mit Rutschbahnen und Schaukeln und allem Drum und Dran.
Ich muss dort einige Wochen verbracht haben, bevor meine Mutter herausbekam, wo ich mich aufhielt. Eines Morgens wurde ich runtergeholt, weil eine Frau gekommen war, um mich abzuholen. Es war jedoch nicht meine Mutter, sondern eine Frau namens Levy.
»Ich gehe nicht mit Ihnen«, sagte ich ihr geradeheraus. »Ich bleibe hier.«
»Warum denn?«, fragte sie mich. »Hast du einen bestimmten Grund?«
»Nein, keinen«, sagte ich, »mir gefällt es hier einfach.«
»Aber ich will dich doch zu deiner Mama bringen.«
Mir fiel auf, dass sie weder »Mutter« noch »Mami« gesagt hatte. Sie hatte »Mama« gesagt, und der Ton, in dem sie es gesagt hatte, brachte mich dazu, es mit ihr zu versuchen. Mrs Levy war die Frau, für die meine Mutter in Long Branch arbeitete. Sie erzählte mir, dass meine Mutter auf die Kinder aufpasste, während sie mit dem Auto runtergefahren war, um mich abzuholen.
Dass sie ein Auto hatte, gab den Ausschlag. Und als ich erst sah, was für ein tolles Auto das war, wäre ich überall mit hingekommen, nur allein wegen der Fahrt. Ich hatte noch nicht so oft in einem Auto gesessen, dass ich einfach eine Fahrt hätte ausschlagen können. Also fuhren wir von New York nach Long Branch.
Endlich sollten Sadie und ich wieder zusammen sein. Wir würden es schon schaffen. Meine Mutter hatte mir sogar eine Arbeit besorgt. Als Dienstmädchen natürlich. Als was auch sonst?
Die Frau, für die ich arbeitete, war groß, fett und faul. Sie tat den lieben langen Tag nichts anderes, als ihren fetten Arsch zum Strand zu schieben. Ich tat auch nicht viel mehr. Alles, was ich zu tun hatte, war essen und schlafen, ein paar Zwiebeln und ein bisschen Gemüse schälen, damit ihre Hände sauber blieben, ein paar Teller waschen, damit ihre Hände nicht rau wurden und ein bisschen abstauben, damit sie sich nicht bewegen musste.
Dieses fette, dicke, schmierige Weib tat den ganzen Tag nichts. Dann, eine Viertelstunde bevor ihr Mann zum Essen kam, machte sie einen Wirbel, und anstatt mir zu sagen, was ich machen sollte, da ich mich in ihrem komischen Haus nicht auskannte, brüllte sie mich an und nannte mich »Nigger«. Ich hatte diesen Ausdruck noch nie zuvor gehört und wusste auch nicht, was er bedeutete. Nur an dem Tonfall konnte ich die Bedeutung heraushören. Es war schon verrückt, dieses Haus, vollgestopft mit seltsamen Möbeln und Plunder, der nur Staub fing. Und dann Kissen, überall Kissen. Mein Gott, was hat sie mich wegen dieser Kissen verfolgt!
Ich blieb nicht lang. Eines Tages, bevor sie zum Strand abzog, zerrte sie ein großes altes Laken heraus, warf es mir zu und sagte, ich solle es waschen. Das war zu viel. Ich war nicht angestellt, um die Wäsche zu machen. Also sagte ich ihr, was sie mit ihrem verdammten Laken machen könne. Das war das Ende von diesem Job. Vor allem aber wollte ich nicht ihr oder irgendjemandes Dienstmädchen sein. Irgendwo musste es doch etwas Besseres geben, dachte ich.
Als ich zu meiner Mutter zurückkam und ihr erzählte, was passiert war, wusste sie nicht, was sie mit mir machen sollte. Ihr war klar, dass ich es als Dienstmädchen nie zu etwas bringen würde. Ich hatte gerade die fünfte Klasse in Baltimore zu Ende besucht und war nicht weiter zur Schule gegangen. Würde ich zurückgehen, würden die bestimmt wissen wollen, wo um alle Welt ich gewesen war. Solange ich keinen Platz zum Leben hatte, konnte ich sowieso nicht zur Schule gehen. Meine Mutter hatte etwas Geld gespart und beschloss schließlich, mich irgendwo in Harlem unterzubringen.
Obwohl meine Mutter eigentlich nicht richtig spießig war, gab es doch viele Dinge, die sie nicht begriff. Die Wohnung, die sie für mich fand, war nichts Geringeres als ein Zimmer in einem prachtvollen Wohnhaus in der 141. Straße in Harlem, wo die Bewohner damals eine ganz schön hohe Miete zahlten.
Meine Mutter mietete für mich ein Zimmer in der Wohnung einer Dame mit Namen Florence Williams. Ich hatte nicht umsonst bei Alice in Baltimore Kübel ausgeleert, Lifebuoy-Seife und Handtücher rausgelegt, um nicht gleich zu wissen, was da vor sich ging. Meine Mutter hingegen hatte keinen blassen Schimmer. Sie zahlte die Miete im Voraus und bat diese raffiniert aufgemachte Dame mit dem ehrbarsten Gesicht der Welt, die wirklich eine der größten Damen in ganz Harlem war, auf ihre kleine Tochter aufzupassen. Sie hätte genauso gut ihre kleine Eleanora bitten können, auf Florence achtzugeben.
Ich hielt mich damals für ein aufgewecktes Ding, das die Chance hatte, innerhalb einiger Wochen ein Fünfundzwanzig-Dollar-Callgirl zu werden – also griff ich zu. Die Umgebung war ohnehin nichts Fremdes für mich. Das einzig Neue, was auch ich noch nicht kannte, war dieses tolle Telefon. Ich hatte diese seltsam aussehenden Dinger schon im Kino gesehen. Man konnte sie benutzen, während man im Bett lag, anstatt jedesmal aufstehen und zu der jeweiligen Wand gehen zu müssen, an der es befestigt war. Schon beim ersten Mal hatte ich mir gesagt, dass ich so ein Telefon haben musste. Doch nicht einfach irgendeins, nein, es musste ein weißes Telefon sein. Und genau so eins bekam ich bei Florence.
Bald hatte ich zwei junge weiße Typen, die regelmäßig jede Woche als Kunden kamen, einer am Mittwoch und der andere am Samstag. Manchmal kam einer von ihnen auch zweimal die Woche. Florence bekam von den zwanzig Dollar, die es mir jedesmal brachte, fünf für die Miete, wobei mir aber immer noch mehr blieb, als ich je als Dienstmädchen in einem gottverdammten Monat zusammengebracht hätte. Und diesmal hatte ich jemanden, der meine Wäsche wusch. Es war nur ein kleines Haus, Florence hatte außer mir nur noch zwei Mädchen, eine Asiatin, die Gladys hieß, und eine Weiße, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnern kann.
Es dauerte nicht lange, und ich hatte genug Geld, um mir endlich ein paar Sachen zu kaufen, die ich mir schon immer gewünscht hatte: mein erstes Kleid aus wirklich echter Seide und für zehn Dollar ein Paar Lackschuhe mit Pfennigabsätzen.
Trotzdem fehlten mir zum Callgirl entscheidende Dinge. Vor allem, und das hatte seinen verdammt guten Grund, bereitete mir alles, was mit Sex zu tun hatte, eine Heidenangst. Zuerst war ja da die Sache mit Mister Dick gewesen, dann, als ich zwölf war, hatte mich ein Trompeter aus einer Negro Big Band im Wohnzimmer meiner Großmutter auf dem Boden genommen. Für mich war das das erste Mal gewesen, wobei das Ganze so brutal ablief, dass ich von Männern eine ganze Zeit lang die Nase voll hatte. Ich erinnere mich, dass er mir so wehgetan hatte, dass ich glaubte sterben zu müssen. Ich nahm meine blutverschmierten Kleider, ging zu meiner Mutter und warf sie ihr angeekelt vor die Füße.
»Das war es also, was ihr immer gemacht habt, als ich in dieser Kiste aus Zedernholz am Fußende eures Bettes geschlafen habe?«, schrie ich sie an.
Was konnte sie schon darauf sagen? Nichts. Sie jammerte etwas darüber, dass ihr kleines Mädchen es mit einem Mann gemacht hatte und ängstigte sich halb zu Tode bei dem Gedanken, dass ich ein Kind bekommen könnte, so wie sie mich bekommen hatte. Ich hatte sie an einem Punkt getroffen, an dem sie sich nicht wehren konnte.
Damals schwor ich mir, dass es mit den Männern ein für alle Mal vorbei ist und sagte ihr, dass sie sich nicht länger Sorgen zu machen bräuchte, dass ich das täte, was sie immer mit meinem Vater getan hatte.
Dann kam eines Tages ein riesiger Schwarzer in Florences Apartment und bestand darauf, mich zu bekommen – mich oder keine. Er gab mir fünfzig Dollar; und das war auch das Mindeste. Dafür, dass er mich beinahe umbrachte, war es ein Spottpreis.
Tagelang konnte ich nicht aufstehen, geschweige denn irgendetwas anderes machen. Meine Mutter besuchte mich während dieser Zeit, als ich krank im Bett lag. Sie wusste nicht, was passiert war, aber nachdem sie mich sah, sagte sie sofort, dass ich augenblicklich in ein Krankenhaus müsste.
Mir ging es so dreckig, dass mir alles egal war … Bis ich sah, was auf der Mütze von dem Typ stand, der mit der Ambulanz gekommen war. Ich hatte schon von diesem Krankenhaus gehört. Ich kannte Mädchen, die dort wegen einer Lungenentzündung hingegangen waren und ohne Eierstöcke zurückkamen. Also setzte ich mich auf, schickte den Krankenwagen weg, schleppte mich ins Bad, aß wenig später eine Kleinigkeit und war wieder auf dem Damm.
Es ist also kein Wunder, dass ich eine Todesangst vor Sex hatte. Und es ist auch kein Wunder, dass ich das getan habe, was ich tat, als dieser Schwarze mit Namen Big Blue Rainier auftauchte. Er war mit Bub Hewlett zusammen, dem damals fast ganz Harlem gehörte. Beide sind mittlerweile tot, aber damals waren sie ganz große Tiere.
Ich kam ins Gefängnis, weil ich mich weigerte, mit Blue ins Bett zu gehen. Ich versuchte, ihm zu erklären, dass ich nichts persönlich gegen ihn hatte und dass ich lediglich nicht mehr mit schwarzen Kunden ins Bett ging.
Mit meinen festen weißen Kunden war es ein Kinderspiel. Sie hatten Frauen und Kinder, zu denen sie anschließend nach Hause gingen. Wenn sie zu mir kamen, ging alles ruckzuck. Danach das Geld und schon waren sie wieder weg. Außerdem reichten mir die beiden, um das Geld, dass ich zum Leben brauchte, zusammenzukriegen. Schwarze aber halten dich die ganze Nacht wach, reden so ein Zeug wie: »Ist es gut so, Baby?« und »Wie wär’s, wenn aus uns beiden was Festes würde?« Da redet man immer groß darüber, dass Frauen giftig werden, wenn man sie abweist – na, da hättet ihr mal Big Blue erleben sollen!
»Für wen hält sie sich?«, brüllte er Florence an. »Sie ist das einzige farbige Mädchen im ganzen Haus und will keinen Schwarzen?«
Florence war eine anständige Frau, aber es hätte sie das Leben kosten können, mich zu verteidigen.
Blue wusste, dass ich noch ein Kind war, trotzdem ließ er mich hochgehen. Bub und er waren mit den Bullen richtiggehend befreundet. Am nächsten Morgen, als ich gerade in der Küche mit den anderen Mädchen frühstückte, stürmten die Bullen rein. Sie hatten bezahlte Spitzel als Zeugen dabei, die »Das ist sie! Das ist sie!« schrien und auf mich zeigten.
Also schleppten sie mich ins Gefängnis. Nicht für etwas, was ich getan hatte, sondern für etwas, was ich nicht getan hatte. Es waren wirklich kaputte Zeiten. Frauen wie meine Mutter, die als Dienstmädchen arbeiteten und Büros sauber machten, wurden auf dem Heimweg aufgegriffen und der Prostitution beschuldigt. Konnten sie die Kaution zahlen, waren sie wieder frei. Wenn nicht, kamen sie vor Gericht, wo ihr Wort gegen das eines dreckigen geschmierten Bullen stand.
Ich wurde verhaftet und vor das Jefferson-Gericht geschleppt. Das ganze Haus war voll »gefallener Mädchen«, wie man damals sagte. Außerdem natürlich noch die Bullen von der Sitte. Als ich sah, wer hinter dem Richtertisch saß, wusste ich, dass ich geliefert war. Es war Friedensrichterin Jean Hortense Norris, die erste Polizeirichterin in New York. Eine alte Dame mit harten Gesichtszügen und einer Männerfrisur.
Sie hatte sich einen Namen damit gemacht, herumzulaufen und Süßholz zu raspeln, dass nur eine Frau soziale Probleme wirklich verstehen kann. Von Mädchen, die mit ihr schon vor Gericht zu tun gehabt hatten, hatte ich jedoch gehört, dass ihr Gerede eine einzige große Scheiße war. Sie war härter als jeder Richter in Hosen, den ich davor oder seitdem je gesehen habe. Wenn eines der Mädchen einen Anwalt hatte, so setzte der alles in Bewegung, um seinen Fall vor einem anderen Richter verhandeln zu lassen.
So viel wusste ich: Würde ich mich schuldig bekennen, bekäme ich ganz schön was aufgebrummt. Würde ich mich jedoch nicht schuldig bekennen, sähe es vielleicht noch schlimmer aus. Davon abgesehen, dass es sowieso nicht viel genutzt hätte, wusste ich auch niemanden, der mir einen Anwalt hätte besorgen können. Hätte diese Richterin auch nur einen Moment geglaubt, dass sie ein Mädchen vor sich hat, das erst fünfzehn ist, sie hätte mich bis zu meinem einundzwanzigsten Lebensjahr in die Bedford-Besserungsanstalt verfrachtet.
Zum Glück kam meine Mutter zur Verhandlung und verhinderte das. Sie schwor auf einen Stapel Bibeln, dass ich achtzehn wäre. Hätten sie meine Mutter überprüft, wären sie darauf gekommen, dass sie mich folglich mit neun Jahren zur Welt gebracht haben müsste. Doch sie überprüften sie nicht. Es war schwer für meine Mutter, dermaßen zu lügen. Sie hasste jede Art von Unwahrheit und erzog mich entsprechend. Sie log niemals, außer wenn es darum ging, ein Leben zu retten. Und so hielt ich es auch.
Als mein Fall drankam, las die Richterin einen Gesundheitsbericht vor, der besagte, dass ich krank sei. Das war nun wirklich komisch, da man mich keineswegs untersucht hatte. Dazu war schließlich auch nicht genug Zeit gewesen. Außerdem war ich sauber. Ich wusste, dass ich nichts hatte, und die späteren Untersuchungen bewiesen das auch.
Aber diese alte Jungfer von Richterin glaubte mir nicht. Sie las aus ihren Unterlagen vor, wie jung ich war und wie krank und sagte schließlich, dass sie Milde walten lassen wolle und schickte mich nach Brooklyn ins Stadtkrankenhaus. So schnell wie sie mich reingeschafft hatten, schafften sie mich auch wieder raus, und das war’s dann.
Im Krankenhaus bekam jeder Salvasanspritzen gegen Syphilis. Ich bekam jedoch keine Spritzen, sondern verteilte welche. Ich arbeitete zusammen mit den Ärzten und sah Mädchen, deren Arme mit Entzündungen überdeckt waren, weil jemand die Vene nicht getroffen und stattdessen in einen Muskel gespritzt hatte. Später wurde ich zu einer Stelle versetzt, wo ich ganz allein Wismuth-Spritzen in Hinterteile gab. Ich lernte, geschickt mit den Spritzen umzugehen, und alle Mädchen wollten sich nur noch von mir behandeln lassen, weil langsam bekannt wurde, dass ich nie jemandem wehtat.
Am liebsten hätte ich meine ganze Strafe in diesem Krankenhaus abgearbeitet, aber das Unglück verfolgte mich. Eines Nachts stellte mir ein fettes schwules Mannweib nach. Heute nennt man sie Lesben, aber wir nannten sie damals schwule Weiber. Als sie versuchte an mich ranzukommen, gab ich ihr einen Stoß, dass sie die Treppen runterfiel.
Also wurde ich schon nach zwei Wochen aus dem Krankenhaus geworfen und fand mich vorm guten alten Jefferson-Gericht wieder. Dasselbe Gericht, dieselbe Richterin, nur war sie diesmal fuchsteufelswild. »Ich dachte, du würdest die Chance nutzen, die ich dir gegeben habe«, brüllte sie mich an. »Aber wie sich rausstellt, bist du schon verdorben.« Zack und Peng, vier Monate und ab ins Fürsorgeheim.
Das Heim war total verdreckt. Fünfzig Mädchen, von denen einige Tuberkulose hatten, waren in einer Abteilung zusammengepfercht. Zu essen bekamen wir Abfall, den man nicht mal seinem Hund vorsetzen würde. Ab und zu mussten wir die Zelle sauber machen, was bedeutete, dass eine Herde von Aufsehern durchmarschierte und alles inspizierte. Kaum waren sie jedoch weg, kamen die Ratten wieder aus ihren Löchern, und im Handumdrehen war alles wieder in seinem schmierigen, dreckigen Normalzustand.
Die Ratten, die es dort gab, waren größer als alles, was ich je in Baltimore gesehen hatte. Außerdem benahmen sie sich wie abgerichtet. Sie krochen um dich herum, ohne dich zu belästigen, es sei denn, sie hatten Hunger. Doch selbst dann ließen sie die Mädchen in der Zelle in Ruhe und kamen nur wie Schoßtiere in die Küche, um dort etwas einzuheimsen.
Als ich eine Zeit lang in der Küche arbeitete, erschien regelmäßig eine alte Ratte. Sie war so kaputt, dass sie schon fast kein Fell mehr hatte.
Jede Nacht lag ich wach und hörte, wie die Vergnügungsdampfer auf dem East River vorbeifuhren. Ich dachte darüber nach, ob ich hier je wieder rauskommen würde, und zählte, wie alle anderen auch, die Tage. Man hatte mir fünfzehn Tage Strafnachlass wegen guter Führung versprochen, das bedeutete, ich musste nur bis Hundertfünf zählen.
Eines Tages, als ich bis auf siebzig Tage runter war, passierte etwas, das mich wieder auf fünfundachtzig Tage zurückwarf. Auch hier gab es eine Menge Lesben, und eine von ihnen verfolgte mich. An diesem Tag wurde sie so zudringlich, dass ich ihr einen Fausthieb verpasste. Diese kleine Rauferei kostete mich meine fünfzehn Tage wegen guter Führung, außerdem warf man mich in den Bunker.
Das war wirklich das Ende, eine Zelle so klein, dass man noch nicht mal einen Schritt machen konnte. Man hatte eine Pritsche und gerade genug Platz, um zu stehen oder sich hinzusetzen. Es gab keine Lampe, und der Raum war so dunkel, dass man das Gefühl für Tag und Nacht völlig verlor und schließlich aufgeben musste, die Stunden zu zählen. Nach einer Weile war einem das sowieso egal. Man bekam jeden Tag zwei Scheiben Brot mit Salpeter und etwas Wasser. Ich musste zehn Tage mit dieser Diät verbringen, aber ich habe ihnen den Kram trotzdem jedesmal ins Gesicht geschmissen.
Wenn man aus dem Bunker rauskam, wurde man zur weiteren Strafe in die Wäscheabteilung versetzt. Die Mädchen, die dort wuschen, versuchten mich aufzumuntern, indem sie mir zuriefen: »Halt durch! Schmeiß dein Essen nicht weg, sonst kommst du niemals lebend wieder raus.«
Ich konnte ihre Stimmen hören, aber ich sah niemanden außer der Aufseherin.
Eine Lesbe hatte mich da reingebracht, eine andere sollte mich dort wieder rausbringen. Diese Aufseherin war eine Frau, die Mädchen mochte. Ich hatte irgendwas zu ihr gesagt, als sie das erste Mal reinkam, und jetzt fand sie mich süß. Sie steckte mir ein paar Zigaretten zu, als ich sie unbedingt brauchte, und ich flirtete ein bisschen mit ihr.
Ich wusste, dass sie darauf spekulierte, an mich ranzukommen, sobald ich wieder draußen sein würde, und ich wusste auch, dass sie von mir erwartete, nett zu ihr zu sein. Also sagte ich nichts Gegenteiliges. Sie hatte ihre eigenen Gründe, nett zu mir zu sein, und irgendwelche komischen Gefühle sind immerhin besser als gar keine Gefühle. Wäre diese Richterin nur eine Lesbe gewesen, dann hätte sie mich vielleicht wie ein menschliches Wesen behandelt und nicht wie einen Fall. Ich weiß nicht, ob ich es durchgehalten hätte, wenn diese nette lesbische Aufseherin nicht gewesen wäre.
Schließlich ließ man mich raus, und ich kam in die Wäscherei. Die letzte Arbeit, die ich in diesem Heim tun musste, war ein wirklicher Aufstieg: Ich kochte für den Direktor und seine Familie. Ich machte ihnen immer ausgefallene Rezepte, die mir meine Mutter beigebracht hatte. Alles Dinge, die sie immer für die reichen Leute gekocht hatte, wie Hähnchen Cacciatore mit Pilzen oder gegrillte Ente. Der Direktor war jedesmal sprachlos. Als meine Zeit vorbei war, bot er mir an, noch zu bleiben und für ihn als Köchin zu arbeiten. »Wenn Sie wollen, dass ich für Sie koche, dann können Sie zu mir kommen«, sagte ich ihm, »aber hier bleibe ich keine Minute länger.«
Meine Arbeit als Köchin für den Direktor hatte mich in dem Heim zu einem echten Star gemacht. Mit meiner Sonderstellung durfte ich neben dem Fenster in der Zelle schlafen und wurde auch rechtzeitig entlassen. Sie kamen in diesem Gefängnis einfach mit der Buchhaltung nicht zurecht. Mädchen, die zu drei Jahren verurteilt worden waren, mussten manchmal drei oder vier Wochen länger bleiben, nur weil ein Typ in der Buchhaltung die Sache verschlafen hatte. Dann, eines Tages, entdeckten sie das Mädchen, das schon längst entlassen sein sollte, und fragten sie, was sie denn noch hier mache. »Du solltest schon seit Wochen entlassen sein«, erzählten sie einem Mädchen. Aber mich entließen sie haargenau nach vier Monaten.
Ich war im Sommer ins Gefängnis gekommen, mit nicht mehr am Leib als meinem einzigen Seidenkleid und meinen hochhackigen Lackschuhen. Als sie mich im Winter entließen, bekam ich bei den Entlassungsformalitäten mein Kleid. Meine Schuhe konnte das Mädchen im Entlassungsbüro jedoch nirgends finden. Ich machte einen derartigen Aufstand, dass ich schon befürchtete, sie würden mich wieder einbuchten. Doch ich ließ mich nicht beruhigen, bis schließlich der Direktor selbst erschien. Als er hörte, um was es ging, sagte er, dass die Schuhe doch nicht einfach verschwunden sein könnten, und gab den Auftrag, sie zu finden, selbst wenn das ganze Heim durchsucht werden müsste. Die Frau an der Kleiderausgabe fand sie augenblicklich und gab sie mir, sie waren immer noch nagelneu und hatten genau ihre Größe.
Also bestieg ich die zugige Fähre, um im eisigen Wind, nur mit meinem Seidenkleid und den Stöckelschuhen bekleidet, den East River zu überqueren. Das Kleid hing an mir wie eine Gefängniskluft. Dreiundzwanzig Pfund hatte ich auf der Insel gelassen.
Als die Fähre anlegte, sah ich schon, dass die Hälfte aller Zuhälter von New York am Ufer Schlange stand, um uns zu begutachten. Das ist ihr Geschäft, und hier war der Ort, wo sie auf Talentsuche gingen, unterstützt von den Bullen, die es ihnen wahrlich einfach machten und sogar den Verkehr regelten. Ich muss ein trauriges Bild abgegeben haben, aber trotzdem fand sich ein Zuhälter, der mich ansprach und mich mitnehmen wollte. Er hatte sein Auto dabei und wollte mich von der Stelle weg in ein Bordell bringen.
Ich hatte zwar beschlossen, mit diesem Geschäft Schluss zu machen, sagte ihm aber nichts davon. Ich hatte eine Menge gelernt im Erziehungsheim. Ich brauchte neue Kleider, und ich brauchte sie so schnell wie möglich, besonders einen warmen Wintermantel,. Er konnte mir diese Kleider besorgen, und er besorgte sie mir auch.
Ich ließ mich von ihm zu einem Bordell bringen und mir eine Stelle zuweisen, aber ich gab ihm nichts von dem Geld, das ich verdiente, sondern schickte alles meiner Mutter. Als er das rauskriegte, drehte er durch. Er schlug mich grün und blau, und ich musste mich eine Weile verstecken.
Also fuhr ich nach Jamaica auf Long Island. Dort traf ich Dorothy Glass. Sie hatte ein großes Haus, in dem sie Poker und andere Glücksspiele veranstaltete. Sie war eine wirklich anständige Frau, diese Art von Frau, für die meine Mutter Florence Williams gehalten hatte. Ich blieb bei ihr, bediente und half aus, um mich über Wasser zu halten, solange ich aus dem Geschäft raus war. Ab und zu ging ich in den Elks Club in Jamaica, um zu singen. Auf diese Art und Weise konnte ich noch ein bisschen Kleingeld zusätzlich verdienen. Meine härteste Arbeit bei Dorothy war jedoch, mir ihren Mann Lee vom Leib zu halten. Diesmal sah ich schon im Voraus, was für ein Ärger auf mich zukam und ging deshalb rechtzeitig weg.
Ich habe später vielen Leuten von meinen schrecklichen Erlebnissen mit der Richterin Jean Hortense Norris erzählt, aber keiner wollte es mir so recht glauben. Ich glaube, man muss das alles selbst erlebt haben, bevor man es glauben kann.
Monate später sprach jeder über diese Richterin. Es war im Jahr 1930/31, als die Seabury-Untersuchung Schlagzeilen machte. Richter Seabury selbst brachte sie vor das Berufungsgericht, wo sie mit einstimmiger Mehrheit ihres Amtes enthoben und für »unfähig« erklärt wurde, den Richterberuf auszuüben.
Das war die alte Dame, die mich als »gefallenes Mädchen« ins Gefängnis gebracht hatte. Das war dieser feine Mensch, der mich als »verdorben« bezeichnet hatte. Man hätte sie ins Gefängnis stecken sollen, aber das ist nie geschehen. In den Gefängnissen waren Hunderte von Mädchen, die sie verurteilt hatte, und viele von ihnen warteten auf sie. Wäre sie ins Gefängnis gekommen, hätte selbst ich wieder gern eine kurze Zeit dort abgerissen, nur um sie einmal in die Finger zu bekommen.