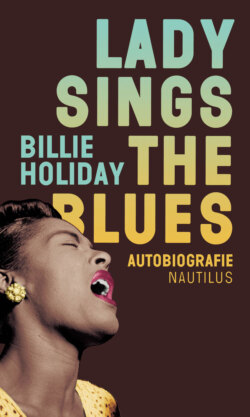Читать книгу Lady sings the Blues - Billie Holiday - Страница 7
3. Painting the Town Red
ОглавлениеAls meine Mutter und ich wieder zusammengekommen waren und wir in Harlem eine Wohnung für uns ganz allein gefunden hatten, begann die Zeit der Depression. Zumindest sagte man uns das. Depression war für uns nichts Neues. Das einzige Neue waren die Lebensmittelmarken, und das war auch das Einzige, was uns noch gefehlt hatte.
Wir zogen in eine Wohnung in der 139. Straße. Wenig später geschah es dann das erste Mal, soweit ich mich erinnern konnte, dass meine Mutter zu krank war, um am Sonntag in die Kirche zu gehen. Und wenn sie das nicht einmal mehr schaffte, musste sie schon sehr krank sein. Solange sie jeden Morgen ihren Kaffee und jeden Sonntag eine Messe bekam, glaubte sie, immer so weiterarbeiten zu können. Nun musste sie allerdings aufhören, als Hausmädchen zu arbeiten, da ihr Magen schon so kaputt war, dass sie nicht einmal mehr gehen konnte. Alles, was sie tun konnte, war ruhig im Bett zu bleiben.
Das bisschen Geld, das wir gespart hatten, näherte sich schon bald seinem Ende, und sie geriet in Panik. Sie hatte fast ihr ganzes Leben gearbeitet, und das begann man ihr auch anzusehen. Außerdem waren da noch die ständigen Sorgen um meinen Vater gewesen, die ihr das Leben auch nicht erleichtert hatten. Zum einen hatte ich beschlossen, mit meiner Arbeit als Callgirl endlich Schluss zu machen, zum anderen wollte ich aber auch nicht wieder als irgendjemandes verdammtes Mädchen arbeiten, und da wir anscheinend andauernd Miete zahlen mussten, kostete es mich schon eine ganz schöne Anstrengung, meine Vorsätze nicht über Bord zu werfen.
Ungefähr zu dieser Zeit trat Fletcher Hendersons Band unten in der Stadt im Roseland Ballroom auf. Es war die erste Negro Band, die dort arbeitete, und mein Vater war als Gitarrist mit dabei. So krank wie meine Mutter auch war, immer noch war sie zu stolz, um sich an meinen Vater zu wenden und ihn um Hilfe wegen der Miete zu bitten. Sie mag zu stolz gewesen sein, ich war es nicht.
Ich ging einfach hin und stellte ihm nach. Mein Vater war damals Anfang dreißig, wollte aber, dass niemand etwas davon erfuhr, besonders nicht die jungen Dinger, die immer am Bühnenausgang rumhingen und auf die Musiker warteten. Ich war damals um die fünfzehn, sah aber aus wie wahlberechtigt. Ich wartete also im Gang auf ihn und versuchte seine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, indem ich »Hey, Paps« rief. Sofort merkte ich, dass ihn allein die Tatsache, dass ich ihm so zuwinkte, auf fünfundvierzig altern ließ, und das mochte er nun überhaupt nicht. Also stürzte er auf mich zu und flehte mich an. »Du kannst machen was du willst, aber nenn mich bitte nicht Paps vor all den Leuten.«
»Ich werde dich so lange Paps nennen, bis du mir etwas Geld für die Miete gibst«, antwortete ich, und das überzeugte ihn.
Stolz wie ein Pfau brachte ich das Geld nach Hause. Um meine Mutter nicht zu verletzen, erzählte ich ihr nicht, wo ich das Geld her hatte, und sagte schließlich, als sie keine Ruhe geben wollte, dass ich es gestohlen hätte. Wir stritten uns daraufhin, und sie sagte mir, dass ich doch noch eines Tages im Gefängnis landen würde.
Eines Tages, als die Miete wieder mal überfällig war, bekam sie die Nachricht, dass man uns auf die Straße setzen würde. Es war mitten im tiefsten Winter, und sie konnte noch nicht einmal gehen.
Ich wusste nicht, dass man im Norden so mit den Menschen umging. So schlimm es auch im Süden war, auf die Straße wurde man nie gesetzt. Als es also soweit war, dass wir die Wohnung am nächsten Morgen zu räumen hatten, sagte ich zu meiner Mutter, dass ich alles tun würde, egal ob morden oder stehlen, um das, was sie mit uns vorhatten, zu verhindern. Es war eine höllisch kalte Nacht, als ich das Haus ohne Mantel verließ.
Ich ging die Seventh Avenue von der 139. bis zur 133. Straße runter und fragte in jedem Lokal nach Arbeit. Damals war die 133. Straße die Straße der Jazzlokale und des Jazz überhaupt, so wie es später die 52. Straße zu sein versuchte. Überall war etwas los in den Restaurants und den Cafés, den normalen oder denen, die die ganze Nacht aufhatten. Und fast jeder Block hatte fast ein Dutzend davon.
Als ich schließlich bei Pod’s and Jerry’s landete, war ich verzweifelt. Ich ging rein und verlangte den Chef – ich glaube, ich habe mit Jerry gesprochen. Ich sagte ihm, dass ich Tänzerin wäre, und es hier mal versuchen wollte. Ich kannte damals genau zwei Schritte: Den normalen und den Wechselschritt. Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas wie Vortanzen überhaupt gab, doch genau das wollte ich.
Jerry schickte mich also rüber zu dem Pianisten und ließ mich etwas vortanzen. Es war eine peinliche Angelegenheit. Ich machte immer und immer wieder meine zwei Schritte, bis Jerry mich schließlich anbrüllte und sagte, ich solle aufhören seine Zeit zu vergeuden.
Sie waren drauf und dran mich rauszuschmeißen, aber ich bettelte immer weiter um einen Job. Schließlich bekam der Pianist Mitleid mit mir. Er drückte seine Zigarette aus, sah mich an und sagte: »Hör mal, Mädchen, kannst du nicht vielleicht singen?«
»Natürlich kann ich singen«, antwortete ich, »aber für was soll das schon gut sein?« Ich hatte mein ganzes Leben lang gesungen und immer so einen Spaß dabei gehabt, dass ich nie auf den Gedanken gekommen war, damit Geld zu verdienen. Außerdem war damals gerade die große Zeit vom Cotton Club und all den Glamourmiezen, die nichts weiter taten, als schön auszusehen, ein bisschen mit den Hüften zu wackeln und das Geld einzusammeln.
Ich dachte, dass man nur so zu Geld kommen könnte, und ich brauchte fünfundvierzig Dollar bis zum nächsten Morgen, damit sie meine Mutter nicht auf die Straße setzten. Von Sängern hatte man damals noch nichts gehört, außer vielleicht von Paul Robeson, Julian Bledsoe oder jemandem mit ähnlich legendärem Ruf.
Ich sagte dem Pianisten, er solle »Trav’lin’ All Alone« spielen. Ein Lied, das genau ausdrückte, wie ich mich in diesem Augenblick fühlte. Irgendwas von dem, was ich sang, musste auch auf das Publikum übergesprungen sein, denn die Kneipe wurde plötzlich mucksmäuschenstill. Hätte jemand auch nur eine Nadel fallen lassen, es hätte sich wie eine Bombe angehört. Als ich zu Ende gesungen hatte, heulte jeder im Lokal in sein Bier, und ich sammelte achtunddreißig Dollar vom Boden auf. Als ich in dieser Nacht das Lokal verließ, teilte ich die Einnahmen mit dem Pianisten und nahm immer noch siebenundfünfzig Dollar mit nach Hause.
Ich kaufte ein ganzes Hähnchen und Baked Beans, die meine Mutter so mochte. Dann raste ich die Seventh Avenue hoch zu unserer Wohnung. Als ich meiner Mutter das Geld für die Miete zeigte und sagte, dass ich eine richtige Arbeit als Sängerin für achtzehn Dollar die Woche gefunden hatte, konnte sie es kaum glauben.
Sobald sie aus dem Bett konnte, kam sie selbst in die Kneipe, um mich zu hören, und wurde mein größter Fan. Damals waren immer ungefähr fünf bis sechs Sängerinnen in einem Club angestellt und jede hatte ihre »Runde«. Wenn ein Mädchen ihre »Runde« hatte, dann ging sie singend von Tisch zu Tisch. Danach hatte das nächste Mädchen seine »Runde« und löste sie ab. Ich hatte meine »Runde« jede Nacht von Mitternacht bis ungefähr gegen drei Uhr morgens, wenn die Trinkgelder immer weniger wurden.
Damals war es üblich, dass die Mädchen immer das Geld von den Tischen nahmen, ich machte allerdings damit Schluss. Von meinem ersten Gehalt kaufte ich mir ein paar verrückte Hosen, die mit bunten Glasperlen behängt waren. Meinen Körper wollte ich allerdings nicht rumzeigen. Nicht, dass irgendwas nicht mit ihm gestimmt hätte, aber der Gedanke behagte mir einfach nicht. Wenn ich dran war, die Scheine von den Tischen zu nehmen, machte ich allerdings immer alles verkehrt.
Eines Nachts zum Beispiel kam ein Millionär in unser Lokal und legte einen Zwanzig-Dollar-Schein auf den Tisch.
Ich wollte das Geld so gern haben und versuchte, es auch wirklich ganz ordentlich einzustecken, doch immer wieder rutschte es mir aus den Händen. So oft, bis der Millionär verärgert war und sagte: »Du benimmst dich wirklich wie eine hergelaufene Rotzgöre. Mach bloß, dass du weiterkommst!«
Als meine »Runde« zu Ende war, bekam er wohl Mitleid mit mir, denn er bat mich noch einmal, zu ihm zu kommen und etwas mit ihm zu trinken. Als ich hinkam, drückte er mir die zwanzig Dollar in die Hand. Ich dachte mir, dass das eigentlich jeder so machen könnte, und so beschloss ich von diesem Zeitpunkt an, kein Geld mehr von den Tischen zu nehmen. Die anderen Mädchen zogen mich von da an jedesmal auf, wenn ich zur Arbeit kam. Sie nannten mich »Frau Gräfin« und sagten untereinander: »Schaut sie euch nur an, sie hält sich wohl für eine Lady.«
Ich hatte damals meinen Namen »Lady Day« noch nicht, aber es war in diesem Lokal, dass man anfing, mich so zu nennen.
Wenn meine Mutter in den Club kam, fing ich meine Runden immer an ihrem Tisch an. Nachdem ich dann fünf bis sechs Dollar an Trinkgeldern eingesammelt hatte, teilte ich mit dem Pianisten und gab den Rest meiner Mutter zur Aufbewahrung. Als ich das so den ersten Abend machte, entschloss sie sich, bei meiner Nummer als Anheizerin mitzumachen. Als ich also die nächste Runde anfing, spielte sie die reiche Dame und gab mir ein großzügiges Trinkgeld, zwei oder drei Dollar von meinem eigenen Geld. Ich tat es zu meinen anderen Einnahmen, und als die Runde zu Ende war, teilte ich wieder mit dem Pianisten. Meine Mutter hatte mich so sehr damit verwirrt, die Baronin zu spielen und mir mein eigenes Geld zuzustecken, dass ich mit dem Pianisten einen fürchterlichen Streit bekam.
Als wir nämlich in dieser Nacht zusammenpackten, versuchte ich das Geld, das mir gehörte, zurückzubekommen. Ich hatte das Geld meiner Mutter gegeben, und sie hatte es mir zurückgegeben. Auf diese Art hatte ich drei oder vier Mal mit dem Pianisten geteilt. Ich versuchte, ihm das zu erklären und sagte, dass es meine Mutter gewesen war, und dass sie lediglich versucht hatte, uns zu helfen. Als er sich jedoch die junge Frau anschaute, die da am Tisch saß, rastete er völlig aus.
»Du verdammtes Flittchen«, sagte er, »nie im Leben ist das deine Mutter.« Es gab noch einiges Hin und Her, bevor ich ihn davon überzeugen konnte, dass meine Mutter wirklich meine Mutter war, und dass sie lediglich versucht hatte, uns zu helfen. Später besorgte ich für sie eine Arbeit in der Küche des Log Cabin, und wir schmissen den Laden.
Die Prohibition näherte sich damals ihrem Ende, und das bedeutete auch gleichzeitig das Ende für die ganzen illegalen Bars, Kneipen, Clubs und Nachtlokale, die erst durch die Prohibition entstanden waren. Einige Leute hatten wohl gedacht, dass es immer so weitergehen würde. Schaut man sich jedoch mal die Liste dieser einzigartigen Lokale an, denen es vor der Aufhebung der Prohibition im Jahr ’33 so gut ging, dann sieht man, dass die meisten davon heute nichts weiter als klangvolle Namen sind und der Vergangenheit angehören. Basement Brownies, Yea Man, Alhambra, Mexico, Next, Clam House, Shim Sham, Covan, Morocco, Spider Web und wie sie alle hießen.
Jede Nacht kamen die Limousinen angefahren, und die ganzen Nerze und Hermeline krochen übereinander, um sich als Erste ihren Weg durch die Kohlenkästen und Mülleimer zu dem Lokal zu bahnen, das gerade in war.
Für mich fing alles im Log Cabin an. Eine Reihe berühmter Leute verkehrte dort. So stellte mich eines Abends der Besitzer Paul Muni vor, der gerade an der Bar stand. Ein anderes Mal kam John Hammond herein, der damals gerade anfing, ein großes Tier im Musikgeschäft zu werden. Als er das nächste Mal kam, brachte er Mildred Bailey, Red Norvo und einen jungen, ernsten und gut aussehenden Kerl namens Benny Goodman mit. Mildred war damals als die berühmte Rocking Chair Lady bekannt, Red war ebenfalls ein berühmter Musiker und Mildreds Ehemann. Benny war Studiomusiker beim Radio und sprach immer davon, dass er eines Tages seine eigene Band haben würde. Sie kamen oft vorbei, aber eines Nachts haute Mildred Red Norvo eine runter und rauschte raus. Man erzählte mir, dass sie auf mich eifersüchtig wäre, dabei war mir noch nicht einmal aufgefallen, dass Red mich bemerkt hatte.
Zu dieser Zeit begleitete mich Bobby Henderson auf dem Klavier. Für mich ist er immer noch der Größte.
Ein anderes Mal brachte John Hammond Joe Glaser, den großen Agenten und Manager, mit. Er hatte zu dieser Zeit Louis Armstrong, Mildred Bailey und praktisch jeden, der dabei war, einen Namen zu bekommen, unter Vertrag.
Glaser engagierte mich auf der Stelle, und ich fing an, in Harlem von Club zu Club zu ziehen und überall, wo ich hinkam, passierte auch was. Von allen Stars, die kamen, um mich zu hören, mochte ich, glaube ich, Bernie Hanighen am meisten. Er war ein berühmter Liederkomponist, und ich liebte sowohl seine Lieder als auch ihn. Ich stellte dem Publikum seine beiden Songs »When a Woman Loves a Man« und »When the Moon Turns Green« vor. Bernie blieb immer stundenlang in den Clubs, hörte mir zu und gab mir immer großzügige Trinkgelder, wenn ich eins seiner Stücke sang. Dabei hätte ich für ihn immer umsonst gesungen, denn ich mochte ihn einfach.
Benny Goodman kam auch oft vorbei und bat mich schließlich, bei seiner ersten Plattenaufnahme mitzumachen. Ich werde diesen Moment niemals vergessen. Benny kam rein und nahm mich mit in die Stadt zum Studio. Als wir dort ankamen und ich eins von diesen riesigen alten Mikros sah, bekam ich plötzlich eine Heidenangst. Ich hatte noch nie mit so einem Ding gesungen und fürchtete mich einfach. Außer Buck, von dem berühmten Team Buck und Bubbles, der auch wegen der Aufnahme da war, ahnte niemand auch nur das Geringste von meiner Angst. Buck jedoch sah, was mit mir los war, und versuchte mir zu helfen.
»Zeig vor all diesen Weißen hier nur nicht deine Angst«, sagte er. »Die lachen dich sonst noch aus.« Schließlich brachte er mich dazu, dass ich mich in die Nähe des Mikros stellte, indem er mir sagte, dass ich es weder anschauen noch reinsingen müsste. Es würde völlig ausreichen, einfach danebenzustehen. Doch ohne Erfolg. Schließlich fing er an, mich zu beleidigen und sagte, dass mir einfach die Nerven fehlen würden, das Ganze hier über die Bühne zu kriegen.
Das gab den Ausschlag. Ich dachte einfach nicht weiter an das Ding, und wir nahmen zwei Nummern auf: »Your Mother’s Son-in-Law« und »Riffin’ the Scotch«. Ich bekam zwar fünfunddreißig Dollar für die Aufnahme, doch aus der Platte wurde nichts.
Später brachte mich John Hammond mit Teddy Wilson und seiner Band für eine andere Plattenaufnahme zusammen. Dieses Mal bekam ich dreißig Dollar für ein halbes Dutzend Aufnahmen, darunter »I Only Have Eyes for You«, »Miss Brown to You« und »I Cover the Waterfront«. Ich wusste damals noch nicht einmal, was Tantiemen waren, sondern war einfach froh, dreißig Dollar zu verdienen. Man führte mich lediglich als Sängerin in Teddy Wilsons Band auf, und damit hatte es sich. Als nach ungefähr einem Jahr die Platte anfing, sich zu verkaufen, merkte ich, dass sie mindestens ebenso viel durch meinen mittlerweile bekannten Namen verkauften wie durch Teddys. Also versuchte ich nachträglich noch mehr Geld zu bekommen, was mir jedoch nicht gelang.
Da kam mir Bernie Hanighen wirklich zu Hilfe. Er hatte damals den Posten eines Musikdirektors bei Columbia, die auf dem Vocalion Label Platten zu fünfunddreißig Cent herausbrachten. Bernie schnappte sich dort in den Büroräumen so ein Weibsbild und brachte sie schließlich dazu, mir für zwei Plattenseiten fünfundsiebzig Dollar zu bezahlen. Damals hieß es bei so etwas entweder zugreifen oder die ganze Sache vergessen. Es machte keinen Unterschied, ob die Plattenfirma später Tausende von Platten davon verkaufte, man sah von dem Gewinn keinen Cent. Dabei waren unter den Songs, für die ich die fünfundsiebzig Dollar bekam, auch Titel, die ich selbst geschrieben hatte. Auch dafür bekam ich keine Tantiemen.
Bernie verlor fast seinen Job bei Columbia, weil er sich so für mich eingesetzt hatte. Eine Menge Kerle geben einem in den Clubs große Trinkgelder, kommt es aber in den Studios zu Auseinandersetzungen, so sind sie mit einem Mal verschwunden. Das galt nicht für Bernie. Er war es, der mir zu meiner ersten Platte unter eigenem Namen verhalf. Ich war nicht mehr irgendjemandes verdammte Sängerin, sondern Billie Holiday, Absatz, und dann die Musiker, die mich begleiteten. Bernie Hanighen ist schon ein toller Kerl.
Nach dem Log Cabin kam ich auf das Programm des Hotcha Clubs. Meine Güte, was war das für ein Programm! Billy Daniels, Jimmie Daniels und ich mit Bobby Evans als Zeremonienmeister. Zwischen den Auftritten spielte Garland Wilson auf einer kleinen Empore im zweiten Stock Einlagen auf dem Klavier. Wollte man heute so eine Show zusammenkriegen, würde es einen wohl einige Tausender die Woche kosten. Damals wurde das Ganze mit einem billigen Essen organisiert. Und die Leute kamen nicht zuletzt auch wegen des Essens. Das Hähnchen à la Cacciatore war eine der Attraktionen. Während sie darauf warteten, bekamen sie mich serviert. Es sollte noch eine Weile dauern, bevor das Umgekehrte der Fall war.
Doch dann fingen die Leute an, wegen mir wiederzukommen. Franchot Tone und seine reizende Mutter zum Beispiel kamen zu jedem Club, in dem ich arbeitete, vom Pod’s and Jerry’s bis zum Dickie Well’s. Mrs Tone war ganz vernarrt in mich, und Billy Heywood und Cliff Allen, die eine große Nummer im Basement Brownies waren, mochte sie auch. Im Hotcha traf ich auch Ralph Cooper. Er war damals schon eine Berühmtheit, hatte in Filmen mitgespielt und sagte Frank Schiffman, der das Lafayette Theatre leitete, wer eingestellt werden sollte. Als Schiffman Cooper fragte, wie ich singen würde, fing Cooper an nach Worten zu suchen.
»Du hast noch nie jemand gehört, der so langsam, so lässig und mit so einem Ausdruck singt«, antwortete er. Richtig beschreiben konnte er mich jedoch auch nicht.
Und gerade das war das größte Kompliment, das man mir machen konnte. Bevor irgendjemand auch nur auf die Idee kam, mich mit anderen Sängerinnen zu vergleichen, verglich man andere Sängerinnen mit mir.
»Es ist nicht Blues in dem Sinne«, war alles, was Cooper sagen konnte. »Ich weiß nicht, was es ist, aber du musst sie dir anhören.«
Also kam Schiffman, und nachdem er mich gehört hatte, bot er mir an, mich für fünfzig Dollar die Woche auf das Programm des Apollo zu setzen, was zu dieser Zeit etwas bedeutete. In der Vorstadt war das Apollo das, was das Palace in der Innenstadt war.
Sieht man einmal von den Bessie-Smith- oder Louis-Armstrong-Platten ab, die ich in meiner Kindheit gehört hatte, so kenne ich weder heute noch damals irgendjemanden, der meinen Gesang wirklich beeinflusst hätte. Ich mochte immer Bessies große Stimme und das Feeling von Pop. Aber was kann ich den jungen Leuten sagen, die mich immer fragen, wo mein Stil herkäme und wie er sich entwickelt hätte? Wenn du ein Lied findest, das etwas mit dir zu tun hat, dann brauchst du nichts zu entwickeln. Du fühlst einfach etwas. Und wenn du es singst, dann können es die anderen auch fühlen. Bei mir hat das alles nichts mit Arbeit, Arrangement und Proben zu tun. Gib mir ein Lied, bei dem ich etwas fühlen kann, und das Singen wird nie Arbeit für mich sein. Es gibt auch Lieder, bei denen ich so viel fühle, dass ich sie nicht singen kann, aber das ist eine andere Geschichte.
Wenn ich »Doggie in the Window« singen müsste, so würde das Arbeit für mich bedeuten. Lieder jedoch wie »The Man I Love« oder »Porgy« zu singen, bedeutet für mich nicht mehr, als sich hinzusetzen und Peking-Ente zu essen, und ich liebe Peking-Ente. Ich habe diese Lieder schon selbst erlebt, und wenn ich sie singe, dann erlebe ich alles wieder und liebe das, was ich singe.
An dem Morgen, als ich im Apollo anfing, hatte ich die ganze Nacht davor im Hotcha gesungen. Ich ging also direkt vom Hotcha zum Theater. Die Show war für zehn Uhr festgesetzt, doch bevor ich drankam, war ich schon achtzehnmal auf die Toilette gerannt. Pigmeat Markham, der Komiker, war mit mir im selben Programm und bewahrte mich vor dem Schlimmsten. Als sie schon meine Anfangsmelodie spielten, schnappte ich ihn mir am Bühneneingang und sagte ihm, dass er rausgehen sollte und irgendetwas sagen, weil ich noch mal zur Toilette müsste.
»Du wirst nicht mehr auf die Toilette gehen«, sagte Pigmeat, »sondern hier raus auf die Bühne.« Und als er sah, was für eine Angst ich hatte, gab er mir einen Schubs, sodass ich die halbe Bühne überquerte. Irgendwie gelangte ich zum Mikro und schnappte es. Ich hatte ein billiges weißes Seidenkleid an und meine Knie zitterten so sehr, dass die Leute nicht wussten, ob ich nun singen oder tanzen würde. Selbst als ich meinen Mund aufmachte, wussten sie noch nicht Bescheid. Ein Mädchen in der ersten Reihe prustete heraus: »Schau nur, sie singt und tanzt gleichzeitig.«
Ich fing mit Bernie Hanighens Titel »If the Moon Turns Green« an. Als ich zu »The Man I Love« kam, war ich wieder voll da. Der Saal kam in Stimmung. Man kann wirklich kein Publikum auf der Welt mit dem im Apollo vergleichen. Die Leute waren schon früh am Morgen hellwach, und sie fragten mich nicht, was ich für einen Stil hatte, wer ich war, wie ich mich entwickelt hatte, wo ich herkam, wer mich beeinflusst hatte, oder irgendwas in der Art. Sie fingen einfach an, mitzugehen und hörten nicht wieder auf, selbst dann nicht, als ich schon die zweite Woche dort auftrat. Es war eins der wenigen Male, dass das im Apollo passierte, wenn ich das selbst so sagen darf, aber ich glaube, ich darf’s, verdammt noch mal.
Von allen Abenden in diesen Clubs in Harlem erinnere ich mich am besten an einen Abend im Hotcha. Ich ging gerade an der Bar entlang, als ich einen jungen attraktiven Typ sah, der dort saß und schlief. Während ich ihn noch betrachtete, sah ich, wie eine Nutte drauf und dran war, ihm seine Brieftasche aus der Gesäßtasche zu klauen. Ich sagte dem Engelchen, dass sie ihn gefälligst in Ruhe lassen solle.
»Hab dich mal nicht so«, sagte sie. »Wir können ja auch halbe-halbe machen.«
»Das werden wir nicht!«, gab ich zurück. »Das hier ist mein Typ, kapiert?« Natürlich war er nichts dergleichen, aber was wusste sie schon? Sie gab mir die Brieftasche, und ich gab sie ihm zurück. So lernte ich Louis McKay kennen. Einmal, als es ihm wirklich dreckig ging, nahm ich ihn mit nach Hause, und meine Mutter pflegte ihn, bis er wieder auf dem Damm war. Wir waren damals eine ganze Zeit lang zusammen.
Später, es lagen mittlerweile Jahre zwischen unserem letzten Treffen, sah ich ihn wieder. Er war seinen Weg gegangen und ich meinen. Als ich dem Mädchen damals sagte, dass das da mein Typ sei, dachte ich, ich würde lügen. Später stellte es sich heraus, dass ich die Wahrheit gesagt hatte, ohne es zu wissen.