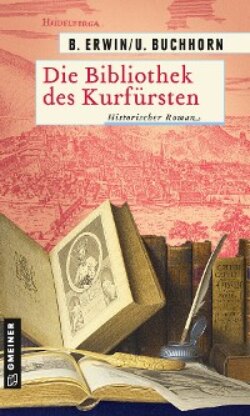Читать книгу Die Bibliothek des Kurfürsten - Birgit Erwin - Страница 10
III
ОглавлениеMatthias schnaufte kurzatmig durch den immer noch warmen Nachmittag. Die Uhr am Glockenturm der Heiliggeistkirche zeigte zehn nach vier. Er hob den Arm, um sich den Schweiß abzuwischen, besann sich aber im letzten Moment und tupfte die Stirn mit einem bestickten Leinentuch ab. Der rötlich-blonde Bart, der sein Gesicht umrahmte, sah stattlich aus, juckte allerdings elendiglich. Aus alter Gewohnheit strich er über seine Kleidung, um Mehlstaub abzustreifen, dann öffnete er das Portal und betrat das Innere des Gotteshauses. Im Hauptschiff knieten Gläubige und beteten stumm und in sich versunken. Matthias befürchtete, dass er zu spät gekommen war, doch da hörte er von der linken Empore Stimmen. Sie klangen zu laut und zu fordernd für diesen heiligen Ort, trotzdem war Matthias erleichtert. Möglichst leise, um die Betenden nicht zu stören, erklomm er die steinerne Wendeltreppe. Auf der Galerie hielt er inne und schaute beklommen die endlose Reihe der Schreibpulte entlang. Es kam ihm jedes Mal seltsam, fast falsch vor, dass unten ein Gotteshaus, so wie er es kannte, zum Beten einlud und oben eine Bibliothek beherbergt war, der man einen unschätzbaren Wert nachsagte. Matthias hielt nicht viel von Büchern. Dank dem großen Doktor Luther konnte er das Wort Gottes in seiner Muttersprache lesen, aber Bücher in dieser Menge erfüllten ihn mit Unbehagen. Nur das Licht, das schräg in die Galerie fiel, passte in sein Bild von Göttlichkeit.
Sein Name wurde gerufen, und Matthias beeilte sich, zu der Gruppe aufzuschließen. Er rief sich die Worte ins Gedächtnis, die er sich zu Hause zurechtgelegt und auf dem Weg wieder und wieder geprobt hatte. Trotzdem drohte ihm die Stimme wegzubleiben. Er wagte kaum zu hoffen, dass er seinem ehrgeizigen Ziel, in den Rat aufzusteigen, trotz Hirschs Niedertracht wirklich näherkommen sollte. Es musste einfach gelingen, allein Sophies wegen!
Er verbeugte sich respektvoll.
»Meister Abele, tretet näher. Wir haben bereits auf Euch gewartet.«
Matthias’ Herz setzte einen Schlag aus, denn er glaubte, einen Tadel aus den freundlichen Worten des Oberen Rates herauszuhören. »Verzeiht die Verspätung, Herr Harting, aber ich habe ein Geschäft zu führen.«
»Und dennoch bewerbt Ihr Euch um einen Platz im Rat«, warf Hirsch spitz ein. »Doch das ist heute nicht unser Thema.«
Matthias errötete, teils vor Verlegenheit, teils vor Zorn. »Ich …« Er erinnerte sich an Sophies Ermahnungen und biss sich auf die Lippe. »Wenn es nicht um meine Ernennung geht, warum bin ich dann hier?«
»Nicht so hitzig, junger Mann.« Harting trat einen Schritt näher. Sein Stock machte hallende Geräusche. »Wir hatten eigentlich gedacht, dass Ihr uns helfen könnt.«
»Natürlich«, stotterte Matthias. »Wenn ich kann.«
Philipp Roden, der zweite Vertreter des kurfürstlichen Rates, stellte sich neben seinen Amtsbruder. Er war ein gut aussehender Mann. Der blütenweiße Kragen war verschwenderisch mit Spitze verziert, sein blonder Bart nach der neuesten Mode gestutzt. Matthias hatte gehört, dass er große Auftritte liebte. Er ließ den Arm kreisen, um die ganze Empore mit einer Geste zu umfassen. »Was Ihr hier seht, Meister Abele, ist der Stolz der Pfalz. Die größten Gelehrten und Künstler haben an der Erschaffung dieser Sammlung mitgewirkt. Unsere gnädige Kurfürstin selbst, die Tochter eines Königs, hat nichts Vergleichbares auf ihrer Insel. Denkt Ihr nicht, dass es unsere Pflicht ist, diese Schätze vor den gierigen Händen der Katholikenbrut zu schützen?«
»Natürlich«, war alles, was Matthias hervorbrachte.
»Natürlich«, wiederholte Roden zufrieden. »Und dabei sollt Ihr uns helfen.«
»Ich?«
»Es ist unsere Aufgabe, diese Stadt zu verteidigen. Und diese Verteidigung verschlingt viel Geld. Unsummen.« Roden gestikulierte heftig. Wie gebannt betrachtete Matthias das Blitzen des schweren Ringes, den er über dem Handschuh am Ringfinger trug. »Ein ehrenwerter Bürger, der von sich sagt, dass er der Stadt dienen möchte, könnte mit einem Darlehen einen wichtigen Beitrag leisten. Selbstverständlich würden wir so einen Dienst nicht vergessen. Es könnte sogar bis zu den Ohren des Kurfürsten dringen, wenn Ihr versteht, Meister Abele.«
Matthias schluckte. Er sah Hirsch an, der missmutig auf seine Stiefel blickte. »Ihr meint …«
»Denkt einfach über unsere Bitte nach«, warf Harting ein. Nach Rodens glitzerndem Auftritt wirkte er streng und zurückhaltend. Umso mehr überraschte Matthias die nächste Frage. »Wie geht es eigentlich Eurer Frau?«
»Sophie? Sie …« Matthias zögerte, und plötzlich kam ihm das ernste Gesicht mit den scharfen Falten, die von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln verliefen, gütig vor. »Sie trauert«, entgegnete er schlicht. »Der Tod unseres Kindes geht ihr sehr nahe.«
»Gottes Wege sind unerforschlich, aber oft nicht leicht zu tragen«, sagte der alte Mann leise. »Ich kannte ihren Vater gut. Bitte richtet ihr meine Grüße aus.«
Matthias verneigte sich. Harting hatte sich bereits abgewandt, als er noch einmal Matthias’ Aufmerksamkeit auf sich zog. »Ein Gedanke: Wenn es meinen verehrten Kollegen nicht gelingt, diesen Streichling oder einen adäquaten Ersatz zu finden, warum fragt Ihr nicht Eure Frau. Ich weiß, dass sie ihrem Vater die Bücher geführt hat. Sie hat eine schöne Schrift und für eine Frau eine bemerkenswerte Disziplin. Meint Ihr, sie wäre bereit, uns zu helfen?«
Matthias runzelte die Stirn. Er war nicht der Einzige, Roden starrte seinen Amtskollegen offen an, Hirsch und die beiden anderen Herren scharrten unruhig mit den Füßen, doch Harting blieb unbeeindruckt. »Lasst Euch nicht aufhalten, Meister Abele. Wie Ihr sagtet, Euer Geschäft braucht Euch. Und uns ist daran gelegen, dass es floriert. Ich wünsche Euch einen guten Tag.«
Matthias verbeugte sich zum dritten Mal. Blind für seine Mitmenschen und seine Umgebung verließ er die Empore, bis er endlich im Sonnenschein stand und freier atmete.
Jakob löste sich aus dem Schatten einer Säule. Er musste nur die Hand ausstrecken, um Matthias zu berühren. Beinahe hätte er es getan, doch im letzten Moment schreckte er zurück. Ihm war bewusst, dass sich ein Wiedersehen mit seinem alten Freund nicht ewig würde hinauszögern lassen, aber noch fühlte er sich nicht bereit dazu.
Matthias ein Stadtrat! Jakob lächelte und zuckte zusammen, als der Schorf an seiner Lippe spannte. Er fragte sich, was Maxilius damit bezweckt hatte, ihn ohne Bewachung in der Garnison zurückzulassen. Er musste gewusst haben, dass er einen Weg finden würde zu entwischen – und dass er ihn nutzen würde. Vielleicht lauerte Karius ihm bereits auf, um zu Ende zu bringen, was dieser Jiří verhindert hatte. Oder der Stadtkommandant wollte, dass er seinen Schatten abschüttelte. Jakob schob die fruchtlosen Gedanken von sich und legte den Kopf in den Nacken. Die Heiliggeistkirche mochte inzwischen ein ketzerisches Bauwerk sein, dennoch war sie wunderschön. Eine Weile verlor er sich in dem prachtvollen Anblick, ehe er den Weg einschlug, auf dem Matthias ihm eben entgegengekommen war. Er setzte den Fuß auf die unterste Treppenstufe, als er Männerstimmen hörte. Jakob wich erneut zurück. Es waren die Heidelberger Räte, und er legte nicht den geringsten Wert darauf, von ihnen gesehen zu werden. Selbst wenn sie sich nicht an seine Züge erinnerten, seine Blessuren waren wahrhaft einmalig. Mit gesenktem Kopf belauschte er das hitzig geführte Gespräch.
»Ihr denkt doch nicht wirklich daran, einer Frau diese wichtige Aufgabe anzuvertrauen? Was versteht ein Weib von der Arbeit eines Schreibers? Darüber hinaus geht es um Staatsgeschäfte. Und überhaupt, irgendein Schreiber nützt uns nichts!«
»Das ist mir bewusst, werter Philipp.«
»Dann verstehe ich nicht, wie Ihr dieses Weibsbild …«
»Ihr werdet von Sophie Hagen mit mehr Respekt reden, Hirsch! Egal, welchen Ärger Ihr mit ihrem Mann haben mögt …«
Die Worte verklangen. Jakob widerstand der Versuchung, den Räten zu folgen. Langsamer erklomm er die ausladende Wendeltreppe und angesichts der Bücher verblasste Sophies Bild vor seinem inneren Auge. Wie im Traum nahm er die schiere Menge kostbarer Manuskripte in sich auf. Es mussten Tausende sein, eine Welt an Wissen und Kunst, die sich vor seinen Augen eröffnete. Wahllos blieb er vor einem der Regale stehen und las andächtig die Titel auf den Buchrücken. Er streckte den Finger aus und berührte Leder und Gold.
»Kann ich Euch helfen?«
Schuldbewusst ließ Jakob die Hand sinken und drehte sich um.
Der Mann ihm gegenüber schrak zurück. Er trug eine schwarze Robe mit weißer Halskrause, darüber schwebte ein knochiges Gesicht mit schmalen Augen. »Was wollt Ihr?«, fragte er eine Spur schärfer.
Jakob hob den Blick über den Kopf des Mannes und sah sich um. »Diese Bibliothek ist unbeschreiblich.«
»Das ist sie, aber Ihr seht nicht aus wie ein Mann, der die Bücher liebt.«
Verlegen zog Jakob die Hutkrempe tiefer. »Auch ein Bücherliebhaber kann in Situationen geraten, in denen Worte nicht helfen«, verteidigte er sich. »Ihr seid der Bibliothekar? Ich beneide Euch!«
Ein widerwilliges Lächeln kräuselte die Lippen des Mannes. »Aemilius Schostacius. Oder einfach Emil Schostak. Mit wem habe ich das Vergnügen?«
Jakob rang mit sich. »Jakob Liebig«, stellte er sich schließlich vor. Aufmerksam beobachtete er die Reaktion seines Gegenübers.
Der Bibliothekar legte den Finger an die Nase. »Liebig. Mir ist, als sollte ich den Namen kennen. Liebig …«
Jakob seufzte und starrte auf einen Lichtstreifen, in dem feine Staubpartikel tanzten. »Ich bin der Katholik.«
»Der Katholik, aha.« Schostak schmunzelte. »Ich weiß ja nicht viel von der Welt, aber ich dachte immer, es gäbe mehr als einen Katholiken auf Gottes schöner Erde. Nun, da habe ich mich wohl getäuscht.«
Jakob fühlte, wie ihm die Hitze in die Wangen stieg. »Ich …«
Schostak wedelte mit einer knochigen Hand. »Es wird mir schon einfallen. Und wenn nicht, dann ist es nicht wichtig. Ihr seid also ein katholischer Bücherfreund. Ich bin der Bibliothekar. Gott zum Gruß.«
»Darf ich mir ein Buch ausleihen?«, fragte Jakob und versuchte, sich seine Verwirrung nicht anmerken zu lassen.
Der Bibliothekar schüttelte entschieden den Kopf. »Nur ausgewählte Personen dürfen Bücher mitnehmen, alle anderen müssen hier lesen. Das sind die Regeln. Sie gelten für alle gleichermaßen. Studenten, Professoren, Katholiken. Und Räte.«
»Räte gehören also nicht zu den Auserwählten?«, meinte Jakob und nickte zu der Wendeltreppe hinüber.
Der Bibliothekar lächelte unergründlich, aber seine Augen blieben kalt. »In letzter Zeit erfreuen sich meine Schützlinge eines gesteigerten Interesses. Doch das bedeutet nicht, dass ich dieses Interesse gutheiße. Euch kann ich nicht einschätzen. Eines Eurer Augen ist das eines wahren Liebenden«, er ließ den langen Zeigefinger vor Jakobs rechtem Auge schweben, »das andere ist herzlos und gierig.« Der Finger kam Jakob so nahe, dass der gelbliche Nagel vor seinem Blick verschwamm.
Jakob wich zurück. »Fürchtet Ihr, all diese Werke könnten über Nacht abhandenkommen?«, scherzte er.
Der Bibliothekar tippte sich wieder an die Nase. »Wer weiß. Es gibt böse Mächte und böse Menschen. Im Übrigen liebe ich jeden meiner Schützlinge. Es ist egal, ob alle verschwinden oder nur einer.«
»Da habt Ihr sicher recht«, pflichtete Jakob bei. »Doch da ich nicht daran glaube, dass der Teufel sich für diese Bibliothek interessiert, bleiben die Menschen. Und nein, unbemerkt wird niemand diese Bücher stehlen können. Glaubt Ihr denn wirklich, die Bibliothek ist in Gefahr?«
»Und Ihr?«
Jakob zuckte mit den Schultern. »In Zeiten wie diesen wäre es vermessen, an Sicherheit zu glauben. Sogar hier in Heidelberg werden Menschen getötet. Wisst Ihr zufällig etwas darüber?«
Schostak schloss vorsichtig ein Buch, das aufgeschlagen auf einem der Pulte lag. Seine Handfläche ruhte sekundenlang auf dem prachtvollen Einband. »Mord interessiert mich herzlich wenig.«
»Dann sagt Euch der Name Kuno nichts?«
»Aber doch!«
Jakob blinzelte überrascht.
»Der Regensburger Bischof Kuno der II. lebte zu Zeiten Friedrich Barbarossas. Ob er allerdings ermordet wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls ist er tot.«
Jakob verwandelte sein Auflachen in ein angemesseneres Husten. »Ich danke Euch für diese Auskunft.«
»Es freut mich, wenn ich Euch weiterhelfen konnte«, entgegnete der Bibliothekar höflich. »Wenn Ihr mich nun entschuldigen wollt, ich habe zu tun. Bücher sind unschuldig, Menschen nicht.« Behutsam hob er das Manuskript von dem Pult und trug es davon.
Noch einmal blickte Jakob verlangend die Empore entlang, doch er wollte Maxilius nicht über Gebühr reizen. In die Garnison wagte er nicht zurückzukehren, aber wenn er zu Pfarrer Hermeskeil ging, konnte er vielleicht den schlimmsten Sturm abwenden.
Während Jakob die Hauptstraße entlangschlenderte, schwelgte er immer noch in der Pracht der Bibliothek. Der Gedanke, dass diesen Schätzen etwas geschehen könnte, war unerträglich. Am Mitteltor, das die Altstadt von der Vorstadt trennte, spürte er erstmals, dass er verfolgt wurde. Er drehte sich um, sicher, dass Karius’ höhnische Fratze hinter ihm auftauchen würde, doch es waren nur einige harmlos erscheinende Spaziergänger. Jakob ging schneller. Nie war ihm so bewusst gewesen, dass er als Katholik unter Protestanten nicht sicher war. Gerne hätte er sich eingeredet, dass es umgekehrt anders gewesen wäre, aber er hatte Beweis genug, dass dem nicht so war. Er schauderte und rettete sich in die Erinnerung an die Bücher.
Die tief stehende Abendsonne schien ihm direkt ins Gesicht, als er den Herrengarten erreichte. Zu Hermeskeils Haus war es nicht mehr weit. Er schirmte die Augen ab, um sich zu orientieren, als ein Stein an seinem Kopf vorbeiflog und auf dem Pflaster landete.
Eine Kinderstimme krakeelte: »Wir kriegen dich, Katholik. Renn! Sonst fressen dich die Würmer.«
Ein Teil von Jakob wollte nichts lieber als rennen, doch er blieb stehen und drehte sich um. Seinen Fehler erkannte er, als hinter der Horde zerlumpter Kinder zwei kräftige Männer mit Knüppeln auftauchten. Sie hatten die Hüte tief in die Gesichter gezogen.
Auf der anderen Straßenseite tuschelten gut gekleidete Passanten, aber niemand griff ein. Jakob bezweifelte zwar, dass sie sich an einer Straßenschlacht oder einem Mord beteiligen würden, trotzdem setzte er seinen Weg so schnell fort, wie er konnte, ohne würdelos zu erscheinen. Beleidigungen der Kinder verfolgten ihn. Die beiden Männer blieben stumm.
Hermeskeils Wirtschafterin öffnete auf sein heftiges Klopfen. Sie starrte Jakob giftig an, als der die Tür krachend hinter sich schloss und mit dem Rücken dagegen sank.
»Guten Abend«, brachte er hervor. »Ich danke Gott, wieder hier zu sein.«
Sie sah nicht aus, als teile sie seine Gefühle. »Folgt mir«, beschied sie ihn.
Jakob rechnete damit, in seine Kammer geführt und eventuell eingesperrt zu werden, doch die Frau brachte ihn in ein Zimmer im Erdgeschoss. »Herr Liebig ist hier, Herr Pfarrer.«
»Soll reinkommen!«
Jakob ahnte bei dem schroffen Befehl nichts Gutes. Er nahm den Hut ab und trat ein. Der Pfarrer musterte ihn frostig. Neben ihm saß der Major breitbeinig auf einem Polsterstuhl.
»Gott zum Gruß«, sagte Jakob ergeben.
»Ihr habt meine Gastfreundschaft missbraucht.« Der Pfarrer hielt sich nicht mit Höflichkeiten auf. »Meiner Haushälterin Angst einzujagen und Euch davonzustehlen, ist unter Eurer Würde!«
»So ist es.« Maxilius erhob sich von seinem Platz. »Davon, dass Ihr gegen meinen Befehl die Garnison verlassen habt, will ich nicht reden. Wo wart Ihr?«
»In der Heiliggeistkirche.«
Der Stadtkommandant stutzte. Er tauschte einen raschen Blick mit Hermeskeil. »Warum?«
»Wegen der Bücher.«
Maxilius knurrte. »Wie dem auch sei …«
»Herr Major, Ihr habt mich an dem Gespräch mit Lena und Anni nicht teilhaben lassen. Haben sie etwas gesagt? Ist der Tote dieser Kuno?«
Wieder schaute Maxilius zu Hermeskeil, und es kam Jakob so vor, als ob der Pfarrer seinen Kopf eine Winzigkeit senkte.
»Er steht in Verbindung mit den Spaniern. Aber das ist nicht mehr Eure Sorge.«
»Und warum nicht?« Jakob hätte sich gerne hingesetzt. Das Wohnzimmer war einladend und geschmackvoll möbliert. Ein freier Polsterstuhl lockte. Sein ganzer Körper schmerzte, sein Gesicht pochte.
»Weil ich jemanden wie Euch nicht brauche. Und weil der Tote mir noch gleichgültiger ist als Euer Schicksal.«
Jakob schoss durch den Kopf, dass auch er an einem Punkt anlangte, an dem ihm einiges gleichgültig war. »Liegt es daran, dass der Tote ein Fremder von außerhalb war? Dass er Kuno heißt, nicht … Wie sollte ein guter Toter für Euch denn heißen? Wie heißen Schreiber in Heidelberg?«
Maxilius zuckte zusammen. Er ballte die Hand zur Faust und stand ruckartig auf. »Packt Eure Sachen. Ihr werdet in ein anderes Quartier gebracht.«
»Ich werde mich um das Gepäck kümmern«, warf Hermeskeil ein. Das Eis in seinen Augen war geschmolzen, er lächelte leicht. »Gott sei mit Euch, Herr Liebig.«
Jakob nickte nur. »Ich kann Euch helfen«, wandte er sich an Maxilius. »Das wisst Ihr.«
»Was ich weiß, ist, dass ich Euch nicht trauen kann. Das habt Ihr mir bewiesen.«
»Und Ihr habt genau das provoziert«, warf Jakob ihm bitter vor. »Herr Pfarrer, ich danke für die Gastfreundschaft, aber ich bin wohl einfach kein guter Gefangener.«
Ehe Hermeskeil etwas erwidern konnte, hatte Maxilius die Tür aufgerissen. »Das kann man ändern.«
Mit jedem Schritt erschien Jakob die Zukunft düsterer. Abgesehen davon, dass ihm vor einer zweiten Nacht im Kerker graute – Schmutz, Kälte, Demütigung –, war Heidelberg offensichtlich ein Synonym für sein Versagen. Egal, wie lang Maxilius ihn schmoren ließ, am Ende würde er aus der Stadt gejagt werden. Mehr Demütigung. Jakob biss die Zähne zusammen. Jedes weitere Wort würde einem Betteln gleichkommen.
»Wir sind am Ziel«, erklärte Maxilius unvermittelt.
Jakob schaute sich um. Seine Gedanken überschlugen sich. »Aber … das ist nicht die Garnison.«
Der Stadtkommandant bedachte ihn mit einem abgrundtief ironischen Blick. »Sogar für einen Agenten seid Ihr mit einer bemerkenswerten Beobachtungsgabe gesegnet.« Er betätigte den Türklopfer. Eine Frau öffnete: Martha.
»Ich muss deine Herrschaft sprechen«, erklärte Maxilius, ohne auf die Verwirrung seines Begleiters zu achten.
Auf den ersten Blick war die Zeit an Martha einfach vorbeimarschiert. Sie trug dasselbe grobe Leinen, die ehrbare Haube über dem bärbeißigen Gesicht. Auf den zweiten erschien sie dünner, aber nicht weniger Furcht einflößend. Plötzlich war es Jakob unendlich wichtig, freundliche Aufnahme zu finden – oder wenigstens keinem Hass zu begegnen. Er zog den Hut und verbeugte sich elegant.
»Gott zum Gruße.«
»Der Herr Katholik«, war alles, was Martha sagte. »Herr Abele ist unterwegs, Herr Major. Frau Abele …« Ihre Blicke wanderten unschlüssig zwischen den beiden Männern auf ihrer Schwelle hin und her. Endlich trat sie beiseite. »Ich hole meine Herrin.«
Sie ging und Jakob ließ das Haus auf sich wirken. Er hatte nicht geahnt, dass die Einzelheiten sich so tief in sein Gedächtnis gegraben hatten. Nichts hatte sich verändert. Es war immer noch ein behagliches Bürgerhaus mit dieser seltsamen Mischung aus echtem Geschmack und Spießigkeit.
Sophie trat auf den Flur. Sie hielt die Hände gefaltet. Schwarz hatte sie schon damals getragen, aber keine Haube. Ihr Gesicht war schmal, ihre Augen tieftraurig. Alles hatte sich verändert.
Eine Weile blieb sie stumm wie eine Statue, dann öffnete sie den Mund. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch. »Warum, Fritz? Warum hast du ihn hergebracht? Ich will ihn nicht hier haben.«
Jakob fühlte sich, als habe sie ihn geschlagen, härter als Karius. Er streckte die Hand aus, ließ sie wieder sinken.
Maxilius beachtete ihn nicht. Ohne den Hut abzunehmen, schaute er auf Sophie herunter. »Ich habe ihn deinetwegen hergebracht, Schnecke«, sagte er barsch. »Damit du endlich mit diesem Unsinn aufhörst. Außerdem brauche ich jemanden, der ein Auge auf ihn hat. Also du und dein Mann oder der Kerker. Es ist deine Entscheidung.«
Zum ersten Mal sah sie in Jakobs Richtung, obwohl er immer noch das Gefühl hatte, dass sie an ihm vorbeischaute oder durch ihn hindurch. Ihre blassen Lippen bebten. Wo war das Funkeln geblieben?, fragte sich Jakob, wo der Glanz? Diese Frau war schön. Aber sie war nicht mehr reizend.
Er besann sich auf seine Erziehung. »Ich möchte niemandem zur Last fallen«, erklärte er steif.
Ein Zittern lief durch ihren Körper. »Nein, Herr Liebig.« Sie schien Mühe zu haben, seinen Namen auszusprechen. »Ihr könnt bleiben. Matthias würde nie zulassen, dass Ihr in den Kerker geworfen werdet. Martha wird Euch Euer altes Zimmer zurechtmachen. Ihr seid willkommen.«
Eine kältere Lüge hatte er nie gehört. Er sah zu Maxilius hinüber, aber der wich ihm beharrlich aus. Er wirkte wütend, doch Jakob hatte nicht den Eindruck, dass der unterdrückte Zorn ihm galt.
Martha bedeutete Jakob, ihr zu folgen. Die Treppe quietschte noch immer, das Wildschweingemälde war scheußlich wie eh und je.
»Verdammt, Martha, ist es, weil ich Katholik bin?«, brach es aus Jakob heraus, als sie außer Hörweite waren. »Das war ich vor drei Jahren auch, und da hat sie mich nicht behandelt wie eine Pestleiche.«
Die Haushälterin schwieg eine Weile. »Nein«, sagte sie halb zu sich selbst. »Das hat sie nicht, das dumme Mädchen.«
»Aber …«
»Bleibt in Eurem Zimmer. Ich werde Euch holen, wenn der Herr nach Hause kommt.« Sie musterte ihn streng. »Und in der Zwischenzeit hole ich Euch Wasser und eine Paste aus Beinwell. So könnt Ihr ja nicht unter Leute gehen.«
»Martha, bitte, was ist hier passiert?«
»Meine Herrin hat ein Kind verloren«, murmelte die Magd düster. »Stattdessen hat sie Gott gefunden.«
Grummelnd stapfte Jiří über die Baustelle. Das Geld, das er beim Würfelspiel gewonnen hatte, klimperte in seiner Manteltasche. Ein Bierkrug hatte großzügig die Runde gemacht, bis ein Soldat die kleine Gruppe auseinandergescheucht hatte. Eigentlich hätte es ihm gut gehen müssen. Er strauchelte über einen Sack.
»Heilige Muttergottes«, entfuhr es ihm. Während sein Puls sich beruhigte, stieß er das Bündel mit dem Fuß an. Es war und blieb ein Sack. Trotzdem schienen ihn die Augen des Toten aus dem Wald anzustarren, über Raum und Zeit hinweg.
Tote konnten das. Vor allem rachsüchtige Tote.
Jiří umschloss die Münzen, die keinen Trost spendeten. Er blickte nach Westen. Die Sonne sank. Das bedeutete, dass die Geister erwachen würden. Plötzlich hatten die Geschichten, die die alten Weiber am Ofen erzählt hatten, eine beunruhigende Macht.
Aber er war kein altes Weib, er war ein Mann. Wenn er nur sein Pferd gehabt hätte. Doch das riesige Streitross, das er eingefangen hatte, als er herren- und kopflos über das blutige Schlachtfeld geirrt war, stand in Reilings Stall und ließ sich verhätscheln. Die Mähre verfluchend, machte sich Jiří auf den Weg. Auf jeden Fall wollte er vor Sonnenuntergang an der Stelle sein, an der er die Leiche zu sehen geglaubt hatte. Vielleicht hatte er sich geirrt. Während er mit Lena und Anni durch den Wald gegangen war, hatte er keinen Gedanken an mörderische Tote verschwendet, aber Lena war nur ein Traum, ein sehnsüchtiger Gedanke und weit fort.
Ohne die Gesellschaft zweier hübscher Frauen zog sich der Weg im Zwielicht unbarmherzig. Jiří pfiff ein altes Soldatenlied, so musste er das Rascheln in den Zweigen nicht hören. Er versuchte, sich zu erinnern, wo genau sein Pferd gescheut hatte. Ein Baum sah aus wie der andere, knorrig, blattlos und fahl vor dem stahlblauen Himmel, der bald schwarz sein würde wie die Seele eines Toten. Er merkte, dass das Lied ganz von selbst erstorben war. Schweiß rann über seinen Rücken. Mit einem Anflug seiner alten Frechheit stellte er fest, dass feines Leinen ebenso unangenehm juckte wie das grobe Zeug, das er noch vor einem halben Jahr getragen hatte. Nicht, dass er sich beklagen würde.
Er ging langsam, weil es immer schwieriger wurde, Einzelheiten zu erkennen. Tote bewegten sich nicht. Das sagte der Pfarrer. Und vor allem sagte es seine Beobachtung. Tote bewegten sich nicht, sonst wären Schlachtfelder eine unruhige Angelegenheit.
Jiří bekreuzigte sich mehrfach in schneller Folge und versuchte, den Erinnerungen zu entkommen. Es waren zu viele Tote, doch an den meisten war er unschuldig.
Er merkte, dass er die Augen geschlossen hatte, und zwang sich, ins Unterholz zu spähen, den Blick fest auf den Boden gerichtet. Die anklagende weiße Hand musste irgendwo auf ihn zeigen.
»Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name …«
Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und hob einen langen Ast auf. Mit dem morschen Holz stocherte er bald hier, bald da am Wegrand.
Seine Hände zitterten.
»Ich widersage dem Teufel, seiner Macht und gelobe …«
Jiří ließ den Stock fallen und hielt den Atem an, als ein weißer Fleck aufblitzte. Er ging in die Hocke. Der bauschige Stoff seiner Hose war kein Schutz gegen den kalten Waldboden. Er streckte den bebenden Arm aus, aber es war keine Geisterhand, es war ein Blatt Papier, das jemand an einen Baumstamm genagelt hatte. Jiří riss den Zettel vom Stamm. Er hörte das Reißen des Papiers. Die untergehende Sonne spendete genug Licht, dass er die Schrift entziffern konnte. Es war ein Vers aus den Psalmen. Am liebsten hätte Jiří das Blatt von sich geschleudert, aber abergläubische Furcht hielt ihn zurück. Was, wenn jemand die Worte der Heiligen Schrift nutzte, um den Toten zu bannen? Mit klammen Fingern faltete er das Blatt und steckte es in seine Tasche.
Flüchtig kam ihm der Gedanke, dem Stadtkommandanten von seinem Fund zu berichten, aber er verwarf ihn trotzig. Die einzige Frage, die sich stellte, war die: Zurück in die Stadt oder zu Reilings Hof?
Das Bier lockte, aber der Weg war dunkel, er hatte kein Pferd, und Jiří musste sich eingestehen, dass allein ein Blick in den schwärzer werdenden Wald ihm Todesangst einjagte. Er kehrte um und lief zurück. Wenn er Glück hatte, würde er die Stadtmauer erreichen, ehe die Sonne vollends gesunken war.
Er hatte Glück. Unbehelligt passierte er das Speyerer Tor und schlenderte durch die Gassen. Der Nachtwächter sang in der Ferne sein Lied, warnte vor Feuer und Licht. Jiří seufzte. So behaglich und friedlich, wie diese Stadt war, würde sie dem Ansturm des Krieges wenig entgegenzusetzen haben. Der Stadtkommandant wusste das, der war ein harter Hund. Dass er trotzdem eine sentimentale Seite hatte, war umso verblüffender.
Jiří dachte an Lena.
Die Nacht verwandelte die Häuser in zerklüftete Landschaften. Licht flackerte vereinzelt hinter winzigen Scheiben, die Bäume des Herrengartens reckten knorrige Arme in den Himmel. Er war allein auf der Straße. Er war allein. Bis er die Schritte hörte. Sein Instinkt riet ihm, sich in die nächste Gasse zu schlagen, seine Neugier wollte wissen, wer da unterwegs war. Die Neugier siegte, wie meistens. Jiří ging geradeaus und sah eine Gruppe Menschen mit Fackeln und Windlichtern auf die Hauptstraße einbiegen. Er dachte an die eben verklungene Warnung des Nachtwächters und grinste. Der Trupp marschierte stumm die Straße vom Herrengarten hinauf. Er geriet ins Stocken, als eine einzelne Gestalt der Schar entgegentrat. In der sinkenden Dunkelheit war es unmöglich, die Züge des Mannes zu erkennen. Jiří sah nur den bulligen Umriss und den Federhut.
Eine helle Stimme rief: »Tod allen Katholischen!«
»Geht nach Hause!«, befahl der Mann.
Jiří horchte auf. Er glaubte, die tiefe Stimme zu kennen, war sich aber nicht sicher, woher.
»Tod allen Katholischen!«
Ein Stein krachte gegen eine Mauer.
»Das ist eure letzte Chance«, donnerte der Mann.
Schlagartig erkannte Jiří Leutnant Karius. Er schlich näher.
Die Aufrührer waren vielleicht zu sechst oder siebt. Einige davon waren der Größe nach Kinder. Plötzlich schwenkte einer der Jungen seine Fackel in Jiřís Richtung. »Da ist noch einer!«
Der unruhige Schein erfasste ihn. Jiří trat in die Mitte der Straße und hielt seine Handflächen nach außen. »Jungs, das ist nicht mein Streit«, sagte er gelassen, »aber ihr solltet nach Hause gehen. Ich kenne den Kerl.« Er zeigte auf Karius. »Mit dem ist nicht gut Kirschen essen.«
»Katholikenfreund!«
Jiří lachte spöttisch. »Katholikenfreund? Ich war beim Weißen Berg dabei. Ich …«
Ein weiterer Stein flog.
»Verdammte Saubande!«, entfuhr es Jiří. Er packte einen der Jungen an seinem dünnen Hemd. Der Stoff riss. Ein wuchtiger Schlag traf seinen Schädel, hart stürzte er auf das Pflaster. Er sah dünne Beine, rennende Füße, Schritte verklangen.
»Halt dich raus!«, grollte es über ihm.
Jiří drehte den Kopf in die Richtung seines Angreifers, aber die Übelkeit übermannte ihn. Er rollte sich herum und spuckte Blut. Nach einer Weile spürte er eine Hand an seiner Schulter.
»Habt Ihr den Kerl erkannt?«, fragte der Leutnant scharf.
Stöhnend bewegte Jiří seinen Kiefer, erst von oben nach unten, dann von rechts nach links. Erstaunlicherweise schien er nicht gebrochen. »Ein verdammter Riese«, ächzte er. Dann musste er grinsen. Das Gesicht über ihm sah schlimmer aus, als sein eigenes es je tun würde.
Karius schnitt eine Grimasse. Im selben Moment wurde eine Haustür geöffnet, eine Frauengestalt tauchte mit einer Lampe auf. »Was soll der Krach?«
Die Körpersprache des Leutnants veränderte sich subtil. »Unruhestifter. Sie sind fort.«
»Und wer ist das?«
Jiří blinzelte in das Licht, das direkt vor seine Nase gehalten wurde. Er versuchte ein Lächeln. »Jiří Němec, zu Euren Diensten.«
Die Frau, der Kleidung nach eine Bedienstete, schnaubte. »Schöne Dienste. Kannst du aufstehen?«
Jiří fand, dass das eine gute Frage war. Schwankend kam er auf die Füße. Das Licht der Lampe folgte seinen Bewegungen.
»Bist du verletzt?«
Jiří schaute zwischen der Frau und dem Leutnant hin und her. Blitzschnell entschied er, wer das Sagen hatte. »Ich wollte die Jungen vertreiben, meine Dame. Ich hoffe, sie haben Euch keine Angst gemacht.«
Die vierschrötige Frau schnaubte wieder, aber er sah Belustigung in ihren Augen. »Bist du verletzt?«, wiederholte sie eine Spur milder.
Jiří berührte seinen Kiefer. Das Zucken war nicht gespielt. »Einer hat mich niedergeschlagen.«
»Einer der Jungen?«, blaffte Karius. »Ich dachte, du bist der Held vom Weißen Berg.«
»Ein wenig älter wirkte er schon. Und größer.«
Die Dienerin war zu einer Entscheidung gekommen. »Dein Kiefer wird bald übel aussehen. Ich nehme an, Leute wie du sagen nicht Nein zu einem Becher Wein. Ihr auch, Herr Leutnant?«
Karius straffte sich. »Ich danke, aber mein Befehl lautet anders.«
Die Frau zuckte die Achseln. »Dann du. Deinen Heidennamen habe ich nicht verstanden.«
»Jiří Němec«, beeilte sich Jiří zu erwidern.
»Wie auch immer. Sei leise. Die Herrschaft soll nicht gestört werden.« Sie gab ihm einen Stoß.
Jiří unterdrückte ein Jaulen. Er folgte der kräftigen Frau. Einen letzten Blick auf den Leutnant, der einsam in der Finsternis zurückblieb, konnte er sich nicht versagen.
Auch im Hausflur herrschte Dunkelheit, nur das Windlicht tanzte. Von oben vernahm Jiří leise Schritte, aber er hatte keine Gelegenheit zu lauschen, denn die Dienerin bugsierte ihn mit einem Rippenstoß in die Küche.
»Setz dich.« Sie rumorte in der schwach erleuchteten Küche und stellte ihm schließlich einen Krug hin. »Trink.«
»Danke.« Jiří hob den Kopf und erstarrte.
In der Tür stand ein Engel. Blondes Haar fiel über schmale Schultern, riesige Augen musterten ihn mit einem Ausdruck allumfassenden Erbarmens. »Martha, wer ist dieser Mann?«
»Er war mit dem grässlichen Leutnant zusammen.«
»Mein Gott, siehst du denn nicht, dass er blutet?«
Jiří kam zu sich. Er trotzte seinem Kiefer ein Lächeln ab. »Verzeiht, Herrin, ich wollte nicht stören, ich …«
»Ihr«, fiel der Engel ihm energisch ins Wort und zeigte mit ausgestrecktem Finger auf seine Brust, »lasst Euch helfen. Alles andere hat Zeit, bis mein Gemahl zurückkehrt. Und Martha, denk daran, mir Ludwig noch vor dem Abendessen hochzuschicken.«
Sophie setzte sich ans Fenster und stützte das Kinn auf die Hand. Nach einer Weile lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück. Am liebsten hätte sie geschrien, getobt, sich aufgelehnt gegen Gott und das Schicksal, aber ihre Sündhaftigkeit hatte bereits ihre kleine Tochter, ihr Lieschen, das Leben gekostet, egal, was der Pfarrer sagen mochte. Sie wusste es. Sie fühlte es!
Als die Dielen in dem angrenzenden Zimmer knirschten, schlug sie beide Hände vor die Augen und schüttelte wild den Kopf, ehe sie sich zur Ruhe zwang. Der schmale Goldring an ihrem Finger schimmerte. Bald würde Matthias nach Hause kommen. Und bis dahin musste sie ihre Pflicht als Meisterin erfüllt haben. Sie griff nach dem Blatt Papier, das unter ihrer Bibel hervorlugte. Erneut kroch ihr Kälte über den Rücken. Natürlich wusste sie, dass es derartige Flugschriften gab, die in den Städten gegen Geld unter die Leute gebracht wurden, aber es war das erste Mal, dass sie eine davon in der Hand hielt. Wie unter Zwang betrachtete sie das Ungeheuer, das durch eine Blutlache stapfte. Darunter stand zu lesen, das sei der Katholik, dem das Blut der wahren Gläubigen an den Stiefeln klebe. Nichts anderes wolle der Katholik, als die Welt im Blut der Protestanten ersäufen, wie am Weißen Berg bereits geschehen. Angewidert drehte sie das Blatt um, legte es aber nicht weg. Die Schritte nebenan klangen wie die eines gefangenen Tieres. Ein Klopfen schreckte sie auf.
»Ludwig, bist du das? Tritt ein.«
Linkisch schob sich ein etwa sechzehnjähriger Junge herein. Sein Blick huschte durch das Zimmer, blieb kurz an dem Bild mit den beiden Rehkitzen hängen und kam schließlich auf der Hausherrin zur Ruhe. »Verzeiht, Frau Meisterin, ich bin zu spät. Es gab viel Arbeit.«
»Und ich höre, dass du sie nicht so schnell und pünktlich erledigst, wie du solltest«, bemerkte Sophie. Sie winkte dem Lehrling, näherzutreten.
Ludwig Mohr folgte der Aufforderung schüchtern. Seine Kleidung war mehlbestäubt und erinnerte sie an Matthias, ebenso wie sein ungebärdiges blondes Haar. Vielleicht, so dachte Sophie, hatte sie deswegen eine Schwäche für den unscheinbaren Jungen. Oder es war der träumerische Glanz in seinen Augen, der sie so gar nicht an ihren Mann erinnerte. Das Schweigen zog sich in die Länge, Ludwig scharrte verzweifelt mit den Füßen.
»Setz dich«, sagte sie.
Er betrachtete den zierlichen Stuhl beinahe mit Entsetzen, ehe er sich vorsichtig auf die Kante hockte. »Frau Meisterin«, begann er unglücklich, »ich weiß, dass ich in letzter Zeit einige Fehler gemacht habe. Da waren die Brote, die ich habe anbrennen …«
»Verbrennen«, berichtigte Sophie streng.
»… verbrennen lassen. Und der Zucker.«
»Und warum passiert dir das? Du bist seit vier Jahren bei meinem Mann in der Lehre. Du willst doch nicht ewig Lehrling bleiben.«
»Nein, Frau Meisterin. Ich gebe mir ja Mühe!«
»Und genau danach sieht es nicht aus. Du bist bleich wie der Tod, hast Ringe unter den Augen.«
Seine Hand fuhr über sein Gesicht, seine Finger hinterließen Mehlspuren auf den Wangen.
»Ja, Augenringe«, bekräftigte Sophie und unterdrückte heroisch ein Lächeln. »Ich weiß, was du treibst, Junge.«
Er wurde erst blass, dann feuerrot. »Frau Meisterin, ich …«
»Und solange du kein Auskommen hast, ist es Sünde, dich mit einem Mädchen herumzutreiben. Du weißt das, nicht wahr?«
Er nickte. Als er seine Finger ineinanderschlang, fiel ihr wieder auf, wie schön seine Hände waren.
»Da ist noch etwas«, sagte sie milder.
Er senkte ergeben den Kopf.
Sie tippte mit dem Finger auf die Flugschrift. »Ich habe gehört, dass dir das aus der Tasche gefallen ist. Ist das wahr?«
»Ja, Frau Meisterin«, murmelte er.
»Weißt du, was das ist?«
»Eine Flugschrift.«
»Schund ist das.« Er öffnete den Mund, aber Sophie hob gebieterisch die Hand. »Schund«, wiederholte sie. »Es gibt genug Hass auf der Welt, auch hier in Heidelberg, als dass die Menschen so etwas lesen müssen. Katholiken sind keine Ungeheuer, nicht alle jedenfalls, und es gibt Sünder auch unter Protestanten. Wie kommst du an solche Blätter?«
»Die lagen in Vaters Schenke. Ich habe eins eingesteckt.«
»Und warum?«
»Weil …« Er schwieg mutlos.
»Weil?«
»Denkt Ihr wirklich, dass das Schund ist, Frau Meisterin?«, fragte er in einem Tonfall, der sie aufhorchen ließ.
»Ja, das denke ich. Und du?«
»Ich kenne ja keine Katholiken, aber … bedrucktes Papier ist doch … schön.« Er starrte auf seine Hände. Seine Wangen waren hochrot.
Sophie musterte ihn erstaunt. Sie wollte etwas sagen, als Martha anklopfte und nach alter Gewohnheit sofort die Tür aufriss. »Der Herr wird sicher bald heimkommen.«
»Danke, Martha. Gut, Ludwig, dann geh und mach dich für das Abendessen fertig. Und was deine Arbeit angeht: Verrichte sie sorgfältig und pflichtbewusst. Ich möchte nicht hören, dass du dich in Schwierigkeiten bringst. Gibst du mir dein Wort darauf?«
»Ja, Frau Meisterin. Und danke.« Er klopfte verlegen auf das Sitzpolster, das weiße Flecken abbekommen hatte, und polterte hinaus.
Martha sah ihm kopfschüttelnd nach. »Aus dem wird nie ein guter Bäcker.«
»Martha, das ist nicht freundlich.«
»Aber die Wahrheit. Herrin, Euer Mann weiß noch nichts von …« Sie deutete mit ihrem schwieligen Daumen zur Wand.
Augenblicklich fühlte Sophie die Schwere wieder auf sich lasten, die während ihres Gespräches mit Ludwig von ihr abgefallen war. »Was hältst du hiervon?«, fragte sie und reichte ihrer Magd die Flugschrift.
Martha betrachtete sie flüchtig. »Ja, die verteilen sie seit ein paar Wochen in der ganzen Stadt. Wenn ich dieser Spanier wäre, würde mir das zu schaffen machen.«
»Katholiken sind keine Ungeheuer!«, erklärte Sophie heftig. »Oder ist es auch Sünde, das zu denken?«
Martha zerriss das Blatt. Als nur noch kleine Fetzen übrig waren, stopfte sie sie in ihre Rocktasche. »Sünde und schlechtes Gewissen sind zweierlei«, bemerkte sie. »Und vielleicht sollten wir Menschen uns nicht so wichtig nehmen und denken, dass der liebe Herrgott alles nur unseretwegen tut.«
»Aber die Sünde der Väter rächt sich an ihren Kindern, das steht in der Bibel!«, rief Sophie und ihre Stimme brach.
»Und manchmal bekommen Kinder einfach Fieber, Herrin«, sagte Martha barsch. »Ich muss mich um das Essen kümmern.«
»Gib den Lehrlingen jetzt ihr Abendbrot. Ich esse später mit Matthias.«
»Soll ich dann für zwei oder für drei decken?«
»Das lasse ich dich wissen!«, fauchte Sophie und wischte sich die Tränen ab.
»Also für drei«, entschied Martha ungerührt.
Im Garnisonshof drillte der junge Hauptmann Laurenz im letzten Abendlicht erbarmungslos einen Trupp frisch angeworbener Männer. Zum ersten Mal, seit Maxilius Sophie verlassen hatte, konnte er durchatmen, ohne dass hilfloser Zorn ihm die Luft abschnürte. Hätte Gott das kleine Mädchen nicht einfach am Leben lassen können? Andere Gedanken verbot er sich, während er grimmig den neuen Rekruten zuschaute. Es war die übliche Mischung aus verhungerten Bauernburschen und beutegierigen Abenteurern, die die Werber regelmäßig anschleppten, aber der junge Offizier, der seinen ehemaligen Posten übernommen hatte, schien die Kerle im Griff zu haben. Eine Weile starrte er blicklos in die Richtung des Drills. Seine Gedanken kehrten zu den Schanzarbeiten zurück. Sie liefen so gut, wie zu hoffen war. Das eigentliche Problem war dieser verflixte Katholik. Maxilius hatte keine Ahnung, woher er von dem verschwundenen Schreiber wusste, aber dass er von ihm wusste, zwang Maxilius zu einer Entscheidung. Entweder stellte er Jakob Liebig endgültig kalt oder er bezog ihn in seine Ermittlungen ein. Er fuhr sich unter dem Hut durch die Haare. Selten hatten sein Kopf und sein Bauchgefühl so im Widerstreit gelegen. Er verschob die Entscheidung auf später und ließ sich von der Wache Bericht erstatten. Spielvogel war wie befohlen mit Geleitschutz für Lena und Anni abgerückt.
»Und der Bote des Spaniers war wieder da, Herr Major«, schloss der Mann widerstrebend. »Er ist jetzt weg, aber er bittet Euch inständig um eine Unterredung mit seinem Herrn. Der fürchtet um sein Leben, sagt er!«
Maxilius’ Temperament züngelte schon wieder auf. Wieso hatte der Narr mit der wichtigsten Nachricht bis zuletzt gewartet? Die Antwort lag auf der Hand: Angst vor einem Wutanfall des Vorgesetzten. Herrgott, der Kerl war in der Armee und nicht bei seiner Mutter.
Ohne sich umzuwenden, brüllte Maxilius: »Hauptmann!«
Sofort eilte Laurenz an seine Seite. »Herr Major?«
»Ihr begleitet mich mit vier Mann! Sie sollen Fackeln mitnehmen. Wir werden jetzt dem letzten Spanier von Heidelberg einen Besuch abstatten«, verkündete Maxilius grimmig. »Vorwärts!«
Im Gleichschritt gingen die vier Männer den Offizieren voraus und leuchteten ihnen den Weg. Hier und da blieben Menschen stehen, um dem militärischen Trupp nachzugaffen, und Maxilius konnte sich die Gerüchte gut vorstellen, die binnen einer Stunde den braven Bürgern das Abendbrot würzen würden. Von der Hauptstraße wandte er sich den Villen zu, die zwischen der Heiliggeistkirche und der östlichen Stadtmauer angesiedelt waren. Er bog in eine Gasse, die zum Neckar führte, und hielt vor einem prächtigen Haus mit stuckverzierter Fassade.
»Scheiße!«, entfuhr es Laurenz.
Maxilius verzog den Mund zu einem hämischen Lächeln. »Da habt Ihr wohl den Nagel auf den Kopf getroffen«, murmelte er und begutachtete die braunen Spuren, die Tür und Mauer verunzierten. »Es ist aber doch interessant, dass sie keine Steine genommen haben.« Er wies einen Soldaten an zu klopfen.
Es dauerte nicht lange, bis ein misstrauisches »Wer ist da?« erklang.
Maxilius stieß die Tür schwungvoll auf und trat unaufgefordert in den Hausflur. »Stadtkommandant Maxilius.«
Im Halbdunkel sah er den kostbaren roten und goldenen Stoff einer Livree schimmern. Die Züge des Dieners erkannte er nicht, weil der sich bereits umgedreht hatte und davoneilte.
Fast gleichzeitig kam ihnen ein schwarzhaariger Lakai, ebenfalls in prächtiger Aufmachung, aus dem Inneren des Hauses entgegen. »Wenn Ihr mir bitte folgen wollt«, bat er in fast akzentfreiem Deutsch, »mein Herr erwartet Euch bereits.«
»Tut er das?«, fragte Maxilius mit beißender Ironie. »Hauptmann, Ihr bezieht vor dem Haus Posten. Die Leute sollen ruhig sehen, dass wir uns des Problems hier annehmen.« Zufrieden sah er, wie der Blick des Lakaien unruhig zu den Soldaten huschte. »Na los, mein Junge, wir wollen deinen Herrn nicht warten lassen.«
Der Diener bewegte sich lautlos über die dicken Teppiche die Treppe empor. Maxilius folgte. Das Haus wies den zu erwartenden Prunk auf. Rodriguez war einer der zahlreichen Gesandten gewesen, die Heidelberg zu einem glanzvollen Pflaster gemacht hatten, als der junge Kurfürst noch Hof gehalten hatte. Von dem Glanz war wenig geblieben, nur ein verängstigter Spanier, der auf grausame Weise daran erinnert wurde, wie entbehrlich er war. Maxilius betrachtete sich in einem der mannshohen Spiegel in dem kleinen Kabinett, das sie gerade durchquerten, und ließ seine Absätze härter auf dem erlesenen Parkett hallen. Der Lakai zuckte, und Maxilius konnte sich lebhaft vorstellen, was er gerade über den deutschen Bären denken mochte, der da hinter ihm her stapfte. Zum ersten Mal seit Tagen hatte er so etwas wie gute Laune.
Der Weg endete schließlich in der Bibliothek, einem hohen, getäfelten Raum mit verzierten Möbeln und mehr Teppichen. Der Leuchter an der Decke war bereits entzündet und im Kamin loderte ein Feuer. Ein Mann stand am Fenster. Er drehte ihnen den Rücken zu, doch kaum hatte der Diener Maxilius angekündigt, schnellte er herum und kam dem Stadtkommandanten mit ausgestreckten Händen entgegen. Erst im letzten Moment bremste er sich und blieb stehen. »Endlich«, sagte er mit einem Rest von Hochmut. »Herr Stadtkommandant, Ihr müsst Euch meiner Sache annehmen.«
Maxilius zog langsam den Hut. Er wusste von den vielen verhassten Besuchen bei Hof, was die guten Sitten geboten. Diesem Mann die ihm zustehende Höflichkeit vorzuenthalten, kam ihm kleinlich vor. Er verbeugte sich knapp, während er Rodriguez scharf musterte. Der Spanier war zierlich, blass und von einer Schönheit, die bei einem Mann fast sündig erschien. Anders als seine Diener war er in Schwarz gekleidet, doch die silbernen Stickereien und die üppige Halskrause ließen keinen Gedanken an christliche Demut aufkommen. »Gott zum Gruß, Herr Gesandter.«
Der Spanier stutzte, fuhr sich hastig über den gepflegten Bart und nickte. »Gott zum Gruß. Herr Kommandant, ich bin verzweifelt.«
Maxilius wartete, bis der Lakai die Türflügel von außen geschlossen hatte, ehe er bedeutsam die brokatbespannten Sessel fixierte.
Rodriguez’ bleiche Wangen verfärbten sich. »Bitte, nehmt Platz, wollt Ihr …«
»Danke, nichts. Ihr habt bereits mehrfach bei mir vorgesprochen. Was kann ich für Euch tun?«
»Habt Ihr mein Haus nicht gesehen?«, ereiferte sich der Spanier. Er schien schon wieder kurz davor aufzuspringen, beherrschte sich aber. Seine Hände flatterten.
Maxilius’ Mundwinkel hoben sich. »Das habe ich, und ich vermute, dass es sich um gute deutsche Scheiße handelt.« Der Spanier öffnete den Mund, aber Maxilius ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Das ist bedauerlich, Ihr müsst allerdings bedenken, dass Ihr ein Katholik in einer protestantischen Stadt seid. Wenn Ihr nichts weiter vorzubringen habt …«
»Mein Leben wird bedroht. Ich wage mich nicht mehr aus dem Haus.«
»Das ist klug«, warf Maxilius trocken ein. »Bedauerlich, aber klug.«
»Aber … Ihr habt mir Schutz zugesichert, damals, als …« Als dein König dich im Stich gelassen hat, vervollständigte Maxilius im Geiste. »Ich sehe ihn nicht, diesen Schutz.«
Maxilius schlug die Beine übereinander. »Ihr seid am Leben. Ihr seid unverletzt. Lasst mich Euch eine andere Frage stellen: Warum seid Ihr noch hier?«
»Weil mein König es so wünscht.«
Maxilius beugte sich vor. »Und warum?«
Der Spanier presste sich in seinen Stuhl. Seine unruhigen Finger krampften sich um die Armlehnen. »Ihr werdet verstehen, wenn ich Euch darüber keine detaillierten Auskünfte geben kann. Ich rechne jedoch täglich mit einem Boten.« Er brach ab und blickte Maxilius aus geweiteten Augen an. »Was habt Ihr?«
»Sprecht ruhig weiter«, forderte der Stadtkommandant beinahe sanft. »Ihr erwartet einen Boten, der …«
»Mich abberufen soll. Weg aus diesem … Land.«
»War er schon da, dieser Bote?«
»Nein.«
»Nein. Wie bedauerlich. Wisst Ihr, dass ein junger Mann gestorben ist? Ein Bote?«
Jetzt sprang Rodriguez doch auf. Mit hastigen Schritten lief er an der hohen Fensterfront auf und ab. »Sind das Eure Soldaten?«
»Offensichtlich. Ihr wolltet Schutz. Da ist Schutz.«
Rodriguez schnellte herum. »Bin ich ein Gefangener?«
Maxilius hob beide Hände. »Wie kommt Ihr auf den Gedanken? Herr Gesandter, wer soll Euch schützen, wenn nicht meine Soldaten?«
»Und der Tote? Was hat es mit ihm auf sich?«
»Ein junger Mann namens Kuno.« Maxilius fixierte den Spanier starr.
Auf dessen Wangen brannten nun rote Flecken. »Kuno ist kein spanischer Name. Und er ist tot? Wie?«
»Ihm wurde die Kehle durchgeschnitten, dann wurde sein Gesicht durch Schläge unkenntlich gemacht.«
»Madre de Dios! Wieso denkt Ihr, dass er von meinem Herrn geschickt wurde?«
»Das denke ich nicht. Ihr sagtet, dass Ihr einen Boten erwartet. Wer arbeitet für Euch?«
»Mein Majordomus und vier Diener. Außerdem das Küchenpersonal.« Wenn der abrupte Themenwechsel ihn irritierte, ließ er es sich nicht anmerken. »Einer wurde auf dem Weg zum Markt zusammengeschlagen.«
»Von wem?«
Rodriguez hob die Schultern. »Männern. Euren Männern. Protestantischen Männern. Sie sind die Mörder. Nicht ich. Wieso fragt Ihr mich nach einem Toten? Verdächtigt Ihr mich und meine Leute? Stehen die Soldaten deswegen vor meiner Tür?« Das schöne Gesicht war beinahe hässlich in seiner Erregung.
Maxilius musterte es kalt. »Ihr wirkt sehr nervös.«
»Natürlich wirke ich nervös!«, rief Rodriguez schrill. »Ich fürchte mich.«
»Dann helft mir, Euch zu schützen. Wer hat Euren Diener angegriffen?«
»Vier oder fünf Männer. Sehr jung, hat mein Diener gesagt. Bauern vielleicht.«
Maxilius wölbte skeptisch die Braue, er vermutete, dass für den Spanier jeder einfache Mann ein Bauer war. »Ich werde mich darum kümmern«, versprach er. »Und meine Soldaten werden Euer Haus im Auge behalten.«
»Aber … das ist nicht nötig. Nicht immer, meine ich. Nur …«
Maxilius lächelte breit. »Bitte, wir Protestanten sind gute Gastgeber. Und Euer König soll nicht sagen, dass wir seinen Gesandten nicht beschützt haben. Gibt es noch etwas?«
»Nein.«
Maxilius erhob sich, doch ein Einfall ließ ihn innehalten. »Sagt Euch der Name Jakob Liebig etwas?«
»Nicht, dass ich wüsste«, antwortete Rodriguez prompt. »Ist er auch tot?«
Maxilius seufzte. »Nein, der nicht.«
Rodriguez betrachtete angestrengt seine linke Hand, an der mehrere kostbare Ringe funkelten. »Herr Stadtkommandant«, begann er langsam, »eine Sache gibt es doch noch. Ich bin Katholik, die Leute misstrauen mir. Wenn ich abreise, werde ich viel Gepäck zu transportieren haben. Ich werde Leute brauchen, Kisten, Pferde …«
»Ja?«
»Könnt Ihr mir Namen nennen? Männer, die für gutes Geld gute Arbeit leisten? Einen Zimmermann vielleicht, der auch für einen Katholiken tätig wird?« Er drehte wie zufällig einen schweren Goldring an seinem mädchenhaft schmalen Finger.
Maxilius lächelte verächtlich. »Ich denke, Geld regiert auch in unruhigen Zeiten die Welt. Ihr werdet schon jemanden finden.«
»Ja, Herr Kommandant. Danke. Luis …«
Der junge Majordomus erschien mit der Lautlosigkeit, die Maxilius an höfischen Lakaien noch nie hatte leiden können. »Begleite den Herrn Stadtkommandanten nach draußen.«
»Ja, Herr.«
Auf der Straße ging Laurenz dem Major entgegen und wartete respektvoll, ob sein Vorgesetzter ihn ins Vertrauen ziehen würde. Maxilius betrachtete erst zufrieden die Menschentraube, die herauszufinden versuchte, was die Soldaten von dem Katholiken wollten, ehe er sich dem Hauptmann zuwandte. Der junge Mann hatte ein offenes Gesicht, das Maxilius vom ersten Augenblick an angenehm gewesen war. Er arbeitete zuverlässig und hart. »Zwei Männer bleiben hier als … Schutz.«
Laurenz grinste. »Wir schützen den Herrn vor unbedachten Handlungen?«
»So ähnlich. Vielleicht finden wir heraus, warum er überhaupt noch hier ist. Als er von der dauerhaften Leibwache erfuhr, war er gar nicht mehr so erpicht auf Schutz.«
»Denkt Ihr …«, Maxilius bedeutete dem jungen Offizier, weiterzusprechen, »… dass er etwas mit dem Toten zu tun hat? Oder mit dem Schreiber?«
Maxilius zuckte die Achseln »Wenn ich das wüsste! Ich bin sicher, dass er lügt, aber ich weiß nicht, wobei. Gott verdamme alle Politiker!«