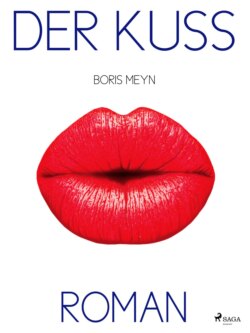Читать книгу Der Kuss - Boris Meyn - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBevor ich die Hallen des innerstädtischen Bahnhofs verließ, der früher wie ein Riegel die Geschäfts- und Handelswelt auf der einen von den zwielichtigen Gassen der Gescheiterten auf der anderen Seite getrennt hatte, nutzte ich die Gelegenheit und kaufte mir einen Stadtplan. Ich war nicht sicher, ob ich mich nach den vielen Jahren der Abwesenheit in dieser Stadt noch zurechtfinden würde. Beim Überqueren der Ringstraße tankte ich dankbar ein paar Sonnenstrahlen, dann tauchte ich ein in die beschattete Schlucht der großen Fußgängerzone und ließ mich mitreißen vom Sog der Passanten auf ihrem Weg zu den alten, inzwischen mit Glasfassaden armierten Tempeln des Konsums.
Das Erste, was mir auffiel, war der Geruch der Stadt. Ich kramte in meinen Erinnerungen, aber den damaligen Geruch hatte ich abgelegt wie einen alten, von Motten zerfressenen Mantel. Ich wusste nur noch, dass in den Teilen der Stadt, in denen industrielle Produktionsstätten gestanden hatten, sehr oft ein durchdringender Geruch von Hefe in der Luft gelegen hatte, ganz abgesehen vom Gestank der Hafenbezirke, einer Mischung aus modrigem Brackwasser und den Abgasen der Schwerölverbrennung.
Zumindest hier an diesem Ort war davon nichts zu spüren. Weder der penetrante Duft gebratener Hähnchen lag in der Luft, noch begegnete ich den stets hungrig machenden Schwaden von Frittenfett und Currywurst, die einst an jeder zweiten Ecke aus den Imbissbuden und Verkaufswagen aufgestiegen waren. So langsam kam die Erinnerung zurück. Was ich hingegen wahrnahm, war eine Melange aus Coffee to go, Parfüm, Nikotin und Schweiß wie ein letztes Aufbäumen gegen den aseptischen Geruch von Geld und Kommerz.
Ungewohnt waren auch die vielen Stühle und Tische vor den zahlreichen Lokalen. Was ich in Erinnerung hatte, war das rast- und ruhelose Strömen der Menschen vor den Schaufenstern und durch die Passagen, deren Anzahl sich gleichwohl verdoppelt haben musste, unterbrochen höchstens von den Pulks der selbst ernannten Outlaws, die sich um die Brunnen und an markanten Plätzen versammelten und demonstrativ alternative Lebenskulturen propagierten, letztendlich nichts anderes als rebellierende Jugendliche, wie es sie seit jeher gegeben hatte. So gut wie nichts davon war geblieben.
Touristen und Einheimische waren auf den ersten Blick kaum auseinanderzuhalten. An diesem Ort wirkte die Stadt vollgestopft und überlaufen von Menschen, die nicht zu arbeiten schienen, flanierende Pärchen, Männer in teuren, maßgefertigten Anzügen, die sich sowohl alleine als auch in kleinen Gruppen bewegten, sicher Geschäftsleute auf dem Weg in die Mittagspause, blasse Mädchen mit kurzen Röcken, darunter einheitlich dreiviertellange, schwarze Strumpfhosen und Ballerinas, das Handy am Ohr, egal ob laufend oder sitzend, auf das Gerät starrend, abgerückt von der Welt, zumindest der realen.
Vorbei die Zeit, wo man in dieser Stadt sein Mittagessen im Stehen einnahm. Sushi Bars, Cafés und Spezialitätenrestaurants von unglaublicher regionaler Vielfalt hatten Fischbrötchen und Chinamann allerorten abgelöst. Was früher unter Asia-Food lief, differenzierte man inzwischen nach Ländern, abwechselnd Vietnam, Korea und Thailand, außerdem gab es indische, malaysische oder philippinische Delikatessen. Früher hätte man jede Wette eingehen können, in der Küche beim Asia-Restaurant schwarzhäutige Kenianer oder Ghanaer anzutreffen.
Kurz spielte ich mit dem Gedanken, das alte Vorurteil den Küchenhierarchien in fernöstlichen Restaurants gegenüber prüfen zu wollen, ließ es dann aber und setzte mich am Ende der Fußgängerzone unter den Schirm eines Eiscafés, dessen Mobiliar durch einen Zaun von Buchsbäumen in eckigen Terracotta-Kübeln zu dem der benachbarten Pizzeria abgegrenzt wurde.
Ein wenig Wehmut überkam mich. Alles wirkte so aufgeräumt und sauber, wie man es in den achtziger Jahren – wenn überhaupt – höchstens aus Zürich kannte. Die Gehwege und Bürgersteige waren blitzblank und aufgeräumt, obwohl kein Reinigungsfahrzeug oder Straßenkehrer zu sehen war. An den Laternenmasten klebten weder Aufkleber noch Offerten. Dafür gab es Spenderboxen mit kostenlosen Tüten für Hundedreck und Mülleimer, die nicht mehr gelb oder grün waren, sondern rot und mit einer eigenen Öffnung für Zigaretten. Auf den zweiten Blick bemerkte ich die plakativen Wortspielereien auf den Tonnen, mit denen die Passanten zur Nutzung aufgefordert wurden. Zumindest in ihrer Aufmachung erinnerten sie an die infernalische Plakatierungswut früherer Zeiten.
Die Straßen waren verkehrsberuhigt und zugeparkt wie in Paris. Der Lieferverkehr parkte in der zweiten und dritten Reihe mit dem Unterschied, dass die hiesigen Straßen und Gassen in ihren Ausdehnungen und ihrer Breite nicht an die französischen Boulevards heranreichten. Entsprechend zäh floss der Verkehr. Dafür gab es hier Autos von unglaublichen Ausmaßen, die angesichts der beengten Verkehrssituation eine Groteske der Unvernunft waren. Luxuslimousinen und Sportwagen, zweistöckig wirkende Geländewagen, die ich aus den Anzeigen in den einschlägigen Gourmet-Magazinen kannte.
Nur selten parkte vor unserem Restaurant Vergleichbares. Wenn tatsächlich wohlhabende Gäste einkehrten, was in letzter Zeit immer häufiger geschah, fuhren sie mit dem Taxi vor. Ich winkte nach dem braun beschürzten Ober, einem schwuchtelig mit den Hüften tänzelnden Jüngling mit Pilzkopf, braun gebrannt und mit peinlichem Tattoo am Oberarm, der mich erwartungsvoll anschmachtete, und bestellte einen Cappuccino und einen Krokantbecher mit Sahne, seine begehrlichen Blicke ignorierend. Mit meinem hellen Leinenanzug fühlte ich mich inmitten der kurzen Röcke und dunklen Anzüge etwas deplatziert, ließ es mir aber nicht anmerken und genoss heimlich den Exotenstatus, der mir zufiel.
Mit dem Cappuccino und dem Eis kam die Maisonne. Sie gab ein kurzes Intermezzo zwischen den Dachmansarden zweier Geschäftshäuser. Zumindest für einen Augenblick erfüllten die Sonnenschirme ihren Zweck, bevor die langen Schlagschatten der Geschäftshäuser die Konsumschlucht wieder ins Dunkel tauchten.
Der Cappuccino schmeckte dem Preis entsprechend süß, das Eis war im American Style überdekoriert, die Waffel ungenießbar. Wo waren sie geblieben, die unzähligen Tauben, welche die Stadt hier früher besetzt gehalten hatten? Keine Baustellen mehr, keine verwahrlosten Fassaden, die in den Siebzigern noch mehrheitlich die Straßenzüge dominiert hatten. Alles wirkte aufgeräumt und fertig, Sonnenmarkisen, früher als Regenmarkisen verspottet, über jedem Schaufenster, Ton in Ton gehalten mit dem Putz der darüber aufragenden Fassaden, Auslagen wie für Fotografen arrangiert.
Man hätte den Eindruck gewinnen können, die Geschäfte konkurrierten gegenseitig in der Wiederholung des Weglassens. Keine Krimskrams-, Ramsch- und Teeläden mehr, kein Tinnef weit und breit. Die Mischung war weg, konzentrierte sich wahrscheinlich an anderen Orten. Hier herrschte gähnende Eintönigkeit. Selbst die großen Kaufhäuser, früher Vorwand, dringend in die Stadt zu müssen, Unordnung über die zahllosen Etagen mit ihrem Geflecht aus Rolltreppen und Lichtschächten verteilt, waren nur noch Rudimente ihrer selbst. Das also war mein erster Eindruck.
Um nicht in Melancholie zu verfallen, hatte ich ein Zimmer bei einer amerikanischen Hotelkette gebucht, sachlich und neutral, mit Angeboten, die mich nicht in Versuchung führten. Ich war nicht als Abenteurer gekommen und hatte keinen Bedarf an befristeter Gefolgschaft. Zwei Nächte mit der Option auf Verlängerung. Anelis hatte mir angeboten, bei ihr zu wohnen. Einen genauen Ankunftstag hatte ich ihr wohlweislich nicht mitgeteilt. Ich wollte keine Verpflichtung eingehen.
Beim Einchecken nur der Anflug fragender Verständnislosigkeit mit Blick auf meine kleine Reisetasche, der binnen Sekundenbruchteilen in der angelernten Maske transatlantischer Toleranz verschwand: Der Gast war König – egal welcher Insignien er sich bediente. Kein Stirnrunzeln, wenn man mit ausgewaschenen Jeans die Suite betrat, keine tadelnd rollenden Augen, wenn normales Besteck zum Fisch verlangt wurde, Pommes Frites zur Seezunge geordert oder Kartoffeln zum Spargel mit der Gabel zermust wurden. Diese Freiheiten hatte Europa dem Amerikanismus in der Reisebranche zu verdanken, wie er irgendwann in den achtziger Jahren seinen Siegeszug gegen die zwanghaften Zeremonien traditioneller Benimmregeln angetreten hatte. Who cares? Dort war das Geld, das den Umsatz brachte. Nun waren die Russen und Chinesen in die Rolle der kapitalkräftigen Eroberer geschlüpft. In Frankreich zumindest. Ob es auch hier so war, würde sich zeigen.
Das Zimmer hatte beachtliche Ausmaße und auf dem King-Size Bett hätte man eine Orgie veranstalten können. Ich verstaute meine Kleidung im riesigen Schrank, wobei ich mir aus Unwissenheit die Finger in einem Automatikbügel klemmte, dessen Technik sich mir auf den ersten Blick nicht erschloss, und das nur, um zwei Hemden und eine Hose faltenfrei zu bekommen. Meine Wertsachen, darunter ein Verrechnungsscheck in Höhe von sechs Millionen Euro, schloss ich im zimmereigenen kleinen Wandtresor ein. Dann scheiterte ich daran, die Tür des Zimmers mittels einer elektronischen Karte abzuschließen, sodass ich den Zimmerservice rufen musste. Man erklärte mir wie einem Außerirdischen, in welcher Reihenfolge das Schließen, Einstecken, Warten und Rausziehen zum Erfolg führte.
Ich dankte dem Zimmermädchen und verabschiedete mich mit dem erleichterten Blick eines Hilflosen, an den sie – ich war mir sicher – noch eine Weile zurückdenken würde, weil sie mich die ganze Zeit so angeschaut hatte, dass es mir nicht sonderlich schwerfiel, ihre Gedanken zu erraten. Dann war ich zurück im Strudel der Straße, der mich aufsog wie einen Heimkehrer aus dem Gulag, wie einen geläuterten Eremiten.
Wie sehr ich diese Stadt vermisst hatte, merkte ich erst, als ich nach mir bekannten Dingen Ausschau hielt und mir bewusst wurde, dass selbst zwei Jahrzehnte mit all ihren Zyklen und Legislaturperioden ihren Grundcharakter nicht hatten verändern können. Tatsächlich erkannte ich kaum etwas, das ich mir eingeprägt hatte – die Erinnerung haftete ja meist an Kleinigkeiten, nicht am Ganzen, und diese Kleinigkeiten existierten nicht mehr. Aber das allumfassende Konstrukt, das Schachbrett, auf dem diese Stadt gegründet lag, hatte sich genauso wenig verändert wie die Dimensionen der strukturellen Topografie.
Ich vermisste die Telefonzellen, die früher geballt an markanten Punkten gestanden hatten. Gezwungenermaßen kehrte ich bei einem der mit grellen Farben beworbenen Telefonshops ein und erstand mein erstes Handy. Es verging bestimmt eine halbe Stunde, in der mich die junge und adrette Verkäuferin von den Vorzügen der unterschiedlichen Produkte zu überzeugen versuchte. Ich nickte zustimmend und ließ mir das Premiummodell aufschwatzen. Der Vertrag wäre fast noch daran gescheitert, dass ich keinen ständigen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte. Deshalb gab ich Anelis’ Adresse an. Nachdem auch dieses Problem aus dem Weg geräumt war, verließ ich nach mehr als einer Stunde Aufklärungsarbeit den wenige Quadratmeter großen Laden, bewaffnet mit einer Grundeinstellung, die selbst einen so technologiefeindlichen Menschen wie mich dazu in die Lage versetzen sollte, an jedem Ort meiner Wahl nicht nur telefonieren zu können, sondern dazu noch Hunderte von Dingen zu erledigen, die mir freiwillig nie in den Sinn gekommen wären.
Die Galerie Finissage, die Anelis seit nunmehr zehn Jahren betrieb, lag hinter dem Domplatz. Ich hatte Schwierigkeiten mit der Zuordnung der Straßennamen, weil die Sanierung ganzer Stadtteile zu neuen Freiflächen, Parks und Sehenswürdigkeiten geführt hatte und zu einem neuen innerstädtischen Wegesystem. Ich musste nur den Strömen von Passanten folgen, um zur nächsten Sehenswürdigkeit, zum nächsten Knotenpunkt oder Denkmal zu gelangen. Aber das wurde mir erst später bewusst. Noch hielt mich die Erinnerung gefangen und ich versuchte den alten Eckpunkten auf einem neuen Stadtplan zu folgen, sie wiederzuerkennen, die Spuren unserer damaligen Zeit aufzuspüren. Ich war glücklich bei jedem noch so marginalen Indiz.
Wie ein kleiner Junge schlich ich um die mit Backsteinornamenten ziselierten Ecken gewaltiger Kontorhäuser, bis ich einen Blick erhaschen konnte auf die Vorgänge in dieser Kathedrale der Künste. Die Fenster der Galerie hatten grün getönte Scheiben, dahinter lockten Kaskaden weißer und grauer Stoffbahnen, die, transparenten Jalousien gleich, den direkten visuellen Zugriff auf die Geschehnisse und Kunstobjekte im Inneren verwehrten. Gleichzeitig mussten sie ein Lockmittel für das kapitalkräftige Publikum sein, das gewillt war, Monats-, ja Jahresgehälter für Kunst zu berappen, die so spärlich in den Räumen arrangiert wurde, dass kein nachbarliches Objekt den Wert beeinflusste. Kunstpräsentation in der Leere des Raums, der auf mich nicht einmal besonders einladend wirkte. Ich brauchte nur wenige Minuten, um zu sehen, dass die Jahrzehnte auch an Anelis nicht spurlos vorbeigegangen waren.
Sie hatte immer noch die knabenhafte Statur androgyner Burschikosität und trug ihre Haare kurz wie eh und je. Inzwischen leuchteten sie so weiß, dass ich kaum glauben konnte, sie färbe sie nicht nach. Mein eigenes Haar begann gerade zu einem lichten Grau zu changieren. Anelis trug Schwarz, wie sie es immer getan hatte. Wahrscheinlich war sie sogar der Kollektion dieser legeren Hosenfrau mit dem schiefen Lächeln treu geblieben, die inzwischen zu Weltruhm gelangt war, das Fräulein Chanel von Hamburg. Zumindest hatte Anelis damals immer von ihren Entwürfen geschwärmt. Nur hatte sie sich die Kostüme und Hosenanzüge nicht leisten können und sich entsprechend sartrös Existenzialistisches selbst nähen müssen. Bestimmt waren diese stets charmanten Notlösungen inzwischen Originalen gewichen.
Ich war überrascht, auch ihre Bewegungen sofort zu erkennen. Das zarte Herumgewedel mit ihren schlaksigen Armen, wenn sie sprach, als gälte es, Instruktionen für einen Maskenbildner in Gebärdensprache zu übersetzen. Ich war zu weit entfernt, um zu erkennen, ob sie immer noch so mit Sommersprossen übersät war. Wahrscheinlich waren sie inzwischen zu Altersflecken mutiert. Im Sommer waren Gesicht, Schultern und Dekolleté stets gebräunt gewesen von unzähligen dunklen Farbpigmenten. Ihr helles Haar formte ich in Gedanken zu diesem zerwuschelten Pagenkopf, den sie bei unserem letzten Beisammensein gehabt hatte. Dazu lächelte der breite Mund, und ihre Augen blinzelten fast schlupflidrig mit einer Andeutung flacher Brauen. Anstelle der Jochbeine hatte sie pausbäckig spitze Wangen, als wäre sie einem Bullerbü-Film entstiegen. So hatte ich sie gesehen, und so sah ich sie immer noch im Spiegel der Zeit. Intimeren Details der Erinnerung verweigerte ich mich in diesem Augenblick.
Sie war im Gespräch mit einer hochgewachsenen jungen Frau mit strohblonder Mähne. Ihnen gegenüber stand ein vermeintlicher Investor, Typ zu kurz geratener Ägypter in gestreiftem Zweireiher mit pomadiger Kurzhaarfrisur, wahrscheinlich Schuhgröße sechsunddreißig mit hohem Spann. Die Höhe des an mich ausgestellten Schecks hatte mir eine ungefähre Vorstellung davon gegeben, welche Umsätze an einem Ort wie diesem erzielt wurden.
Soweit ich erkennen konnte, waren kaum Skulpturen und Plastiken ausgestellt, dafür Altmeisterliches in kleinen Nischen, dezent beleuchtet von unsichtbaren Strahlern, eine Abteilung weiter, strikt durch Mauern getrennt, großformatige Porträts in Schlemmer’scher Manier. Die Künstler waren mir nicht bekannt, auch nicht der Schöpfer der wilden Farbphantasien, die an der Wand im linken Teil der Galerie um die Vormachtstellung der Quadratmeter kämpften. Einzig einen Richter konnte ich auf die Entfernung zuordnen. Für den interessierte sich anscheinend auch der Besucher.
Von Neugier getrieben, traute ich mich verräterisch nah an die Fensterscheibe heran, aber man nahm keine Notiz von mir. Dafür konnte ich erkennen, dass das Interesse des Mannes mehr an der blonden Frau als am Richter hing. Das verriet sein um Gunst buhlender Blick. Sie war also nicht seine Begleiterin, sondern gehörte zum beweglichen Inventar der Galerie, vielleicht Anelis’ Assistentin, eine Kunststudentin, Praktikantin, ein angestellter Lockvogel oder gar ihre Geliebte. Das Auftreten und die atemberaubende Schönheit dieser Elfe beflügelten meine Phantasie.
Mit ihrem weißblonden Haar, das sie in schmalen Zöpfen um den Kopf geschlungen trug, erinnerte sie mich an eine schwedische Lucia, dem Midsommarfest entsprungen, barfuß im weißen Trägerkleid, mit Mohnblumen und Ähren geschmückt, die Versinnbildlichung feenhafter Leichtigkeit, angesiedelt irgendwo zwischen wollüstigem Kitsch und volkstümlicher Unschuld.
Es war ein aufregendes Schauspiel, das sich mir bot, und ich genoss für einen Augenblick die Rolle des Voyeurs. Zu gerne wäre ich näher getreten angesichts dieser in Nebensächlichkeit verpackten Versuchung, dem kecken Lachen, das ich erkennen konnte, doch ich bremste mein Begehren und wendete mich ab. Noch war ich nicht so weit.
Zuerst wollte ich mich vergewissern, ob es meine Amazone noch gab. Aufgestellt war sie im Park der Vernunft, der einst den Puffer zwischen jurisdiktivem Protz und städtischer Untergrundkultur dargestellt hatte, ein Niemandsland zu einer Zeit, als Zuhälter vor Gericht noch Staatsanwälte erschossen und Mütter an mordenden Sexualstraftätern Selbstjustiz verübten. Genau dort, am abgrundtiefen Krater, der ein weißes von einem schwarzen Feld trennte, hatte meine Amazone ihren Platz gefunden.
Ganz Hamburg war schon immer ein Schachbrett gewesen, arm neben reich, gut neben böse, grün neben grau, teuer neben billig, schmuddelig neben elitär, ohne jeden Übergang und stets im harmonischen, geographischen Wechsel. Es war meine einzige größere Arbeit gewesen, welche die Stadt für das Programm Kunst im Öffentlichen Raum angekauft hatte, eine formal durch Rodin inspirierte Bronze, deren Figürlichkeit den Schuldenschnitt zwischen § 184 und § 218 symbolisierte, angefertigt zu einem Zeitpunkt, als die ersten Peepshows der Stadt ihre Tore schließen mussten. Von den 25 000 Mark, die ich dafür erhielt, hatten wir zwei Jahre leben und arbeiten können, Theo und ich.