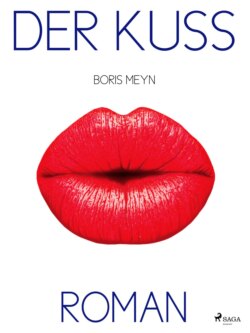Читать книгу Der Kuss - Boris Meyn - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеJulia nahm mich in Beschlag. Und sie führte mich mehr, als dass sie mich begleitete. Sie gab den Takt vor, zumindest außerhalb der Lehrzeiten. In der Hochschule traf ich sie nur in einigen Vorlesungen und Pflichtveranstaltungen, sonst war ich auf mich alleine gestellt. Dennoch war sie das Rückgrat, das mir Sicherheit gab. Ich war angenommen worden, das war das Wichtigste, ich hatte vorerst eine Bleibe, aber sonst nur eine vage Vorstellung vor Augen. Das war mehr, als ich erhofft hatte.
Die ersten Tage fühlte ich mich überfordert vom studentischen Alltag. Ich kannte nichts und niemanden. Hinzu kam die unsagbare Gewalt, die das alte, ehrwürdige Gemäuer der Kunsthochschule verströmte. Es war eine mächtige Theatralik der Räume, die der Erschaffer zwischen den Weltkriegen vor Augen gehabt haben musste und der man wie ein Statist ausgeliefert war.
Bühnen wechselten mit Nischen, Flure wurden von auskragenden Mauern umspannt, die wie Vorhänge Perspektiven begrenzten, gleichfalls neue Räume schufen, Einblicke und Durchbrüche zu immer neuen Gefügen modellierten. Dazu die dekorative Symbolik des rohen, gebrannten Backsteins an markanten Zonen, gestaffelt, gequadert oder zu Bögen, Lisenen und Pilastern geformt – genauso schwülstig wie die aus dunklem Linoleum gefertigten Bodenbeläge, deren ausgetretenem Alter auch der wöchentlich aufpolierte Wachs keinen wirklichen Glanz mehr verleihen konnte. Das Mobiliar stammte wahrscheinlich noch aus der Vorkriegszeit und war nur in einigen Räumen mit zeitgenössischen Varianten aus Stahlrohr und Multiplex ergänzt worden. Am auffälligsten aber waren die unzähligen Schränke, Regale, Vitrinen und Plankommoden, die überall untergebracht waren, wo sich Platz fand, sodass es eigentlich keine freien Wandflächen gab, wenn sie nicht ausdrücklich für die Präsentation ausgesuchter Werke reserviert waren.
In diesem Theater der düsteren Illusionen, das sich, soviel stand für mich fest, in seiner Gestalt der edukatorischen Wirkung von Handwerklichkeit und Tradition bediente, tummelten sich nun Horden exzessiv auftretender Studenten. Grüne Parkas, alte Fellmäntel und Selbstgestricktes, wohin man sah. Clogs und Clarks im Winter, im Sommer Jesuslatschen und Espadrilles an den Füßen, dazu lange Haare und ungepflegte Bärte, die Lehrkörper in der Mehrzahl zu jung, um sich wirklich von den Studenten zu unterscheiden. Jeansstoff war das Mittel der Wahl. Bartlos mit halblanger Frisur, Rollkragen und Cordhose, so genoss ich schon Exotenstatus.
Es gab zwei Meisterklassen für den von mir gewählten Fachbereich Bildhauerei und Skulptur. Ich wurde der Klasse von Professor Winkler zugeteilt, einem klassischen Lehrmeister, der seine Studenten noch siezte, aber mit Vornamen ansprach. Bei ihm gab es noch einen freien Platz. Bei Lamponi herrschte hingegen dichtes Gedränge. Ich wäre bei ihm aber auch nicht glücklich geworden.
Dort saßen die Freaks der Moderne. Es gab mehr theoretischen Überbau als Handwerk. Die ganze Bandbreite experimenteller Kunst – Rauminstallationen, Video, Konzeptkunst, lauter schräge Sachen und viel Gefasel. Hochaktuell. Es passte genau in die Zeit. Lamponi war bekennender Fluxus-Künstler und kam aus der Dada-Ecke. Die älteren Winkler-Schüler nannten das spöttisch Gaga-Szene.
Mich beeindruckte die stoische Gelassenheit, mit der Winkler an einer Ausbildung festhielt, deren Programm althergebracht war und wahrscheinlich schon vor 50 Jahren nicht sehr anders ausgesehen hatte, was Ablauf und Reihenfolge der Inhalte betraf. Zuerst wurden die Grundlagen vermittelt, Werkund Materialkunde, Studium der Anatomie des Körpers, Farbe und Form, freies Zeichnen, Kunstgeschichte. Was andere Studienfächer als Schwerpunkt hatten, musste laut Winkler zumindest begriffen werden. Malerei – Keramik – Textil – Design. Fotografie und Architektur wurden erst Jahre später angeboten.
Winkler war ein hochgewachsener, kräftiger Recke, der während des Unterrichts weiße Kittel trug und stets eine Pfeife in der Hand oder im Mundwinkel hatte. Seine Hände waren gewaltig wie Klodeckel und mit einer kräftigen Hornhaut überzogen. Die donnernde Stimme mit einem schrägen Vibrato passte zu seiner Erscheinung.
Wir waren uns von dem Moment an sympathisch, als er mir offen und ehrlich sagte, meine Bewerbungsarbeiten hätten ihn weniger überzeugt, aber er achte stets auf ein gleichgeordnetes Nebeneinander der Geschlechter in seiner Klasse, und die Frauen seien dieses Semester deutlich in der Überzahl gewesen. Ich hatte ihm geantwortet, mir beste Mühe zu geben, seine Einschätzung zu erfüllen und ihn bezüglich der Studentinnen zu unterstützen, woraufhin er sich ein Lachen nicht hatte verkneifen können. Hinter der Maske des Rübezahls verbarg sich der väterliche Freund, der Auftragsarbeiten für die höheren Semester vermittelte, bei der Suche nach Ateliers behilflich war und auch für alle persönlichen Dinge stets ein offenes Ohr hatte.
Im ersten Semester arbeiteten wir mit Speckstein, Ton und Gips. Unsere Werkräume lagen im Erdgeschoss eines Seitenflügels. Die Ateliers standen uns zwar rund um die Uhr zur Verfügung, das hatte Winkler mit dem Hausmeister verabredet und dabei die Verantwortung für seine Zöglinge übernommen, aber am Wochenende war uns der Zutritt verwehrt. So war es eine reine Frage der Zeit, dass man sich nach geeigneten Räumlichkeiten umsah, wo man ungestört arbeiten und werken konnte, zumal der Andrang in den Ateliers der Hochschule sehr groß war. Aber vorerst begnügte ich mich mit den wenigen Stunden, an denen mir die Werkräume zwischen den Unterrichtseinheiten und am Nachmittag zur Verfügung standen, denn ich arbeitete nicht an lebensgroßen oder gar monumentalen Projekten, sondern konzentrierte mich vorerst auf kleinere Formate, und dafür reichte der dortige Platz.
In seiner Kritik war Winkler gnadenlos. Wenn ihm etwas nicht passte, riss er einem das Blatt vom Block oder Reißbrett, heftete es an die mit Kork tapezierte Wand und setzte einen dem Gespött der Klasse aus. Man brauchte ein stabiles Selbstwertgefühl, um keinen seelischen Schaden zu nehmen oder das Studium zu schmeißen.
»Schaut mal alle her!«, hieß es dann. »Apollo mit Klumpfuß« war ein beliebter Spruch für diejenigen, deren Anatomie aus den menschlichen Dimensionen geraten war. »Setzen Sie sich vor den Spiegel und porträtieren Sie sich, bis Sie begriffen haben, dass die Augenpartie die Mitte des Kopfes darstellt!«, war ein anderer Standardsatz von Winkler, den sich viele anhören mussten. Es war seine spezielle Form von Motivation, aber sie funktionierte erstaunlicherweise, denn er ließ uns nicht allein, auch wenn die Fortschritte nur in kleinen Schritten kamen. Hauptsache, man arbeitete an sich und seinem Unvermögen. Allein das zählte für ihn.
Wir akzeptierten seinen bissigen Humor auch, weil er keinen Hehl aus der Tatsache machte, dass er selbst nur wenig künstlerisches Talent mitbrachte und einer der wenigen Professoren war, der kein eigentliches oder paralleles Standbein als Künstler hatte. Sein Können beschränkte sich auf die Vermittlung, Anleitung und das Korrektorat der Lehre – und das beherrschte er vorbildlich.
Dabei war sein Name in der Stadt jedem Kunstinteressierten bekannt, denn sein Vater war seinerzeit ein bekannter Bildhauer gewesen. Dessen Werk, in erster Linie skulpturaler Bauschmuck kolossalen Ausmaßes, zierte unter anderem Brunnen, Giebel und Fassaden vieler öffentlicher Gebäude aus der Zeit der Weimarer Republik, so sie den Krieg überlebt hatten.
Unsere Klasse bestand aus vierzehn Studenten und Studentinnen, die Winkler liebevoll paritätisch wie Kinder bemutterte. Tatsächlich kamen wir uns nach kurzer Zeit wie Geschwister vor und der Kontakt blieb dementsprechend nicht auf die Unterrichtszeit beschränkt. Obwohl ich mich von vornherein in Zurückhaltung übte, war ich im Nu umschwärmt, wie ich es nicht anders gewohnt war.
Nur der Umstand, dass meine Liaison mit Julia schnell jedem Mitstudenten bekannt war, verhinderte weiter reichende Aufdringlichkeiten. Davon abgesehen, tauschten wir uns aus, verabredeten uns zum Abend, gingen gemeinsam ins Theater, ins Kino, man traf sich in Jazzkellern, in Kneipen, kurzum, ich brauchte nur wenige Wochen, um mehr Freunde um mich zu haben, als ich je gehabt hatte. Eine eigene Bleibe hatte ich noch immer nicht.
Die Stadt zu erkunden gab es nur wenig Gelegenheit, so eng war der studentische Lehrplan gesetzt. Was ich wahrnahm, sah ich im Vorübergehen oder aus der Straßenbahn – stets ein Ziel vor Augen. In Julias Wohnung war es zwar geräumig genug, aber an einen eigenen Arbeitsraum war nicht zu denken. Der einzige Raum, der hell genug war, wurde von ihrem großen Webstuhl belegt. Julia ging eigentlich nur ungern aus. Vielmehr verbarrikadierte sie sich in ihren eigenen vier Wänden und genoss unsere Zweisamkeit. Ihre Freunde hatten mit Kunst, wenn überhaupt, nur am Rande zu tun.
Zwei ihrer Freundinnen studierten an der Modeakademie. Brigitte betrieb einen Second-Hand-Laden und wurde mehr von kaufmännischen als von künstlerischen Interessen geleitet. Ein älterer Anwalt war heimlich in sie verliebt, führte sie ständig zum Essen aus und wurde zumindest als Mäzen geduldet. Er hatte Wandteppiche von Julia in seiner Kanzlei hängen. Maura war kurz davor, ihre Schneiderlehre abzuschließen. Sie arbeitete gemeinsam mit Julia in besagter Stoffabteilung des Kaufhauses, träumte von einem eigenen Label, besaß aber keinerlei Phantasie, um sich aus dem Meer bunt gebatikter Umhängefummel zu lösen, wie sie zumindest im Sommer in Mode waren.
Swantje, Anna und Mark hatten gemeinsam mit mir angefangen zu studieren. Swantje fertigte Keramiken von feingliedriger Finesse, keine plumpe Töpferware, wie sie damals in den Küchen und auf den Basttischen der Wohngemeinschaften üblich war, sondern hauchdünne elegante Porzellane, deren Gebrauchswert durch die scheinbare Zerbrechlichkeit gedämpft wurde. Ihre Vasen, Schalen und Teller ließ sie zu kostbaren Unikaten reifen, die entsprechend hochpreisig zu verkaufen waren.
Annas Bronzen – so sie überhaupt Geld für den Guss aufbringen konnte – waren dagegen Gebilde von ungestümer Wut und brachialer Wildheit. Sie zeugten von einem Zorn auf die Welt, der auch ihrem eigenen Wesen nicht fremd war. Sie war eine politisch motivierte Querulantin, die sprach, wie ihr der Schnabel gewachsen war, und sich mit jedem anlegte, der sich ihrem Weltbild der Hoffnungslosigkeit widersetzte. Sie arbeitete im Lager eines Teeversenders und versorgte uns über die Jahre mit den unglaublichsten Geschmacks- und Duftkreationen, egal ob Tee, Räucherstäbchen oder ölige Essenzen, die sie unter der Hand beschaffte.
Mark war ein liebenswerter Chaot, der eigentlich Musiker hätte werden sollen, künstlerisch mehr auf unorganisierte Noten als auf greifbare Materialien stand, sie zumindest besser zu verarbeiten wusste und das Saxophon wie einen Teil seines Körpers zu spielen beherrschte. Er besorgte uns ständig Freikarten zu Gigs und Sessions, zu denen ich dann meistens alleine ging, weil Swantje der Weg zu weit war – sie wohnte in einem der bürgerlichen Vororte im Gartenhaus einer Villa, die ihrer Großmutter gehörte, was sie uns anfangs verheimlichte. Julia waren die Örtlichkeiten meist zu verqualmt, und Anna, mit der Mark eine offene Beziehung pflegte, verpasste konsequent die Termine, weil sie am Abend meist derart zugekifft war, dass sie sich am nächsten Tag nur mit Mühe daran erinnern konnte, dass überhaupt etwas angestanden hatte.
Mark hatte ein außerordentliches Refugium an einem unglaublichen Ort. Verbotenerweise residierte er unter dem Dach eines alten Hafenspeichers, der nie zu Wohnzwecken hätte hergerichtet werden dürfen und auch keine Wohnung im eigentlichen Sinne war. Aber ein Onkel von ihm hatte ein Warenlager im Hafen, darum konnte der Dachboden über dem Lager so von ihm genutzt werden.
Es war ein magischer Ort mit einer phantastischen Aussicht über die Kräne und Lichter des Hafens. Allein die Perspektiven, die sich einem boten, wenn man nachts dem funkelnden Lichtermeer folgte, machten mich sprachlos vor Begeisterung. Das einzige Manko war: Er konnte nur nachts üben, denn tagsüber hätte ihn der Klang des Instruments verraten. Das Wohnen und Schlafen in den Speichern war strengstens verboten.
Und so saß ich dann häufig bis in die Nacht auf der provisorisch eingerichteten Dachterrasse und genoss die funkelnden Sterne des Hafens, während Mark Sonny Rollins, Charlie Parker, Stan Getz oder Paul Desmond aufleben ließ – Letzterer war von uns gegangen, als ich in die Stadt gekommen war. Da Mark von seinen Auftritten nicht leben konnte, war er ständig in Geldnot, zumal immens viel Geld für seinen Tabak draufging. Er rauchte tatsächlich Kette und steckte sich eine an der anderen an.
Ich zog ihn mit der Bemerkung auf, ob er etwa aufpassen müsse, dass sein Glimmstengel nicht ausging, wenn seine Soli bei einem Gig wieder einmal zu knapp geraten waren. Die Regel war, dass ich Essen und Getränke organisierte, wenn ich zu ihm fuhr. Auch die anderen sorgten mit Mitbringseln und regelmäßigen Einladungen dafür, dass er nicht vor die Hunde ging. Mark war so chaotisch wie Anna. In der Hinsicht passten sie hervorragend zueinander, aber während er völlig in der Musik aufging, schwebte über ihr die Gefahr, durch ihre politischen Aktivitäten aus dem Ruder zu laufen.
Anna wohnte in einer Groß-WG und ihre Mitbewohner waren zwielichtige Gesellen, die, so schien es mir, mehr auf Randale aus waren als darauf, wirkliche politische oder gesellschaftliche Konzepte zu entwickeln oder gar danach zu leben. Die nächtlichen Diskussionen bei ihr endeten meist viel zu früh, weil sich die Mehrzahl der Anwesenden nach dem dritten oder vierten Joint nicht mehr verständlich artikulieren konnte. Einer nach dem anderen kippte einfach lallend nach hinten und versank zu sphärischen Klängen oder kommunalen Rhythmen von Garcia und Consorten in der Kissenlandschaft auf dem Boden.
Schon nach kurzer Zeit störte mich weniger das beweihräuchernde Getue als vielmehr die Ergebnislosigkeit der Treffen und Gespräche, die nichts Konkretes zutage förderten bis auf eine Verabredung zur nächsten Demo. Das war der gemeinsame Nenner, sonst nichts. Alles blieb wie es war, man betrachtete das gesellschaftliche und politische Geschehen um einen herum aus verabredeter Distanz, nur um nicht dazuzugehören, um sich nicht eingestehen zu müssen, dass man auch ein Teil des Systems war. Ich verkniff mir meine Kritik. Die Toleranz gegenüber scheinbar Gleichgesinnten war eine heilige Kuh, egal, was für ein Stuss gefaselt wurde.
Für kurze Zeit spielte ich mit dem Gedanken, bei Mark unterzuschlüpfen, aber er war mir zu unorganisiert und zu selbstsüchtig. Hinzu kam der Umstand, dass er, wenn es draußen kälter wurde, in seinen Räumen ein Zelt aufschlagen musste, weil es keine Heizmöglichkeiten gab. Ein Leben in Schlafsack und Trainingsanzug aber, wie er es den Winter über praktizierte, wenn er nicht in einem der Jazzkeller nächtigen konnte, war mir zu ungemütlich. Ich hatte den Luxus, den Julia nach wie vor mit mir zu teilen bereit war.
Auf Winklers Empfehlung hatte ich einen Job als Nachtwache in der städtischen Antikensammlung angetreten, was mir gut zupass kam, konnte ich doch dort vier Nächte in der Woche nebenher mein Studium der Skulpturen und Plastiken fortsetzen. Ich arbeitete gemeinsam mit Karl Bollmann, einem kriegsversehrten Marineoffizier, der die Zeit damit totschlug, seine Aufmerksamkeit zwischen Videoschirmen und BILD-Zeitung hin und her gleiten zu lassen. Ich machte meine Rundgänge und konnte den Blick für die idealen Proportionen in der Anatomie griechischer und römischer Kunst schärfen, währenddessen Bollmann anatomische Studien in schmuddeligen Sexblättchen betrieb.
Was die Arbeitsteilung betraf, waren wir uns schnell einig. Er war dankbar, mit seiner Prothese nicht durch das Labyrinth der Gänge und Ausstellungsräume stiefeln zu müssen. Ich war froh, nicht mit ihm in der stickigen Bude sitzen und lauwarmen Kaffee aus der Thermoskanne trinken zu müssen. Ich dehnte meine Rundgänge immer weiter aus. Nachdem ich meine Antikenstudien beendet hatte, drang ich immer mehr in die benachbarte Skulpturensammlung der Moderne vor, schlich mit Skizzenblock und Bleistift um die Werke von Barlach, Maillol, Rodin, Arp, Chillida, Serra und anderen, zeichnete im Halbdunkel der Räume wie ein Besessener aus allen Perspektiven, bis mir die Plastiken so vertraut waren, dass ich mir einbildete, sie aus der Erinnerung selbst formen zu können.
Wenn ich frühmorgens in Julias Wohnung zurückkehrte, empfing sie mich liebevoll, und in der Regel legte sie sich dann noch für eine kurze Zeit zu mir ins Bett, auch wenn sie sich bereits angezogen hatte. Meist aber stand sie spärlich bekleidet oder nackt in der Küche, bereitete sich einen Tee und wartete auf ihren Krieger, dem sie stets aufs Neue eine ungekünstelte Lüsternheit präsentierte.
Sex am Morgen war für sie Bestandteil eines guten Starts in den Tag. Selbst wenn ich schlaff und müde aus der nächtlichen Schlacht heimkehrte, brauchte sie mich kaum zu überreden, denn mein Körper hatte hinsichtlich ihrer bezaubernden Versuchung längst ein Eigenleben entwickelt. Sie sprach nie aus, dass sie mich die Nacht über vermisst hatte, ihre Augen aber betonten es fortwährend.
Maura war die Einzige, die sie hin und wieder durch die Nächte begleitete, in denen ich arbeitete. Die beiden gaben sich dann stundenlang esoterischem Schnickschnack hin, legten Karten, pendelten bei Kerzenschein irgendwelche Gegenstände aus oder machten spirituelle Sitzungen mit selbst gehäkeltem Voodoo. Maura war die Tochter eines Professors für Sanskrit, der am Goethe-Institut in Poona arbeitete, und hatte über ihre Familie direkten Kontakt zu den Geschehnissen um Bhagwan Rajneesh und dessen Meditationsveranstaltungen. Das übertrug sich indirekt auch auf uns. Julia war ganz hingerissen von den transzendenten Aspekten, zumal sie ihre sexuelle Phantasie anregten und die Gier nach Vereinigung erklärten.
Auf mich wirkte Maura ziemlich durchgeknallt. Die Art und Weise, wie sie sich betont körperlich exaltierte und Julia in Beschlag nahm, bereitete mir mehr Sorgen, als ich mir eingestehen wollte. In der Tat war es dann auch Maura, die Julia irgendwann den Vorschlag unterbreitete, man könne doch mal ein paar sexuelle Experimente zu dritt angehen, schließlich würden doch viele Männer vom Sex mit zwei Frauen träumen.
Ob sie heimlich in mich verliebt war oder sich mit diesem Vorschlag mehr Julia annähern wollte, wusste ich nicht. Es war für mich durchaus denkbar, dass sie sich heimlich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlte, aber dem klassischen Lesbentyp entsprach sie keinesfalls. Die Sache scheiterte dann auch daran, dass mich Maura körperlich überhaupt nicht reizte, obwohl die Vorstellung an sich auch in meiner Phantasie ihren Platz gehabt hatte. Doch musste ich zugeben, dass mir die reale Umsetzung gedankliche Schwierigkeiten bereitete, was ich so auch Julia erklärte. Ich musste mich auf einen Menschen konzentrieren können.
Aber das, was über Maura in unsere Zweisamkeit floss, tat uns gut. Zumindest das Körperliche genoss ich sehr – der religiös-philosophische Unterbau blieb mir hingegen suspekt. Auch wenn ich versuchte, die transzendenten Aspekte zu berücksichtigen: Für mich stand die Libido im Vordergrund. Das ganze Drumherum, die äußeren Signale und Erkennungszeichen, Kleidung, Farben, Ketten und Symbole, wie sie Jahre später in die Öffentlichkeit getragen wurden, fand ich albern. Auch Julia lehnte es ab, sich nach irgendwelchen festgelegten Regeln zu kleiden. Umso intensiver tauchten wir in einen Strudel sexueller Erforschungen ab und liebten uns danach, weil das Experiment zum Zentrum wurde.
Maura hatte Julia ein Kamasutra geschenkt. Wir beide hatten auch ohne Tantra unseren Spaß und lustige Momente, wenn wir uns durch die miris coitici arbeiteten, die besonderen Vereinigungen, und feststellten, dass die Anatomie unserer Körper bestimmte Stellungen unmöglich erscheinen ließ. Wir lachten uns halb tot über die albernen Namensvergleiche aus der indischen Tierwelt, wenn es um Form und Größe unserer Geschlechtsteile ging, erprobten vorgeschlagenes und dargestelltes Rollenspiel bei der Verführung, wobei wir uns vorstellten, auf der Bühne eines Theaters zu stehen, und steigerten unsere Sprache dabei bis zur Grenze der Lächerlichkeit, vor allem wenn wir uns in der Öffentlichkeit bewegten und ein spontanes Begehren wie die schüchterne Frage nach einer Verabredung formuliert vortrugen.
Es wurde zu unserem Spiel, die umständlich und kompliziert teils prosaisch vorgetragenen Wünsche des anderen dann mit einem banalen eigentlich möchte ich lieber ficken zu beantworten. Und das taten wir dann auch als Erstes, wenn wir wieder zuhause waren.
Von Anfang an war Julia diejenige gewesen, die mich auch in sexuellen Dingen an die Hand genommen hatte. Ich hatte bei ihr keine Gelegenheit gehabt, mich hinter meiner Unerfahrenheit zu verstecken, so stürmisch hatte sie mich geführt. Ich war gerne ihr gelehriger Schüler gewesen. Dabei hatte sie, wie sich schnell herausstellte, kaum mehr Erfahrung als ich, was mich verblüffte.
»Ein Jahr die Pille und wildesten Sex – aber nur im Traum«, gestand sie mir scherzend nach unserem ersten Mal. Nichtsahnend war ich ihrer Einladung auf einen Tee in ihre Wohnung gefolgt, die recht nah bei der Hochschule lag. Noch am Tag unseres überraschenden Wiedersehens, kaum zwei Stunden später.
Endgeschoss in einem Altbau, das man nach dem Krieg provisorisch hergerichtet und mit vereinfachter Dachlandschaft versehen hatte. Zumindest keine Wasserrohre an der Decke und keine feuchten Wände. Ein Flur, in dem man sich verirren konnte, der Fußboden mit Nadelfilz beklebt, davon abgehend ein großer heller Raum, in dem ihr Webstuhl stand, nach vorne hinaus zwei ineinander übergehende kleinere Räume, Plakate und Kerzenlüster an den Wänden, auf dem Boden Matratzen, Kissen und viel Rattan.
Es roch orientalisch. Räucherstäbchen. Sandelholz, wie sie erklärte. Die Küche war ein schmaler Schlauch, am Ende stand noch ein alter Narag-Ofen, wie er früher auch bei uns zu Hause gestanden hatte, zur Seite gab es eine Anrichte, einen Spülstein und einen Kühlschrank mit massiver Hebeltür. Das Bad war dafür umso geräumiger, was daran lag, dass die Toilette in einem eigenen kleinen Kabuff am Ende des Flurs untergebracht war, der hingegen so eng war, dass man sich bei geschlossener Tür kaum darin bewegen konnte. Ein Wendemanöver mit heruntergelassener Hose schien unmöglich. Wenn man sich aufs Klo setzen wollte, betrat man den Raum am besten im Rückwärtsgang.
Mitten im Bad, das wohl zehn Quadratmeter groß sein musste, stand eine alte Badewanne, emailliert mit klassischen Löwenfüßen und ebenso alten Armaturen. Ein wirkliches Schmuckstück, vor allem, weil es darüber noch einen Duschkopf aus glänzendem Messing gab. Der Duschvorhang hing wie ein Baldachin aus gerafftem Chintz von der Decke und konnte mit einer Kette abgesenkt werden. Ich war überwältigt, und weil ich mich das letzte Mal vor zwei Tagen in einem öffentlichen Freibad gewaschen hatte, lag mir die Frage nach einer Dusche förmlich auf den Lippen.
Alles Weitere geschah wie in Trance. Es war ein Überfall, den ich so direkt nicht hatte erwarten können. Kaum stand ich unter der Dusche und hatte mich eingeseift, wurde der Duschvorhang angehoben. Bevor ich überhaupt registrieren konnte, was geschah, stieg Julia nackt zu mir in die Wanne, stellte sich auf die Zehenspitzen und drückte mir blitzschnell ihre Lippen auf den Mund, bevor ich Einspruch hätte einlegen können – was mir allerdings nie in den Sinn gekommen wäre. Sie saugte sich förmlich an meinen Lippen fest und presste ihren Körper voller Inbrunst gegen den meinen.
Ich hatte nicht einmal Gelegenheit, sie zu betrachten. Peinlich berührt, versuchte ich, meine Erektion zu verbergen, aber es war aussichtslos. Je mehr sie sich an mich presste, desto deutlicher wurde mein Erregungszustand, was sie zu amüsieren schien. Ihre Hand tastete erst nach meinem Glied, dann zog sie mich, nass wie wir waren in das kleine Zimmer, in dem sie schlief, schubste mich lachend auf die flache Matratze und deckte mich sogleich mit ihrem Körper zu.
Ich zitterte vor Erregung, bekam kaum Luft. Und sie? Sie gab mir Anweisungen, sagte, was ich tun sollte, redete wie ein Buch. Und ich? Ich folgte ihr. So verlor ich schnell die Scheu und alle Hemmungen, die in mir genistet hatten. Ich vergaß meine Furcht und ich vergaß auch, dass ich mir Sex als etwas Heimliches und Stilles vorgestellt hatte, was ich alles gelesen hatte darüber, welcher selbstkasteienden Ausdauer es bedurfte, das Vorspiel ohne frühzeitigen Erguss zu überstehen, eine Frau bis zum Koitus, bis zur Hemmungslosigkeit erregen zu können.
Papperlapapp. Alles Firlefanz. Zumindest bei Julia. Gewöhnungsbedürftig war ihr herzhaftes und bellendes Lachen, das mich zuerst verunsicherte, als sie zum Höhepunkt kam, an das ich mich aber schnell gewöhnen sollte. Ich hatte dem kaum etwas Adäquates entgegenzusetzen, aber ich begriff, dass es niemandes alleiniger Triumph war, der uns verschmelzen ließ, sondern ausschließlich eine Verzückung des Gemeinsamen. Ihr schien es nicht anders zu ergehen, und diese Erkenntnis stimulierte uns gegenseitig immer wieder aufs Neue bis zur Erschöpfung.
Nun waren es nicht mehr nur ihre Augen, sondern auch der Duft ihrer Haare und das Gefühl ihres geschmeidigen Körpers, die mich in eine Gefühlswelt eintauchen ließen, die ich mir nicht wollüstiger hätte ausmalen können. Überwältigt von der Macht der Ekstase begann ich im Stillen, während sie nackt an meiner Seite schlief, während wir uns liebten, einölten, massierten und badeten, aus Partien ihres Körpers Formen und Strukturen zu entwickeln, die ich in Gedanken auf andere Materialien, zuerst Gips, dann Stein, zu übertragen versuchte.