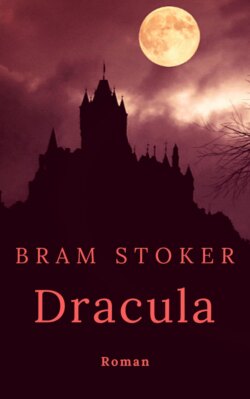Читать книгу Bram Stoker: Dracula - Bram Stoker, Bram Stoker - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
(Fortsetzung)
ОглавлениеAls ich zu der Erkenntnis kam, dass ich ein Gefangener sei, ergriff mich eine Art Raserei. Ich rannte die Stiegen auf und ab, probierte jede Tür und spähte bei jedem Fenster hinaus, das mir erreichbar war; aber bald überkam mich das Bewusstsein meiner vollkommenen Hilflosigkeit. Wenn ich auf die paar Stunden zurückschaue, ist es mir wirklich, als sei ich verrückt gewesen, denn ich benahm mich wie eine Ratte in der Falle. Nachdem ich aber dann die Überzeugung gewonnen hatte, dass meine Lage eine verzweifelte sei, setzte ich mich ruhig nieder – so ruhig, als ich je in meinem Leben etwas getan habe – und sann darüber nach, was nun am besten zu geschehen hätte. Darüber denke ich immer noch nach und bis jetzt zu keinem Resultat gekommen. Eines aber weiß ich gewiss: es wäre vollkommen widersinnig, den Grafen von meinen Plänen etwas merken zu lassen. Er weiß recht wohl, dass er mich gefangen hält; und da er selbst es tut und seine eigenen Beweggründe dafür haben muss, würde er mir höchstens Schwierigkeiten in den Weg legen, wenn ich ihm etwas von meinen Absichten sagen würde. So weit ich es bis jetzt beurteilen kann, ist es das Beste, ich lasse nichts von meinen Erfahrungen und Befürchtungen verlauten und halte die Augen offen. Ich fühle, dass ich entweder von meiner Angst getäuscht werde wie ein kleines Kind, oder aber ich befinde mich in einer verzweifelten Klemme. Und ist dies letztere der Fall, so muss ich, muss unbedingt meinen ganzen Verstand daransetzen, um herauszukommen. Kaum war ich zu diesem Entschluss gelangt, da hörte ich, wie unten die schwere Tür sich schloss, und wusste, dass der Graf heimkam. Da er mich aber nicht in der Bibliothek aufsuchte, ging ich leise in mein Zimmer und traf ihn gerade an, wie er mein Bett in Ordnung brachte. Das war nun sehr merkwürdig, aber es bestätigte mir nur das, was ich mir schon die ganze Zeit gedacht hatte, nämlich dass es keine Dienstboten im Hause gab. Als ich ihn dann durch eine Türspalte das Diner auftragen sah, war ich meiner Sache sicher; denn wenn er diese häuslichen Verrichtungen alle selbst besorgt, so steht doch außer Zweifel, dass er eben niemand dafür hat. Ein jäher Schreck durchfuhr mich, denn wenn niemand im Hause war, dann muss der Graf selbst das Fuhrwerk gelenkt haben, das mich hierher brachte. Ein scheußlicher Gedanke; denn dann hatte er auch Gewalt über die Wölfe, denen er mit einem Wink seiner Hand Stillschweigen gebot. Warum hatten alle Leute in Bistritz und meine Reisegefährten eine so lebhafte Sorge um mich? Was bedeutete es, das man mir das Kruzifix, Knoblauch, wilde Rosen und Ebereschenzweige schenkte? Wie dankbar bin ich der guten alten Frau, die mir den Rosenkranz um den Hals hängte; es ist ein Trost und eine Stärkung für mich, wenn ich ihn berühre. Seltsam, dies Ding, welches ich bisher mit einer gewissen Missachtung als götzendienerisches Symbol zu betrachten gewohnt war, brachte mir nun Hilfe in meiner Einsamkeit und Not. Liegt das in der Beschaffenheit des Dinges selbst oder ist es nur das Medium, das eine trostreiche Erinnerung an das Mitgefühl der Geberin wachruft? Später, wenn es mir noch möglich sein sollte, muss ich doch die Sache eingehend studieren und mir Aufklärung darüber verschaffen. Unterdessen muss ich alles auskundschaften, was Graf Dracula betrifft und mir ein Verständnis seines Wesens aufschließen kann. Heute Abend muss er mir Rede und Antwort stehen, wenn ich das Gespräch auf diese Dinge lenke. Jedenfalls heißt es äußerst vorsichtig sein, um seinen Verdacht nicht wachzurufen.
Mitternacht. – Ich habe lange mit dem Grafen geplaudert. Ich fragte ihn einiges über die Geschichte seines Geschlechtes und Transsylvaniens, und er wurde bei diesem Thema auffallend warm. Seine Erzählungen von Personen, Ereignissen, besonders Schlachten waren so lebhaft, dass man hätte glauben können, er hätte alles selbst mit erlebt. Er erklärte es damit: der Ruhm seines Hauses und seines Namens ist des Bojaren eigener Stolz, ihr Ruhm ist sein Ruhm, ihr Schicksal ist sein Schicksal. Wenn er von seiner Familie spricht, sagt er immer „wir“ und spricht davon im Plural, wie von Königen. Es tut mir leid, dass ich nicht alles genau so niederlegen kann, wie er es erzählte; aber es war äußerst spannend. Die ganze Geschichte seines Landes schien er vor mir aufzurollen. Er sprach immer erregter und ging im Zimmer umher, indem er seinen langen, weißen Schnurrbart strich und seine starken Hände auf verschiedene Gegenstände legte, als wolle er sie zerdrücken. Eines aber, was mir besonders im Gedächtnis haften blieb, möchte ich so wörtlich als möglich wiedergeben; es enthüllt mehr als alles andere die Geschichte seines Geschlechtes:
„Wir Szekler haben ein Recht stolz zu sein, denn in unseren Adern fließt das Blut so mancher tapferen Völker, die wie Löwen um die Herrschaft stritten. Hier in den Wirbel europäischer Rassen trug der ugrische Stamm von Island den wilden Kampfgeist herunter, den Wodan und Tor ihm eingepflanzt hatten. Sie überschwemmten als gefürchtete Berserker die Küsten Europas und die von Asien und Afrika dazu, sodass die Völker dachten, ein Heer von Werwölfen sei eingebrochen. Als sie in dieses Land kamen, trafen sie mit den Hunnen zusammen, deren grausame Kriegslust wie eine lodernde Fackel über die Erde hingefegt hatte, sodass die sterbenden Nationen sich erzählten, sie seien Nachkommen jener Hexen, die einst, aus dem Szythenland vertrieben, sich in der Steppe mit Teufeln paarten. Narren! Narren! Welche Teufel, welche Hexen waren so mächtig als Attila, dessen Blut in diesen Adern kreist?“ Er reckte seine Arme aus. „Ist es ein Wunder, dass wir ein Erobererstamm, dass wir stolz sind, dass wir die Horden der Magyaren, der Lombarden, der Avaren, der Bulgaren und der Türken, die gegen unsere Grenzen anrückten, in die Flucht trieben? Ist es zu verwundern, dass die Honfoglalas ein Ende fand, als Arpad mit seinen Legionen hier an der Grenze auf uns traf? Als die Flut der Ungarn sich wieder ostwärts verlief, wusste man, dass die Szekler mit den siegreichen Magyaren verbündet waren, und auf Jahrhunderte hinaus wurde uns der Schutz der Grenze gegen die Türken anvertraut; und es war keine leichte Aufgabe, denn wie der Türke sagt: ›Das Wasser schläft, aber der Feind schläft nicht.‹ Wer hätte stolzer auf das von den vier Nationen anvertraute ›blutige Schwert‹ sein können als wir, wer eilte auf ihren Kriegsruf schneller zu den Fahnen des Königs? Dann kam die große Schmach unseres Volkes, die Schmach von Cassova. Wer war es, der als Woiwode die Donau überschritt und die Türken auf eigenem Boden schlug, als die Banner der Walachen und Magyaren vor dem Halbmond in den Staub sanken? Wer anders als einer meines Geschlechtes, ein Dracula! Aber, als er gefallen war, da verkaufte sein eigener unwürdiger Bruder das Volk an die Türken zu schmachvoller Knechtschaft. War es nicht dieses Draculas Geist, der einen Späteren seines Namens immer und immer wieder über den breiten Strom in der Türkei einfallen ließ? Zurückgetrieben, kehrte er als Einziger von der blutigen Wahlstatt heim, auf der sein Stamm niedergemetzelt worden war, und dennoch kehrte er wieder, denn er wusste, dass nur er allein den Sieg erzwingen könne. Man sagt ihm nach, dass er nur an sich allein denke. Bah, was taugt ein Kriegsvolk ohne Führer? Welchen Zweck hat ein Krieg, wenn nicht ein Kopf und ein Herz da sind, ihn zu führen? Dann, als wir nach der Schlacht von Mohacs das ungarische Joch abschüttelten, da waren wieder wir aus dem Blute der Dracula die Führer, denn unser stolzer Geist konnte das Bewusstsein nicht tragen, unfrei zu sein. Ja, junger Herr, die Szekler und die Draculas – ihr Herzblut, ihr Gehirn, ihr Schwert – können sich einer Vergangenheit rühmen, wie keines der Emporkömmlingsgeschlechter der Romanows oder Habsburger. Die kriegerischen Zeiten sind vorbei. Blut ist ein zu kostbar Ding in diesen Tagen jämmerlichen Friedens; und der Ruhm großer Geschlechter ist nur mehr wie ein Märchen, das man erzählt.“
Es war fast wieder Morgen geworden und wir gingen zu Bett. (Anm. Das Tagebuch ähnelt erschreckend den Erzählungen aus „Tausend und eine Nacht“ oder der Geschichte mit Hamlets Vater; mit dem Hahnenschrei schließt es jedes Mal.)
12. Mai. – Ich beginne mit Tatsachen, reinen, nackten Tatsachen, die durch Bücher und Zahlen dargetan werden und an denen nicht gezweifelt werden kann. Ich darf sie nicht mit eigenen Beobachtungen und Erfahrungen vermischen. Als der Graf am letzten Abend aus seinem Zimmer kam, begann er mich sofort über juristische Dinge auszufragen und über die Schritte, die er zur Ausführung seiner Absicht zu tun habe. Ich hatte den ganzen Tag fleißig über den Büchern verbracht und war, um nicht unbeschäftigt zu sein, auf die Idee gekommen, einiges zu wiederholen, was mir bei der Prüfung auf der Rechtsschule vorgelegt worden war. Es lag eine eigene Methode in den Fragen des Grafen und ich werde deshalb versuchen, sie möglichst der Reihe nach wiederzugeben; vielleicht sind mir diese Notizen irgendwo und irgendwann von Nutzen.
Zuerst fragte er mich, ob es in England gestattet sei, zwei oder mehr Sachwalter für seine Geschäfte zu haben. Ich sagte ihm, er könne ein ganzes Dutzend anstellen, wenn es ihm beliebe, aber dass es nicht sehr klug wäre, mehr als einen Advokaten in seiner Angelegenheit zu engagieren, denn es könne doch immer nur einer wirklich tätig sein, und ein Wechsel würde den Interessen direkt zuwiderlaufen. Er schien vollkommen zu verstehen und fragte dann weiter, ob es z.B. zweckmäßig wäre, einen Sachwalter für Geldsachen, einen anderen für Schifffahrtsangelegenheiten zu bestellen, falls irgendwo ein lokales Eingreifen nötig sei, was durch die große Entfernung des Sachwalters erschwert würde. Ich bat ihn, sich noch klarer auszudrücken, sodass absolut keine Gefahr bestünde, von mir falsch informiert zu werden, und er sagte darauf:
„Ich will es durch ein Beispiel illustrieren. Unser gemeinsamer Freund, Peter Hawkins, kauft von seinem Büro im Schatten Ihrer herrlichen Kathedrale von Exeter aus durch Ihre gütige Mithilfe für mich ein Grundstück in London. Gut. Sie können mir ja einwerfen, dass ich einen Sachwalter hätte nehmen müssen, der in London selbst wohnt; ich muss Ihnen aber offen gestehen, mir lag es daran, dass mein Bevollmächtigter absolut durch nichts anderes geleitet werden sollte als durch meine speziellen Wünsche. Nachdem es ja nicht ausgeschlossen erscheint, dass ein Londoner Advokat dabei seine oder seiner Freunde Interessen im Auge haben könnte, beschloss ich, mir einen solchen aus der weiteren Umgegend von London zu wählen, dessen Arbeit allein in meinem Interesse geschähe. Nun nehme ich an, ich will per Schiff Güter nach Newcastle oder Durham oder Harwich oder Dover transportieren lassen – und das ist bei der Ausdehnung meiner Geschäfte nicht ausgeschlossen – wäre es da nicht besser, meine Angelegenheiten durch einen am betreffenden Ort ansässigen Agenten besorgen zu lassen?“ Ich erwiderte, dass die Sache ohne Zweifel ihre guten Seiten habe, aber auch, dass wir Advokaten einen Interessenverband bildeten und einer für den anderen die Erledigung lokaler Angelegenheiten übernähme. Für seinen Zweck würde es auch genügen, seinen Sachwalter einfach mit der Sache zu beauftragen; die betreffenden Wünsche würden dann auf dem genannten Wege erfüllt.
„Ganz recht“, antwortete er, „aber ich hätte dann doch mehr Freiheit in meinen Anordnungen. Finden Sie das nicht auch?“
„Allerdings“, entgegnete ich, „und manche Geschäftsleute machen es so, die ihre Gründe dafür haben, nicht alle ihre Angelegenheiten einer einzigen Person anzuvertrauen.“
„Gut“, sagte er und fuhr dann weiter fort über die Art, wie man am besten Schiffstransporte einleite und welche Formalitäten zu erfüllen wären. Er gedachte aller Schwierigkeiten, auf die sein Unternehmen eventuell stoßen könnte und wie solchen am vorteilhaftesten zu begegnen wäre. Ich klärte ihn nach meinem besten Wissen über alle diese Dinge auf und gewann schließlich den Eindruck, dass er selbst einen vorzüglichen Advokaten abgegeben hätte, denn es gab nichts, woran er nicht gedacht, was er nicht in den Kreis seiner Erwägungen gezogen hätte. Dafür, dass er noch nie in meinem Lande gewesen und offenbar wenig mit Geschäftsangelegenheiten zu tun hatte, waren seine Kenntnisse und sein Scharfsinn geradezu erstaunlich. Als er sich über alles, was er wissen wollte, hinreichend informiert zu haben schien und ich meine Angaben an der Hand der verfügbaren Bücher so gut als möglich nachgeprüft hatte, stand er plötzlich auf und sagte:
„Haben Sie schon an unsern Freund Peter Hawkins geschrieben?“ Mit einer gewissen Bitterkeit antwortete ich, dass dies doch nicht geschehen sei, da ich zur Absendung des Briefes ja noch keine Gelegenheit gehabt hätte.
„Dann schreiben Sie gleich jetzt, mein junger Freund“, sagte er, indem er seine Hand schwer auf meine Schulter legte, „schreiben Sie an unsern Freund und an wen Sie wollen und teilen Sie mit, dass Sie wenigstens noch einen Monat hier zu verweilen gedenken.“
„Wollen Sie absolut, dass ich noch so lange bleibe?“, fragte ich, und es überlief mich kalt bei diesem Gedanken.
„Ich wünsche es nicht nur; ich würde es Ihnen sogar übel nehmen, wenn Sie früher fort wollten. Wenn ihr Herr und, wenn Sie wollen, Meister jemand zu seiner Vertretung schickt, so glaube ich doch wohl, dass meine Bedürfnisse in erster Linie in Betracht kommen. Ich habe doch keinen Termin bestimmt. Ist es nicht so?“
Was wollte ich anders tun als Ja sagen? Es war Herrn Hawkins Sache und nicht meine, ich musste für ihn handeln, nicht für mich. Außerdem lag in Draculas Augen und in seinem Benehmen etwas, was mich daran erinnerte, dass ich sein Gefangener war und dass mir ja doch keine Wahl geblieben wäre. Der Graf sah seinen Sieg in meiner zustimmenden Verbeugung und in der Erregung meiner Gesichtszüge, denn er begann in seiner verbindlichen, aber unwiderstehlichen Art:
„Ich bitte Sie, lieber junger Freund, dass Sie in Ihren Briefen nur Geschäftliches berühren, außerdem wird es Ihren Freunden doch ohne Zweifel lieb sein zu erfahren, dass es Ihnen gut geht und dass Sie sich darauf freuen, sie wiederzusehen.“ Nachdem er das gesagt hatte, gab er mir drei Briefbogen und drei Kuverts. Sie waren von dünnstem Überseepapier; ich sah auf die Briefbogen, dann auf ihn und bemerkte sein ruhiges Lächeln, das die scharfen weißen, über die Unterlippe ragenden Hundezähne entblößte. Da ward es mir klar, was er damit sagen wollte, ich solle recht vorsichtig mit meiner Korrespondenz sein, da er alles lesen könne. Ich beschloss daher, Herrn Hawkins und Mina einige formelle Zeilen zu schreiben, dann aber im geheimen ihm meine Lage genau zu schildern, ebenso Mina; letzterer Brief sollte stenografisch abgefasst werden; der Graf sollte ihn wenigstens nicht lesen können, wenn er in seine Hände fiele. Als ich meine zwei Briefe geschrieben hatte, saß ich eine Weile still und las in einem Buche, während der Graf einige Zeilen schrieb, anscheinend Notizen aus einem vor ihm liegenden Heft. Dann nahm er meine zwei Briefe und legte sie zu den seinen, nachdem er das Schreibzeug wieder in Ordnung gebracht. Er verließ das Zimmer und ich benützte rasch die Gelegenheit, nach den Adressen seiner Briefe zu sehen, die umgekehrt auf dem Tische lagen. Ich machte mir kein Gewissen aus diesem Vertrauensbruche, denn unter den gegebenen Umständen hielt ich alles für erlaubt, wodurch ich mich vielleicht retten konnte. Der eine war an Herrn Samuel F. Billington, No. 7, The Crescent, Whitby, der andere an Herrn Leutner, Varna, gerichtet; der dritte trug die Adresse: Coutts & Co., London, der vierte die der Bankiers Kloppstock & Billreuth, Budapest. Der zweite und der vierte waren noch nicht geschlossen. Eben wollte ich nach ihrem Inhalt sehen, da bemerkte ich, dass sich die Türklinke bewegte. Rasch ließ ich mich auf meinen Stuhl zurückfallen, nachdem ich gerade noch Zeit gehabt hatte, die Briefe wieder in ihre ursprüngliche Ordnung zu bringen und mein Buch zu ergreifen, ehe der Graf, der einen Brief in der Hand trug, ins Zimmer trat. Er nahm die Briefe vom Tisch, verschloss sie sorgfältig und wandte sich dann an mich:
„Ich hoffe, Sie werden es mir nicht verübeln, aber ich habe heute Abend in dringenden Privatangelegenheiten zu tun. Sie werden, denke ich, alles finden, was Sie brauchen.“ An der Tür drehte er sich noch einmal um und sagte nach kurzer Pause:
„Lassen Sie sich raten, lieber junger Freund – nein, lassen Sie sich lieber in allem Ernst davor warnen, in einem anderen Teile des Schlosses zu schlafen, wenn Sie überhaupt die Absicht haben, aus diesen Zimmern zu gehen. Das Schloss ist alt und hat eine seltsame Vergangenheit; schlechte Träume haben die, welche unvorsichtig zur Ruhe gehen. Also seien Sie gewarnt! – Sollte der Schlaf Sie jetzt oder irgendwann übermannen, so eilen Sie sofort in ihr Schlafzimmer oder in eines dieser Gemächer, dann ist Ihre Ruhe gesichert. Sind Sie aber unvorsichtig in dieser Beziehung, dann –“ Er schloss seine Rede in unheimlicher Weise, indem er seine Hände rieb, als wollte er sich waschen. Ich verstand ihn vollkommen, aber ich zweifelte daran, dass irgend ein Traum scheußlicher sein konnte als dieses unnatürliche, grauenhafte Netz von Geheimnissen, das sich um mich zusammenzuziehen schien. Später. – Ich bestätige diese letzten Worte, denn jetzt kann kein Zweifel mehr bestehen. Ich fürchte mich nicht mehr, an einem Platze einzuschlafen, wo „er“ nicht ist. Meinen Rosenkranz habe ich über meinem Bette aufgehängt – ich glaube, so ist meine Ruhe freier von Träumen, und dort soll er bleiben.
Als der Graf mich verließ, zog ich mich in mein Zimmer zurück. Nach einer kleinen Weile, da ich keinen Laut mehr hörte, trat ich heraus und ging die steinerne Stiege hinauf, von wo ich den Ausblick nach Süden hatte. Es lag wie ein Schimmer der Freiheit über der weiten Ebene, die mir doch unerreichbar war; ein schmerzlicher Gegensatz zu der dunklen Enge des Schlosshofes. Wenn ich auf diesen hinaussah, hatte ich tatsächlich das Gefühl, Gefangener zu sein, und mir war, als müsste ich mir die Brust voll frischer Luft trinken, und sei es auch nur die der Nacht. Ich fühle, dass diese Nachtexistenz mir schadet, dass sie meine Nerven zerstört. Ich erschrecke vor meinem eigenen Schatten und leide an den schrecklichsten Gesichten. Gott weiß, dass auf diesem verwünschten Platz Grund zu jeglicher Sorge gegeben ist. Ich sah hinaus in die wundervolle Weite, die sanftes, gelbliches Mondlicht taghell überflutete. In dem ungewissen Lichte verschwammen die Umrisse der fernen Hügel, und die Schatten in den Tälern und Schluchten waren von samtartiger Schwärze. Schon der Anblick dieser Schönheit gab mir Mut; mit jedem Atemzuge sog ich Frieden und Trost ein. Als ich mich etwas aus dem Fenster lehnte, wurde mein Blick durch etwas gefesselt, das sich ein Stockwerk tiefer, links von mir bewegte; nach der Lage der Zimmer mussten sich hier die Fenster des Grafen befinden. Das Fenster, an dem ich stand, war hoch und tief und mit steinernem Maßwerk verziert, das, obgleich verwittert, dennoch ganz gut erhalten war. Es mochte eine stattliche Reihe von Jahren her sein, dass jemand hier hinausgeschaut. Ich versteckte mich hinter einen Fensterpfeiler und sah gespannt hinaus.
Das erste, was ich sah, war der Kopf des Grafen, der eben aus dem Fenster auftauchte. Ich sah das Gesicht nicht, aber ich kannte den Nacken und die Bewegung des Rückens und der Arme. Am wenigsten konnte ich über die Hände im Zweifel sein, die zu studieren ich ja schon reichlich Gelegenheit gehabt hatte. Zuerst war ich voll Interesse, fast belustigt, denn es ist eigenartig, welche Kleinigkeiten einen Gefangenen interessieren und belustigen können. Aber diese Gefühle verwandelten sich in Abscheu und Entsetzen. Ich sah, wie sich der ganze Körper aus dem Fenster zwängte und, mit dem Kopf nach abwärts, an der Schlossmauer über den fürchterlichen Abgrund hinunterkletterte; sein Mantel schlang sich um ihn wie ein Paar großer Flügel. Erst traute ich meinen Augen nicht. Ich dachte, es wäre eine Täuschung durch das Mondlicht, irgend ein toller Schatteneffekt; ich sah genau hin – es war kein Irrtum möglich. Ich sah die Finger und Zehen sich in die Mauerritzen klammern, die der Zahn der Zeit des Mörtels beraubt hatte; er kletterte so mit beträchtlicher Geschwindigkeit abwärts, indem er sich die kleinste Unebenheit zunutze machte, wie ein Marder, der eine Mauer hinuntersteigt.
Was ist das für ein Mensch, oder vielmehr, was ist das für eine Kreatur, die hier in Menschengestalt sich verbirgt? Das Entsetzen vor diesem schreckensvollen Platze überwältigt mich, ich fühle es; ich bin in Angst, in schrecklicher Angst und sehe keinen Ausweg; ich bin von Gefahren umgeben, an die ich gar nicht denken darf.
15. Mai. – Noch einmal sah ich den Grafen in dieser marderartigen Weise das Schloss verlassen. Er stieg schräg hinunter, wohl hundert Fuß tief und etwas nach links. Dann verschwand er in einer Höhle oder einem Fenster. Als sein Kopf nicht mehr sichtbar war, lehnte ich mich hinaus, um mehr zu sehen, aber ohne Erfolg; die Entfernung war zu groß. Ich wusste nun, dass er das Schloss verlassen habe, und gedachte diese Gelegenheit auszunützen, um mehr auszuforschen, als mir bis jetzt gelungen war. Ich ging in mein Zimmer zurück, holte meine Lampe und probierte eine Tür nach der anderen. Sie waren alle, wie ich es nicht anders erwartet hatte, verschlossen und die Schlösser waren verhältnismäßig neu; dann stieg ich die Steintreppe hinunter und gelangte zu der großen Halle, durch die ich meinen Einzug ins Schloss gehalten hatte. Ich vermochte die Riegel leicht zurückzuschieben und die Ketten auszuhängen, aber das Tor war verschlossen und der Schlüssel fehlte! Dieser musste in des Grafen Zimmer sein, es galt also zu versuchen, ob seine Tür verschlossen sei, sodass ich ihn dort holen und entfliehen könnte.
Ich unternahm eine gründliche Besichtigung der verschiedenen Treppen und Gänge und versuchte, welche der Türen sich etwa öffnen ließe. Einige kleine Zimmer zunächst der Halle waren offen, aber es war nichts in ihnen als altes Mobiliar, grau verstaubt und mottenzerfressen. Schließlich fand ich aber doch eine Tür am Ende der Treppe, die zwar verschlossen schien, aber doch unter meinem Druck etwas nachgab. Ich versuchte es stärker und fand, dass sie nicht eigentlich verschlossen war; der Widerstand rührte daher, dass die Türangeln sich gesenkt hatten und der Türflügel nun am Boden streifte. Das war nun eine Möglichkeit, wie sie sich so rasch nicht mehr bot; ich nahm meine ganze Kraft zusammen und vermochte auch die Tür so weit zu öffnen, dass ich eintreten konnte. Ich befand mich hier in dem Flügel des Schlosses, der rechts von den mir bekannten Räumen sich hinzog, aber ein Stockwerk tiefer. Ich sah aus dem Fenster und erkannte, dass diese Zimmerreihe den südlichen Teil des Schlosses bildete; das letzte Zimmer hatte Fenster nach Süden und Westen.
Nach beiden Seiten hin sah man in einen tiefen Abgrund. Das Schloss war auf einer Felszunge aufgebaut, sodass es von drei Seiten aus unzugänglich war. Hier, wohin weder Schleuder, noch Bogen, noch Feldschlange reichten, waren große Fenster angebracht; das Zimmer, das gegen keinen feindlichen Angriff gesichert werden musste, war licht und schön. Gegen Westen zu dehnte sich ein weites Tal, und ferne, ganz ferne erhoben sich gezackte Felswälle, Gipfel an Gipfel; die steilen Wände waren bewachsen mit Bergesche und Dorngestrüpp, deren Wurzeln sich in den Spalten und Rissen und Ritzen des Gesteines festklammerten. Hier war ich offenbar in dem vor Zeiten bewohnten Teil des Schlosses, denn die Möbel waren bequemer, als ich sie bisher gesehen hatte. Die Fenster waren ohne Vorhänge; das gelbe Mondlicht flutete breit durch die kristallklaren Scheiben und man konnte sogar Farben erkennen. Dabei machte es den Staub, der über allem lag, weniger bemerkbar und verwischte einigermaßen die Spuren der Zeit und der Motten. Meine Lampe schien nur klein zu brennen in dem glänzenden Mondschein, aber ich war froh um sie, denn es lag eine schreckliche Einsamkeit über dem Raume, die mir das Herz zusammenzog und meine Nerven erzittern machte. Übrigens war es mir hier viel wohler als allein in meinem Zimmer, das mir durch des Grafen Gegenwart verleidet worden war; meine nervöse Erregung legte sich und eine wohltuende Ruhe kam über mich. Hier sitze ich nun an einem kleinen eichenen Tisch, an dem vor alters vielleicht manches hübsche Fräulein mit vielen Gedanken und vielem Erröten sein unorthografisches Liebesbriefchen kritzelte, und schreibe stenografisch in mein Tagebuch, alles, was mir seit meiner letzten Eintragung passiert ist. Wir leben also wirklich im neunzehnten Jahrhundert? Und doch, wenn mich meine Sinne nicht trügen, hatten und haben die vergangenen Jahrhunderte ihren eigenen Reiz, den „Modernität“ allein nicht zu überbieten vermag.
Später. – Morgen des 16. Mai. – Gott schütze meinen Verstand, das ist alles, was ich noch sagen kann. Sicherheit und Sicherheitsgefühl sind für mich vergangene Dinge. Solange ich noch hier lebe, hoffe ich nur eines: dass ich nicht wahnsinnig werde – wenn ich es nicht schon bin. Wenn ich aber noch bei Sinnen, dann ist der Gedanke geeignet, einen verrückt zu machen, dass von all den scheußlichen Dingen, die an diesem verhassten Ort spuken, der Graf noch lange nicht das schrecklichste ist; nur bei ihm finde ich Schutz und sei es auch nur so lange, als ich seinen Zwecken diene. Großer Gott! Gnädiger Gott! Lass mich Ruhe bewahren, denn sonst ist Wahnsinn mein Los. Ich gewinne nun Klarheit über einige Dinge, die mir schon Kopfzerbrechen gemacht haben. Bis heute verstand ich nicht, was Shakespeare meinte, wenn er Hamlet sagen ließ:
„Mein Buch! Nur schnell mein Schreibbuch her,
’s ist Zeit, dass ich das alles niederschreibe“,
aber jetzt, da ich das Gefühl habe, als ginge mein Gehirn aus den Fugen, als wäre ein vernichtender Schlag darauf gefallen, greife ich wieder zu meinem Tagebuch. Die strikte Gewohnheit, pünktliche Eintragungen zu machen, soll meine Angst etwas ablenken.
Des Grafen geheimnisvolle Warnung hatte mich schon erschreckt, als er sie aussprach; noch mehr erschreckt sie mich jetzt, wenn ich daran denke, dass der Graf mich wohl in Zukunft in noch strengerem Gewahrsam halten wird. Ich werde mich hüten, noch einmal Zweifel in seine Worte zu setzen.
Als ich mein Tagebuch geschrieben und zufrieden Buch und Stift in meine Tasche gesteckt hatte, überkam mich eine bleierne Schläfrigkeit. Des Grafen Warnung fiel mir ein, aber ich fand eine Freude daran, ihr nicht Gehör zu geben. Es war der mit dem Gefühl der Schläfrigkeit meist verbundene Starrsinn, der mich so handeln ließ. Das sanfte Mondlicht wirkte beruhigend auf mich ein und die weite Aussicht täuschte mir wohltuend die Freiheit vor. Ich gedachte heute Nacht nicht zu den düsteren, spukerfüllten Gemächern zurückzukehren, sondern hier zu schlafen, wo vor Zeiten wohl die Schlossfrauen saßen und sangen und dem Müßiggang sich ergaben, während sie mit vor Sehnsucht erfüllten Herzen der Heimkehr ihrer Männer warteten, die draußen in grausamen Kriegen kämpften. Ich zog mir einen großen Lehnstuhl aus dem Winkel und stellte ihn so, dass ich liegend die herrliche Aussicht nach Süden und Osten genießen konnte; dann richtete ich mich, ohne an Weiteres zu denken und ohne des dicken Staubes zu achten, zum Schlafen ein.
Ich vermute, dass ich auch wirklich eingeschlafen bin; ich hoffe es, aber ich fürchte, es war doch nicht der Fall; denn das, was nun folgte, war so natürlich, so erschreckend natürlich, dass ich jetzt im vollen, frohen Morgensonnenschein nicht glauben kann, das alles nur geträumt zu haben.
Ich war nicht allein; das Zimmer war dasselbe, völlig unverändert, genau so wie ich es betreten hatte; ich konnte den Korridor entlang meine Fußspuren sehen, die ich in die langjährige Staubschicht getreten. Im klaren Mondlicht standen mir gegenüber drei Frauen, ihrer Kleidung und ihrem Benehmen nach Damen. Zugleich dachte ich doch wieder zu träumen, denn sie warfen keinen Schatten und das Licht des Mondes leuchtete durch ihre Leiber. Sie näherten sich mir, betrachteten mich eine Weile und flüsterten dann miteinander. Zwei von ihnen waren dunkelhaarig und hatten hohe Adlernasen wie der Graf, und große, durchdringende, schwarze Augen, die in dem bleichen Mondenschein fast rot aussahen. Die dritte war hübsch, so hübsch, als man es sich nur denken kann, mit dichtem goldenen Wellenhaar und Augen gleich hellen Saphiren. Ich meinte, ihr Gesicht schon irgendwo einmal gesehen zu haben, aber es war mir nicht klar, wann und wo. Vielleicht bei einer von mir im Traume erlebten Gefahr. Alle drei hatten blendend weiße Zähne, die wie Perlen zwischen den Rubinen ihrer wollüstigen Lippen hervorglänzten. Sie hatten etwas an sich, das mir Unbehagen verursachte; ich verlangte nach ihnen und fühlte dennoch Todesangst. Ich empfand in meinem Herzen ein wildes, brennendes Begehren, dass sie mich mit ihren roten Lippen küssen möchten. Ich schreibe dies nicht gerne nieder, da vielleicht einmal Mina diese Zeilen lesen und Schmerz darüber empfinden könnte; aber es ist die Wahrheit. Sie flüsterten miteinander und dann lachten sie; ein silbernes, tönenden Lachen, aber so hart, dass es unmöglich war zu glauben, diese metallischen Klänge kämen von menschlichen, zarten Lippen. Es war wie das unerträgliche, zitternde Singen, das Wassergläser hervorbringen, wenn man ihren Rand reibt. Das schöne Mädchen schüttelte kokett ihre Locken, die beiden anderen drängten sie an mich heran. Eine sagte:
„Geh zu, du bist die erste, und wir kommen nach dir an die Reihe; du hast das Recht anzufangen.“ Die andere fügte hinzu:
„Er ist jung und stark; das gibt Küsse für uns alle.“ Ich lag still und blinzelte nur unter meinen Lidern hervor, halb in Todesangst, halb in wonniger Erwartung. Das schöne Weib kam heran und beugte sich über mich, bis ich ihren Atem fühlte. Er war süß, honigsüß, und jagte mir dieselben Schauer durch die Nerven wie ihr Lachen; dennoch roch man etwas Bitteres und Abstoßendes durch ihren Atem – wie Blut. Ich scheute mich die Augen zu öffnen, schielte aber nach den Frauen und konnte sie deutlich erkennen. Das schöne Mädchen beugte sich über mich, indem sie sich auf die Knie niederließ und mir starr in die Augen sah. Es war eine wohlberechnete Wollüstigkeit, die anziehend und abstoßend zugleich wirkte, als sie ihren Nacken beugte, leckte sie ihre Lippen wie ein Tier, sodass ich im Licht des Mondes den Speichel auf ihren Scharlachlippen, ihrer roten Zunge und ihren weißen Zähnen erglänzen sah. Immer tiefer beugte sie sich herab, streifte mir an Mund und Kinn vorbei und näherte sich meiner Kehle, an der ich ihren heißen Hauch verspürte. Ich hörte saugende Laute, als sie einen Augenblick einhielt und sich Zähne und Lippe leckte. Dann hatte ich das eigentümliche Gefühl am Halse, das man empfindet, wenn eine Hand, die einen kitzeln will, näher kommt, immer näher… Ich fühlte erst die zarte, zitternde Berührung ihrer weichen Lippen auf der überempfindlichen Haut meiner Kehle und dann die harten Spitzen zweier scharfen Zähne, die mich berührten und darauf innehielten. Ich schloss die Augen in schlaffer Verzückung und wartete… wartete mit bangem Herzen.
Da, in diesem Augenblick, schoss mir ein anderes Gefühl wie ein Blitz durch den Leib. Ich fühlte die Nähe des Grafen, der in einem Sturm von Erregung herangekommen zu sein schien. Meine Augen öffneten sich unwillkürlich, ich sah, wie seine Hand den weißen Nacken der schönen Frau ergriff und sie mit Riesenkraft zurückriss. Ihre blauen Augen waren wie verstört vor Wut, ihre Zähne knirschten und ihre feinen Wangen waren gerötet vor Leidenschaft. Und erst der Graf! Nie sah ich einen solchen Grimm, eine solche Wut. Der reine Dämon der Hölle! Seine Augen sprühten förmlich Flammen. Das rote Licht in ihnen brannte, als ob die ganze Glut des höllischen Feuers hinter ihnen lodere. Sein Gesicht war totenbleich, die Züge hart wie aus Stein gemeißelt; die dicken Augenbrauen, die sich über der Nase trafen, waren wie Barren weißglühenden Metalls. Mit einer stolzen Geste wies er das Mädchen von sich und ging dann auf die anderen zu, als wolle er sie zurücktreiben; es war dieselbe gebieterische Armbewegung, wie er sie den Wölfen gegenüber angewandt hatte. Mit einer Stimme, die, obgleich leise und fast geflüstert, dennoch die Luft zu durchschneiden und an den Wänden widerzuhallen schien, sagte er:
„Wie kann es eine von euch wagen, ihn anzurühren? Wie könnt ihr eure Augen auf ihn werfen, da ich es euch doch verboten habe? Zurück! sage ich euch. Dieser Mann ist mein. Hütet euch, dass ich euch nicht noch einmal bei ihm treffe, oder ihr habt meinen Zorn zu fürchten!“ Das schöne Mädchen erwiderte mit einem gemeinen, koketten Lachen:
„Du hast nie geliebt und wirst nie lieben!“ Darauf mischten sich die anderen Mädchen ein und es ertönte ein so trauriges, hartes, seelenloses Lachen, dass mir fast die Sinne schwanden; es war, als wenn Teufel scherzten. Dann drehte sich der Graf um, sah mich eine Weile aufmerksam an und sagte im leisesten Flüstertone:
„Ja, und ich kann doch lieben; ihr könnt doch selbst davon erzählen, von dem, was nun vorgegangen ist. Ist es nicht so? Gut, ich verspreche euch, dass, wenn ich genug von ihm habe, ihr ihn nach Gefallen küssen könnt. Aber jetzt geht! Geht nur! Ich muss ihn aufwecken, denn es gibt heute noch vieles zu tun.“
„Und sollen wir für den Abend leer ausgehen?“, sagte eine von ihnen mit leisem Lachen und deutete auf ein Bündel, das er auf die Erde geworfen hatte und das sich bewegte, als sei etwas Lebendes darinnen. Zur Antwort schüttelte er den Kopf. Eines der Mädchen sprang hinzu und öffnete das Bündel; wenn meine Ohren mich nicht täuschten, hörte ich das Stöhnen und leise Wimmern eines halberstickten Kindes. Die Mädchen drängten sich heran, während ich vor Schrecken starr wurde; aber als ich näher hinsah, verschwanden sie und mit ihnen das schreckliche Bündel. Es befand sich keine Tür in ihrer Nähe, und an mir konnten sie nicht vorbeigekommen sein, ohne dass ich es bemerkt hätte. Sie schienen einfach in den Strahlen des Mondes zu zerfließen und durch das Fenster zu entweichen, denn ich konnte außen noch einen Augenblick ihre unbestimmten schattenhaften Umrisse erkennen, ehe sie vollkommen verschwanden. Dann überwältigte mich das Grauen und ich verlor das Bewusstsein.