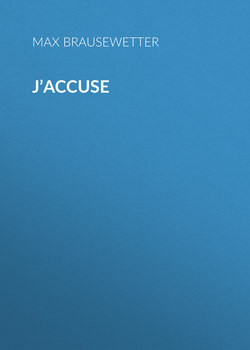Читать книгу J’accuse - Brausewetter Max - Страница 3
Frioul I
ОглавлениеUnd ob das Meer nach Unrat roch,
Und ob sich unsre Fäuste ballten,
Zwang man uns in das gleiche Joch
Mit zweifelwürdigen Gestalten,
Und regnet’s durch manch Mauerloch
Auf Stroh und Decken, durch die Spalten,
—
Da in Frioul hat man uns doch
Für Menschen immerhin gehalten.
Abends fahren wir in Frioul ein. Geduld! Es kann ja nur noch für wenige Tage sein. Die Kommissäre haben es uns versichert, daß die Austauschverhandlungen noch in vollem Gange seien, und daß es nur wenige Tage noch dauern würde, bis wir zu Hause wären. Und wir wappnen uns mit neuer Geduld und stärken uns mit neuer Hoffnung. Vielleicht werden wir auch nur nach Frioul geschafft, weil wir von da leichter transportiert werden können. Frioul ist Quarantänestation für Marseille. Sei dem wie es wolle, vorläufig landeten wir in einer Bucht der Insel, marschierten auf die andere Seite der Bucht und zogen nach dem Anschauen eines riesigen Kochtopfes mit Linsen, die wir hatten schleppen müssen, von denen wir aber nichts zu essen erhielten, knurrenden Magens in den großen Quarantäneschuppen, dessen Anblick uns erschauern machte. Dreckiger Steinfußboden, Holzwände, die überall schadhaft sind, so daß der Wind durch die Hallen pfeift. Unser Abendessen ist Brot, ein bißchen Wein geben die Soldaten, Stroh und Decken werden verteilt, wir suchen müde einen Platz, der nicht zu sehr von Schmutz strotzt und der auch nur einigermaßen geschützt ist. Aber wo den finden? Der Sergeant hat die Krätzekranken abgesondert, und die haben dadurch den einzigen Platz erhalten, wo pritschenartig einige Holzbetten sich über dem Fußboden erheben. Der Platz ist zu schön und einladend, und ich schlage Moritz und Bonitz vor, wir wollen uns zu den Krätzekranken legen. Ich mußte fast lachen, als ich, wie ich es ja bei dem sonderbaren Vorschlag erwarten konnte, ihre entrüsteten Gesichter sah; aber Not bricht Eisen, und als ich ihnen auseinandersetzte, daß wir hier wenigstens die Krätzemilben sehen oder ihren Aufenthaltsort kennen, die Bakterien am schmutzstarrenden Fußboden und die Ungeziefer aber nicht, daß diese geradeso todsicher da wären wie die Krätzemilben, da wirkten so schlagende Gründe, und sie ergaben sich, wie ich, in das rauhe Kriegsgeschick. Wir nahmen Platz neben den Krätzekranken und baten sie nur, einen Isolierraum zwischen uns zu lassen. So schliefen wir auf hartem Lager, eingewiegt von der einen großen Hoffnung: Morgen ist Sistertag, da wird man uns holen und uns die Freiheit wiedergeben. Nach Deutschland! Schon ist fast ein Monat vergangen, und ewig wird die Gefangenschaft ja nicht dauern. Ja, wenn das da nicht wäre, diese sichere Aussicht, die doch nicht täuschen kann – Gute Nacht, und morgen – !!
Montag! – Es war ein jämmerliches Erwachen am nächsten Morgen. Wie ein Alp drückend legte sich das allmähliche neue Begreifen unserer elenden Lage auf die Brust. Nicht möglich, so kann es nicht fortgehen. Ein Ende muß geschaffen werden! Und wieder stand das Gespenst der Verzweiflung vor uns. Heulender Sturm draußen. Wir wollen heraus, müssen aber wieder zurück. Die „Sister“ kommt nicht, wir sehen nichts von ihr. Vielleicht, daß der Sturm sie zurückgehalten, vielleicht, daß sie in die Bucht von Frioul nicht einlaufen kann. Und wenn sie heute nicht kommen kann, morgen kommt sie gewiß. Was soll sonst aus uns werden? Wie die Versinkenden klammern wir uns an den Halm der Hoffnung. Und dann trifft uns wie ein Schlag die Nachricht: Die „Sister“ hat Marseille schon passiert und ist auf dem Wege nach Genua! – Wer das miterlebt, weiß, was Enttäuschung heißt. Nun klappt im Augenblick alle Energie zusammen, und eine heiße Wut steigt in uns auf angesichts des Viehstalles, in den wir getrieben werden wie die Herde. Aber ich tue dem Viehstall unrecht, wenigstens dem, was wir unter diesem Namen zu Hause verstehen. Da will ich lieber Wohnung aufschlagen als hier. Der Sturm brüllt, hinaus dürfen wir nicht, durch alle Löcher des verfallenen Stalles pfeift der Wind und treibt allen Schmutz auf unser Lager und in unsere Lungen. Schon zeigen sich neue Begleiter, die Wanzen und Läuse, die an uns saugen und knabbern. Skorpione gibt es hier wie in Château d’If. Der Ekel steigt uns in die Kehle. Zu essen gibt es nichts als Kohlsuppe, die wir nicht mehr sehen können. Wir hungern und frieren. Der Kommandant kommt nachmittags und fragt uns, wie wir zufrieden seien. Wir sagen ihm, daß wir hier nicht leben können. Er zuckt die Achseln: „Glauben Sie, daß es die Unsern in Deutschland besser haben?“ Einer erwidert: „Wir wissen es nicht, aber wir wünschen es ihnen.“ Der Kommandant wendet sich ab und fährt in seinem Benzinmotor davon. Leicht hat er sich auch fernerhin seine Aufgabe gemacht. Meist kam er auf Schleichwegen, daß niemand ihn bemerkte, der etwa Beschwerden vorzubringen hatte, und drückte sich ebenso, ehe wir ihn fassen konnten. Wir wandten uns an den Sergeanten und baten ihn um Hilfe. Er ist der einzige, der helfen kann und will, der Mitleid mit uns hat und wie ein Mensch fühlt. Er zeigt mir einen Raum für die Aerzte und Priester. Er soll nur noch gereinigt werden. Das tut auch not. Gut denn, noch einige Tage bei den Krätzekranken. Was hilft’s? „Das ist der Krieg.“ Wir wälzen uns wieder unruhevoll auf unserem harten Lager. Der Unmut hat sich gemehrt, und alle wohl ausnahmslos packt die Furcht: nicht hier krank werden, nicht hier verrecken, ehe wir die Heimat wiedergesehen haben und ihr in etwas nützlich geworden sind. Bleiern lastet die furchtbare Erkenntnis auf uns, daß bald die Würfel über uns geworfen werden; und die Sorge läßt uns nicht mehr, und an ihren Fersen da hinten, da hinten, von ferne, von ferne, da naht er, der Bruder, da naht er, der Tod.
Die Krankheiten mehrten sich. Kaum einer, der sich noch frisch fühlte bei diesem jämmerlichen Lager und dieser ganz unzureichenden Beköstigung. Und der Tod kam; der erste Fall berührte uns weniger, weil er nicht in unserem Lager war. Die Mutter eines unserer Gefangenen, eine ältere Dame, zuckerkrank, die trotz aller Reklamationen nicht freigelassen war, starb im Krankenhaus zu Marseille. Ihr Sohn fuhr zur Beerdigung. Weitere Opfer fielen, und es war unabweisbar, daß unsere Lage die weniger Widerstandsfähigen niederstrecken mußte. Es war ein Hohn, von Hygiene oder sanitären Maßregeln zu sprechen. Zwar tat der brave Sergeant wieder alles, was er konnte, aber sein Können war am Ende. Er gab uns einen Raum als Hospital, und der füllte sich. Da lagen aneinandergereiht Kranke an Tuberkulose (Kehlkopf-, Lungen- und Darmtuberkulose), an Disenterie und an Fiebern, die mit unseren unzulänglichen Mitteln nicht zu diagnostizieren waren, von denen wir aber in einigen gastrischen schon den typhösen Charakter vermuteten. Wie sollten wir uns gegen die Verbreitung des Typhus wehren? Wir hatten recht vermutet, neben der Dysenterie oder etwa nach ihrem Erlöschen mehrten sich die Fälle des Abdominaltyphus.
Sehr gering waren die Erkältungen. Unser Sergeant gab uns viel Freiheit. Wir durften eigentlich immer draußen sein. Das Wetter war in Château d’If meist schön, in Frioul kalt, oft regnerisch und stürmisch, aber doch so, daß ein klimatisch heilsamer Einfluß auf die Lungen ein Gegengewicht bot gegen den gefährlichen Aufenthalt im Schuppen. Der Himmel war für uns. Was aus uns in einem rauhen Klima geworden wäre, mag ich nicht ausdenken. Der Platz, welcher uns als Aufenthalt zur Verfügung gestellt war, war reichlich groß, wir konnten spazierengehen und uns auch von den anderen absondern, wir waren nicht immer aneinandergekettet. Der Sergeant, der der einzige Gebietende war (den Kommandanten sah man einmal täglich, meist auf der Flucht), gab uns auch die Erlaubnis zum Angeln. Das taten wir reichlich, es war unser einziger Zeitvertreib; denn Bücher waren damals nur wenige im Lager, und andere Beschäftigung, welche uns hätte ausfüllen und die schwarzen Gedanken hätte vertreiben können, fehlte. So angelten wir, und wenn der Fisch biß, lenkte er die Gedanken ab. Es war dadurch noch ein anderer Vorteil erreicht, oder er hätte erreicht werden können, der einer besseren Ernährung. Das war freilich illusorisch, denn unser Angelplatz war dicht neben den Aborten, die den Unrat von vielen hundert Gefangenen auf direktestem Wege nach guten Zielversuchen ins Wasser führten, und den Aborten zunächst wurden die fettesten der kleinen Fische geangelt. Da das Buch, soweit das möglich ist, es sich zur Aufgabe gemacht hat, ästhetisch zu bleiben, so übergehe ich das Kapitel „Abortwesen“ ganz. Ich will nur bemerken, daß in der langen Gefangenschaft in ganz kühnen Träumen uns etwas von einem W. C. vorschwebte, auf dem man regelrecht Platz nehmen könnte. Wenn wir uns trotzdem im Anfang Fische brieten, um den Hunger zu stillen (wir haben ja auch bei Krätzekranken gelegen, um Schlaf zu finden), so erfaßte uns doch bald ein unbeschreiblicher Ekel davor, und auch die anfangs viel belobten Polypensuppen fanden keinen Beifall mehr, und der Ekel erstreckte sich immer weiter. Wir mochten das Meer nicht mehr sehen. Das schwamm voller Unrat. Nicht mehr baden, das war ganz unmöglich geworden; wir mochten auch nicht mehr am Wasser vor dem Schuppen uns aufhalten, denn da stank es, und es stank bis zum Schuppen hinein, und es stank in der Kantine, die direkt den Aborten gegenüberlag, fünf Schritt davon entfernt.
Die Ernährung, die bei jedem Oekonomenwechsel mit Pomp als „nun endlich besser“ verkündet und die ersten zwei Tage wirklich so verabfolgt wurde, blieb unglaublich schlecht und wurde immer schlechter. Alle Vorstellungen, auch die Beschwerden des Sergeanten, halfen nichts. Als mir einmal der Kommandant nicht entgehen konnte (ich hatte ihm auf der Lauer gelegen) und ich ihm als Beweis schädlicher Ernährung ein durch und durch verschimmeltes Brot zeigte, versprach er, die Sache zu untersuchen und steckte sogar das Corpus delicti ein. Aber er hat wohl zu gründlich untersucht, denn ich sah ihn in den nächsten Tagen nicht wieder. Aber die Leute hungerten, und die Stimmung der Gefangenen wurde mehr und mehr gereizt.
Eines Abends kam ein Militärarzt aus Marseille in unser Lager, der sich recht eingehend nach allem erkundigte. Da er deutsch sprach, so konnte ich ihm besser als sonst die Beschwerden vortragen, die er freundlich anhörte. Ich sagte ihm, daß, wenn die Ernährung so weiterginge, man uns einen doppelten Raum anweisen müsse, unsere Kranken unterzubringen. Ich stellte ihm vor, daß, abgesehen von der geringen Menge der Nahrung, die Suppen zum Teil ekelerregend seien, daß wir nur alle drei Tage ein Stückchen Fleisch, oft ganz ungenießbar, erhielten, daß die Darmkrankheiten sich erheblich mehrten, und daß auch die Schaden litten, welche Mittel hätten, sich einiges in der Kantine zu kaufen. Er antwortete mir höflich und fast herzlich, daß es durchaus nicht die Absicht der Franzosen sei, deutsche Gefangene Schaden nehmen zu lassen, er wolle alles tun, um dem zu steuern. Dann reichte er mir die Hand, und das Fauchen des Benzinmotors kündete mir, daß wieder einmal jemand froh war, einer immerhin peinlichen Situation glücklich entronnen zu sein. Geändert hat sich durch den Besuch nichts, und wir lernten wieder einmal erfahren, daß das durchaus nicht der Zweck derartiger Besuche war. Wie gesagt, eine gewisse Besserung lag darin, daß wir uns einiges, auch Wein, in der Kantine kaufen konnten. Abgesehen davon, daß das nur diejenigen begünstigte, die Geld hatten, war auch der Raum so schmutzig, häßlich und ungemütlich, daß wir, wenn möglich, ihn mieden. Zudem war die Kantine in den Stunden, wo sie geöffnet war, so überfüllt, daß man warten mußte, um Platz zu bekommen, und – last not least – die Düfte…
Wein war damals noch unbeschränkt erlaubt, und das war auch nicht gut. Die Folgen waren schlimme und sind es lange geblieben.
Frioul, 2. Okt. 1914.
Meine liebe Armgard!
Du glaubst nicht, wie quälend es ist, Dir schreiben zu müssen und noch dazu in französischer Sprache, wie es anfangs war, „je me trouve assez bien“. Ich habe nie gelogen, wenn ich Dir schrieb oder sprach, und wir waren gewohnt, mehr auszutauschen als die gewöhnlichen Erlebnisse des Alltags. Da will ich mich trösten mit Briefen, die Dich nicht erreichen und Dich nicht erreichen sollen, die, wenn ich hier falle – ich darf getrost den stolzen Ausdruck gebrauchen – Dir überbracht werden mit meinem Tagebuche, und die, wenn ich gesund die Heimat erreiche, ich Dir selber vorlesen werde. Ein anderes ist noch möglich, daß man mir das, was mir das Liebste in der unwürdigen Gefangenschaft geworden ist, fortnimmt. Ich hüte meine Blätter wie ein Heiligtum, aber wer steht für das Ende, das sie, das ich finde? – Wir sind erst 40 Tage in Gefangenschaft, und jeder Tag, wenn er auch dasselbe Gesicht zeigt, bringt etwas Neues, und das Neue überholt das Erlebte des vorigen Tages und läßt die Zukunft uns dunkler und dunkler erscheinen. Ich meine unsere Zukunft, denn auf den endgültigen Sieg unseres Heeres und unserer Marine baue ich so felsenfest, wie ich von je darauf gebaut habe. Darin machen mich die hämischen Bemerkungen unserer Wärter nicht irre. Wir dürfen keine Zeitungen lesen, und das ist wohl gut. Eins fürchte ich, und wohl jeder von uns, hier zu verrecken, ehe wir etwas für unsere Heimat getan haben. So ganz ruhmlos möchte ich nicht aus diesem Kriege hervorgehen, und daß ich noch nichts habe tun können, schmerzt mich am meisten. Darum hatte ich der französischen Regierung den Vorschlag machen wollen, mich anzustellen, mit der Bedingung, daß ich in Gefangenenlagern vorzugsweise meine Landsleute behandeln dürfte, wenn möglich verwundete Soldaten. Das ist abgeschlagen, aber nun wird es in gewisser Weise in Erfüllung gehen, denn Krankheiten mehren sich in unserem Lager und die Zahl der Gefangenen. Aber wie sollen wir behandeln? Uns steht ja kein Medikament, kein Bett, kein Verbandstoff zur Verfügung. Kranken nur