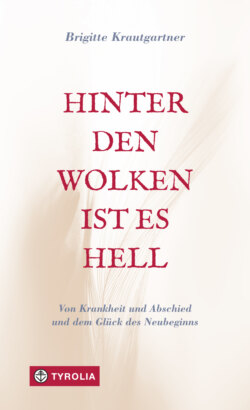Читать книгу Hinter den Wolken ist es hell - Brigitte Krautgartner - Страница 5
1.
Die Diagnose
ОглавлениеEs war wie eine jener Filmszenen, die auf mich immer so unglaubwürdig und schlecht inszeniert gewirkt hatten: Wir saßen im fahrenden Zug und alles zog wie in Zeitlupe an mir vorbei. Die Konturen waren zwar klar erkennbar, nicht „vernebelt“, trotzdem war da eine deutlich spürbare Distanz zu allem, was mich umgab. Die Geräusche rund um mich waren gedämpft. Alles war irgendwie unwirklich. Alles, außer meinem Herzschlag. Und dem Gedanken: Das gibt es also wirklich.
20 Minuten zuvor hatte mir ein einfacher Satz die schmerzhafte Gewissheit gebracht: „Er meint, die Beschwerden kommen von den Knochenmetastasen.“ Rudi hatte die Worte fast beiläufig hingesagt. Damit war alles klar, die Hoffnungen, die wir uns noch gemacht hatten, zunichte – die Richtung vorgegeben.
Bösartig. Krebs. Gestreut. Keine Chance auf Heilung. Der Supergau, den wir befürchtet hatten, war nun offiziell bestätigt.
Wir waren beide nicht darauf vorbereitet gewesen, an diesem Tag überhaupt eine Diagnose zu bekommen. Die Befundbesprechung nach der Gewebeprobe war für einen späteren Termin vereinbart. Aber dann hatte er diese Schmerzen im Bein bekommen, er wusste nicht, ob er trotzdem am Wochenende mit mir Tennis spielen sollte oder sich schonen. Also Anruf beim Arzt, „Kommen Sie vorbei“, und währenddessen, während der Unterredung der beiden, kam online der Befund der Biopsie.
Diverse bildgebende Verfahren bestätigten in der Folge die Verbreitung der Metastasen: Beckenknochen, Oberschenkel, Wirbelsäule.
Jetzt also, an diesem letzten Freitag im August, das Todesurteil. Für ihn – aber auch für mein Leben, wie es bisher gewesen war. Für eine Beziehung, die vor mehr als 20 Jahren begonnen hatte. Jetzt war es gesichert. Mein schrecklicher Verdacht bestätigt. Immerhin bedeutete das auch endlich Klarheit. Immerhin waren die Qualen der Unsicherheit vorbei – so empfand es ein Teil von mir.
Seit Wochen waren wir im Unklaren gewesen. Zwar schienen die Anzeichen immer mehr in die eine Richtung zu deuten; immer jedoch hatte da die Möglichkeit bestanden, dass alles auch ganz anders sein könnte.
Wie groß konnte diese Möglichkeit – unsere Chance – realistischerweise sein? Oft stellten wir den Ärzten diese Frage. Er, bei Terminen, die er allein wahrnahm. Ich bei Terminen, zu denen ich ihn begleitete. Die Antworten waren immer vage, man könne nichts sagen, das würden die weiteren Untersuchungen zeigen, jetzt nichts überstürzen, nicht die Zuversicht verlieren. Der Ton wurde immer rücksichtsvoller. Kein gutes Zeichen, wie ich fand. Die Ungewissheit wurde immer zermürbender. Sie prägte und zerstörte einen Kurzurlaub im Salzkammergut, sie führte Regie in unseren Plänen und in unserem Umgang miteinander, sie begleitete uns abends in den Schlaf und hieß uns am Morgen im neuen Tag willkommen. Sie fraß sich tief in unsere Gedanken und Gefühle, in das Innerste unserer Beziehung. Sie war der Tinnitus, den wir manchmal ausblenden, aber nie loswerden konnten. Bis eben dann die Diagnose kam.
„Jetzt weiß ich es wenigstens“, sagte er auf dieser Zugfahrt zu mir; Worte, die aus weiter Ferne zu kommen schienen.
Und ich? Ich dachte: Ich weiß es schon lange.
Es war mir aufgefallen, dass er deutlich weniger Energie hatte als früher. Dass er beim Zugfahren (und als Pendler waren wir durchaus nicht selten gemeinsam unterwegs) immer öfter einschlief. Aber auch bei einem Klavierkonzert, das ihn eigentlich begeisterte, eine junge rumänische Pianistin. „Sie spielt wie Keith Jarrett“, fand er.
Und: Auffällig oft musste er auf die Toilette. So auffällig, dass ich es ansprach – wissend, dass es für ihn ganz schwierig war, über Gesundheitliches zu sprechen. Und dann noch dazu etwas, das den Urogenitalbereich betraf. Ja, herzlich willkommen im Bereich der einschlägigen Fachausdrücke, es ist ein Nebenaspekt, aber auch sprachlich wurde plötzlich alles anders, medizinisch – auch das ganz Private.
Er wischte meine Bedenken weg, wenn ich sagte, dass ich seinen ständigen Harndrang beunruhigend fand. Ja, er wurde, wenn es gar nicht mehr anders ging, unwirsch. Schob es auf die Kälte, den Tee, das Bier, die Beckenbodenmuskulatur, darauf, dass das bei Männern Anfang 60 normal sein sollte.
Und genau das wurde es dann auch – unsere neue Normalität, geprägt von seinen Symptomen. Eine Normalität, die mich beunruhigte, quälte. Dann wieder schien es besser zu werden – ich gab mir selber eine innerliche Entwarnung. Die wirkte so lang, bis es wieder ein Alarmzeichen gab. Ich kam aus dem Beobachten nicht mehr heraus. Und ausgehend von den Beobachtungsergebnissen gestaltete sich meine emotionale Befindlichkeit. Die ich freilich mit ihm nicht teilen konnte. Denn er teilte mir ganz klar seine Sichtweise mit: Wenn ich immer nur Probleme suchte, dann sei das meine Angelegenheit, dann sollte ich das mit mir selber ausmachen.
So vergingen die Monate Jänner bis Juli.
Im August dann ein erster Arzttermin. Ergebnis der Untersuchung: Der PSA-Wert war dramatisch erhöht. „PSA – was ist das?“ Die Frage war ehrlich gemeint. Für medizinische Kürzel hatte er sich nie besonders interessiert. Er freute sich immer über seinen niedrigen Cholesterinspiegel. Den hatte er übrigens bis zuletzt.
Das Ergebnis der Blutuntersuchung mit dem zu hohen PSA-Wert zog eine Kaskade von weiteren Tests nach sich, immer enger wurde mein Hoffnungskorridor (und seiner auch, aber darüber sprach er nicht).
„Jetzt weiß ich es wenigstens“ – wir waren also im Bereich der Gewissheit gelandet. Es war Spätsommer, und ich trug ein leichtes Kleid. Wir hatten die Einkäufe für das Wochenende dabei. Die Sonne schien. Es war heiß. Unser Urlaub am Meer stand kurz bevor. Alles geplant. Alles wie immer. Der letzte Freitag im August.
Wie es an diesem Tag weiterging? Unspektakulär.
Irgendwann synchronisierte sich die gefühlte Zeit mit der tatsächlichen. Meine Wahrnehmung wurde wieder wie gewohnt. Wir räumten die Lebensmittel aus dem Rucksack, alles an seinen angestammten Platz. Toastbrot und Eier für das Frühstück. Weil wir das am Wochenende gern hatten.
Und dann?
Nicht zu Hause bleiben. Wir gehen weg. Der Abend ist so schön. Wer weiß, wie das Wetter im September werden wird?
Wer weiß, wie alles werden wird … Aber das wagten wir beide nicht auszusprechen.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte in unserer Ortschaft ein Café mit einem schönen Gastgarten eröffnet. Dorthin gingen wir. Und es war … alles wie immer. Die Tische im Freien gut besucht, heitere Stimmung. Die Rosen blühten, dass es eine Freude war. Gelächter. Kinder mit Eistüten. Bekannte Gesichter.
An einem Tisch saßen zwei Sängerinnen aus unserem Chor. Eine verwitwet, eine mit ihrem Mann. Es verstand sich von selber, dass wir bei ihnen Platz nahmen. Und die üblichen Gespräche führten: über das schöne Wetter, über gerade absolvierte oder bevorstehende Urlaubsreisen.
Und wieder fühlte sich alles sehr seltsam an, wieder bekam ich Schwierigkeiten mit meiner Wahrnehmung. So dachte ich zunächst. Bis mit der Zeit klar wurde, es war nicht die Wahrnehmung, an der es lag – es war die Wirklichkeit. Oder, präziser formuliert, es waren die Wirklichkeiten. Denn da kam es zu seltsamen und schwer einzuordnenden Überlagerungserscheinungen.
Hier die Ausnahmesituation, die Diagnose, das Todesurteil. Dort die Normalität, der Sommerabend, die Freundinnen. Ein Glas Gin Tonic vor mir auf dem Tisch, der Geschmack wie immer.
Unausgesprochen stimmten wir darin überein: „business as usual“. Wir wollten die Illusion, alles sei in Ordnung, aufrecht erhalten. Wir sprachen nicht darüber, was an diesem Nachmittag geschehen war. Wir sprachen überhaupt nicht viel. Unsere Welt würde nie wieder dieselbe sein. Aber das musste nicht sofort das alles bestimmende Thema im Gespräch werden. Und wenigstens hatten wir jetzt Klarheit.
Dann bestellte der Mann unserer Chorfreundin noch eine Runde. Und immer noch schien die Sonne …