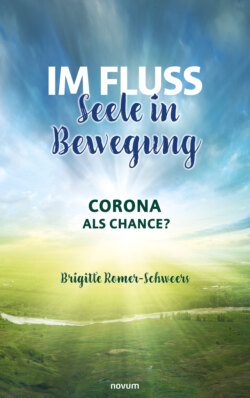Читать книгу Im Fluss – Seele in Bewegung - Brigitte Romer-Schweers - Страница 8
Оглавление1 FAMILIE
Die beiden seelischen Grundbedürfnisse des Menschen sind Verbundenheit und Autonomie; er braucht Wurzeln und Flügel.
Diese Erkenntnis ist nicht neu. Neu für mich ist, dass ich seit einiger Zeit die Gelegenheit habe, genau das bei meinem jüngsten, jetzt 18 Monate alten Enkel, der zu unserer großen Freude ganz in der Nähe wohnt, fast täglich zu beobachten. Mit diesem Bewusstsein und der Zeit und Muße dazu war das bei meinen eigenen Kindern, und auch bei den älteren Enkeln auf Grund der Entfernung, in dieser Form nicht möglich. Ein wunderbares Geschenk für uns Großeltern!
Es berührt mich, zu erleben, wie er die Welt und seine eigenen Fähigkeiten mehr und mehr entdeckt und entwickelt, während er sich gleichzeitig immer wieder vergewissert, dass die für ihn wichtigsten Menschen da sind. Unermüdlich probiert er aus, übt mit Beharrlichkeit und Konzentration, bis er sein Nahziel erreicht hat. Die Freude, die ihn dann erfüllt, ist dem ganzen kleinen Körper anzusehen. All das geschieht von allein. Er braucht dazu keine Ermunterung, keine Aufforderung, geschweige denn „Training“ oder irgendeine andere Form von Anstoß. Er braucht nicht einmal Spielzeug. Alles, was sich gerade in seiner Umgebung befindet, weiß er zu nutzen.
In der Sicherheit der Bindung geschieht Entwicklung ganz von selbst. Er ist noch ganz bei sich, nimmt keinen Abstand durch Überlegung, was sein könnte, wenn … So ist er auch völlig angstfrei. Angst entsteht ja erst dann, wenn unser Kopf, gespeist von den Erfahrungen der Vergangenheit, irgendwelche möglichen und unmöglichen Szenarien für Gegenwart und Zukunft ersinnt.
Das, was da passiert, ist Ent-wicklung, im ursprünglichen Wortsinn, nämlich etwas, was in der Anlage bereits da ist, wird ausgewickelt. Von außen wird instinktsicher nur Selbstgewähltes einbezogen, das als Anregung genau zu dem jetzt anstehenden Entwicklungsschritt passt.
Wir wissen alle, dass diese kindliche Freiheit, das Eigene zu entdecken und zu leben, endlich ist. Nicht lange, und wir bringen unseren Kindern alles bei, was wir für angemessen halten. Wir finden das vollkommen selbstverständlich und notwendig, um sie darauf vorzubereiten, irgendwann eigenständig in dieser Welt zurechtzukommen. Vielleicht ist es das ja auch. Je nach eigenem Bewusstseinsstand entdecken und würdigen wir dabei mehr oder weniger sensibel das Eigene in unseren Kindern. Dennoch machen wir sie unbeabsichtigt gleichzeitig zu Objekten unserer Vorstellungen und blockieren damit die Möglichkeit einer Entfaltung in die ganz eigene Richtung, die nur das Kind selber herausfinden kann; die wir Erwachsenen gar nicht kennen können.
Ist das nicht eine riesige Potentialblockierung und Verschwendung?
Aber dazu später mehr.
Doch auch in der bestmöglichen aller Kindheiten werden wir nicht vermeiden können, unseren Kindern Päckchen mit auf den Weg zu geben, die sie tragen müssen. Unsere Hoffnung kann nur sein, dass sie irgendwann zu unterscheiden lernen, was zu ihnen gehört und was nicht.
Lebenslange Aufgabe eines jeden Menschen, die immer wieder aufs Neue zu lösen ist. Es bedeutet, Spürbewusstsein zu entwickeln für das, was verabschiedet werden kann, für das, was bleiben darf, und für den Handlungsschritt, der jetzt gerade ansteht. Poetischer als Hesse das in seinem Gedicht „Stufen“ beschreibt, kann man es nicht ausdrücken.
Das Stichwort „Bestmögliche aller Kindheiten“ führt mich zurück in mein eigenes Leben.
Ich selber bin ganz sicher in einer – nach landläufiger Meinung – intakten Familie aufgewachsen. Ich habe keine Not gelitten, auch wenn in einer Familie mit vier Kindern und einem alleinverdienenden Lehrer-Vater in den 1950er-, 1960er-Jahren nicht viel Geld da war. Dennoch hat es oft für bescheidene, aber spannend gestaltete Urlaube, immer für Musikunterricht und auch für ein eigenes Haus gereicht.
Mein Vater war ein liberal denkender Mensch, der selber aus einem freigeistigen Elternhaus stammte. Seine Leidenschaft galt der Chormusik, und er besaß die große Gabe, junge Menschen dafür zu begeistern. Überhaupt war ihm besonders an Kontakten mit Menschen gelegen, aber auch sonst war er an vielem interessiert. Er konnte wunderbar Gedichte rezitieren; vor allem Morgenstern, Ringelnatz und Eugen Roth sind mir in lebhafter Erinnerung. Er liebte das Arbeiten mit Holz und dabei nicht zuletzt die vorausgehende Planung.
Im Gegensatz zu vielen Männern seiner Generation, hatte er keine Altlasten aus dem Krieg, in dem er zum Piloten ausgebildet wurde. Mit sehr viel Glück – das war ihm immer bewusst – und auf Grund einer Verletzung blieben ihm Ostfront und andere Kampfeinsätze erspart. Im Sommer 1946 konnte er aus französischer Kriegsgefangenschaft fliehen. Aus finanziellen Gründen war es ihm nicht möglich, seiner Leidenschaft für die Fliegerei nach dem Krieg weiter nachzugehen, was er sehr gern getan hätte.
Meiner Mutter zuliebe konvertierte er, der auf dem Papier katholisch war, zum evangelischen Bekenntnis.
Sie nämlich stammte aus einem streng protestantischen Elternhaus; die Heirat mit einem „Katholen“ wäre undenkbar gewesen. Die tiefschwarzen Haare meines Vaters nahmen die Schwiegereltern gerade so hin: Der Rassenwahn des Dritten Reiches warf seine Schatten noch bis in die Anfänge der 50er-Jahre.
Mutter war ein überwiegend positiv gestimmter Mensch, mit viel Liebe zu allem, was lebt, insbesondere zu Kindern. Unerschütterlich in ihrem Glauben verankert, galt es, das Gebot der Nächstenliebe unbedingt zu leben, auch wenn sie den zweiten Teil des Gebotes – „wie dich selbst“ – nicht so wichtig fand. Die Liebe zu alten Kirchenliedern, insbesondere denen von Paul Gerhardt, habe ich sicher von ihr übernommen, und aus meiner frühen Kindheit ist sie mir unentwegt singend in Erinnerung. Sie verfügte außerdem über einen unerschöpflichen Vorrat an humoristischen Sprüchen und Lebensweisheiten, und mit bemerkenswerter Liebe widmete sie sich auch den aus meiner Sicht langweiligsten Tätigkeiten. Als ich sie hingebungsvoll bügeln sah, fragte ich, ob sie das eigentlich gerne mache. (Ich fand Bügeln überflüssig und öde.) „Ach, weißt du“ – so begannen viele ihrer Antworten –, sagte sie: „Ich habe gelernt, dass mir alles viel leichter fällt, wenn ich mich dafür entscheide, es gern zu tun.“
Sie hat sich die Nöte der ihr vertrauten und anvertrauten Menschen immer ausgesprochen empathisch zu Herzen genommen und ich bin sicher, dass sie – kurz vor ihrem 80. Geburtstag – am Broken-Heart-Syndrom starb. Einer ihrer letzten Sätze zu mir, zwei Wochen vor ihrem Tod, war, bezogen auf einen ihr sehr vertrauten Menschen, um den sie sich sorgte: „Ich bin froh, dass R. dich hat und du musst mir versprechen, immer für sie da zu sein.“ Zwischen den Zeilen schwang ein „Ich kann es nämlich (bald) nicht mehr“ mit. Dieses Versprechen hat mir übrigens lange viel Druck gemacht, bis ich irgendwann die Verantwortung an R. selbst zurückgeben konnte.
Diese beiden Menschen, meine Eltern, hatten ihre ganz eigenen Vorstellungen von Kindererziehung – anders, als ich das bei den Eltern Gleichaltriger erlebte. Ich kann mich nur an wenige ausgesprochene Ge- oder Verbote erinnern. Genauso wenig an Drohungen, Strafen, Drängen in eine schulische oder berufliche Richtung usw. Selten wurden Grenzen mit Worten benannt; ausgesprochen wurde allenfalls, dass uns nicht interessieren, im Sinne von beeinflussen, sollte, was andere machen oder denken.
Gewalt war kein Thema. Auch nicht getarnt als Erpressung, Bestechung oder Verführung. Es herrschte eine freundliche, wohlwollende Atmosphäre, und es gab durchaus den Raum dafür, sich auszuprobieren, eigene Lösungsmöglichkeiten zu finden und damit Selbstwirksamkeit zu erfahren, zumindest innerhalb bestimmter, wenn auch nie benannter Grenzen; es wurde viel (vor-)gelesen, gesungen, gespielt, musiziert, und wir waren immer im Gespräch. Genau das war es, was mir in der ersten Zeit nach meinem Umzug, zwecks Ausbildung, in das 500 Kilometer entfernte Berlin am meisten fehlte: die Gespräche am Mittagstisch, bei denen auch mein Vater auf Grund seines Lehrerberufs anwesend sein konnte.
Ich habe mich oft gefragt, wie meine Eltern es geschafft haben, dass ich in der Spur geblieben bin, die sie gelegt haben. Meine Mutter erzählte manchmal, dass sie für mich, ca. vier Jahre alt, mit Kreide einen Strich auf die Straße gemalt habe, bis zu dem ich gehen durfte. Sie war ziemlich stolz darauf, dass ich diese Grenze wohl immer respektiert habe. Ich selber kann mich nicht erinnern, aber meine späteren Erfahrungen mit mir selber lassen mich nicht an ihrer Aussage zweifeln. Als ich das irgendwann meinen eigenen Kindern erzählte, schüttelten sie jedes Mal fassungslos den Kopf und wollten nicht glauben, dass ich nie ausprobiert habe, wie es hinter dem Kreidestrich aussah, und was passiert wäre, wenn ich das Gebot im wahrsten Sinne des Wortes übertreten hätte.
Wie also hielten sie mich auch später in der Spur? Ich sage „mich“ und nicht „uns“, denn meine drei Brüder hatten andere Eltern. Nicht biologisch natürlich, das war und ist unübersehbar, aber aus ihren Erzählungen weiß ich schon lange, dass dieses gemeinsame Elternhaus mit jedem von uns etwas anderes gemacht hat. Das ging z. T. so weit auseinander, dass ich mehr als einmal dachte, einer der Brüder redet gerade über eine andere Frau, aber doch nicht über meine Mutter. Früher haben mich solche Gespräche stets in eine Verteidigungsposition gebracht. Damals habe ich nicht begriffen, dass diese unterschiedlichen Wahrnehmungen völlig normal sind. Ich hoffte, den Bruder von meiner Wahrheit überzeugen zu können, wenn er sich denn nur anstrengen und richtig hinschauen würde und habe dabei übersehen, dass es nicht um die Wahrheit geht, ja, gehen kann, wenn etwas verteidigt, erklärt, bewiesen werden muss. Nicht einmal dann, wenn es um meine Ansicht zu einem Thema geht, kann ich diese beweisen, denn es ist eben nur meine Sicht auf Dinge, die andere von anderen Warten aus betrachten. Im Übrigen gibt es diese Unterschiede in der Wahrnehmung natürlich auch auf Seiten meiner Brüder: sie wissen nicht immer, von was ich eigentlich rede, wenn ich aus „meiner“ Kindheit erzähle …
Aber wieder zurück zu der Ausgangsfrage: Wie haben sie mich in der Spur gehalten?
Der Groschen fiel bei mir mal wieder lireweise (ja, Groschen und Lire gab es zu der Zeit noch!), wie einer meiner Brüder in seiner unnachahmlichen Art zu bemerken pflegte, wenn ich etwas länger für eine Einsicht brauchte.
Ich will damit sagen, dass es viele Lebensthemen gibt, denen ich immer wieder mal begegne. Es kommt vielleicht zu einer Einsicht, die sich für den Moment vollständig anfühlt, um wenig oder auch viel später verworfen oder erweitert zu werden. So lebe ich mein Leben „in wachsenden Ringen“ oder – wie ich es manchmal empfinde – spiralförmig. Wie auch immer: Leben verläuft eben nicht linear, sondern zirkulär. Das ist zumindest meine Erfahrung. Dazu gehören zum Beispiel auch wohlbekannte, längst überwunden geglaubte Fallen, in die ich von Zeit zu Zeit wieder hineintappe. Wir, mein Mann und ich, zitieren dann gerne ein afrikanisches Sprichwort: „Ich kann nicht verhindern, dass die Vögel um meinen Kopf kreisen, aber ich kann verhindern, dass sie dort Nester bauen.“
Also: wie viele Lire und welche sind inzwischen gefallen – genug für einen Groschen?
Die Antwort ist: ich weiß es nicht, auch wenn es sich jetzt, wie immer in solchen Momenten, so anfühlt, als sei der Groschen voll. Es spielt auch keine Rolle.
Im Blick auf meine Kindheit wird mir die eigenartige Präsenz des Themas der nicht benannten Grenzen deutlich, sieht man mal von dem Kreidestrich auf der Straße ab.
Wenn ich als Jugendliche wissen wollte, wann ich abends zu Hause zu sein habe, war die Antwort: „Was findest du denn angemessen?“
Klingt im ersten Moment ganz gut, so nach: Ich darf es selber entscheiden. Ist aber nicht gut, denn was schlägt die gehorsame Tochter auf diese Frage hin vor? Natürlich einen Zeitpunkt, der möglichst knapp unter der Zeit liegt, von der sie vermutet, dass ihr Vater sie für angemessen hält.
Schließlich ist sie, wie alle Kinder, auf die Liebe und Zuwendung der Eltern angewiesen. Kinder verbiegen sich lieber, als dass sie diese Liebe aufs Spiel setzen.
Voraussetzung auf Seiten des Kindes ist, dass es gelernt hat, zu erspüren, was die Eltern wollen. Bösartig könnte man sagen, die Eltern haben die Verantwortung, die eigentlich sie für das Aufzeigen von Grenzen haben, auf die Kinder abgewälzt. Das haben meine Eltern ganz sicher nicht gewollt – dennoch habe ich es so empfunden. Ich spekuliere: Vermutlich war es eine Gegenreaktion meiner Eltern auf als zu hart empfundene Grenzsetzung in der eigenen Kindheit …
Wie sehr hätte ich mir als Kind gewünscht, mal einen Grund zum offenen Protest zu bekommen! Aber es blieb bei heimlichem Grummeln. Einzig gegen den Großvater habe ich mich als junge Erwachsene einige Male, wenn ich mich von ihm provoziert oder genervt fühlte, deutlich positioniert – nicht etwa mit ihm konstruktiv auseinandergesetzt.
Kein Wunder, dass offene Auseinandersetzungen, die in meiner Kindheit so gut wie nicht stattfanden, mir im späteren Leben so viel Mühe bereitet haben. Kein Wunder auch, dass ich Zeit meines Lebens Probleme mit der Haut, dem Grenzorgan des Menschen hatte. Ich habe oft den Eindruck gehabt, dass ich nicht spüren kann, wo ich aufhöre und der andere anfängt. (Dass genau dieses Verschwimmen der eigenen Grenzen auch ein Segen sein kann, darauf komme ich im Kapitel „Spiritualität“ noch einmal zurück.) Kein Wunder, dass ich lange Zeit Grenzverletzungen von anderen zugelassen habe.
Und die andere Seite der Medaille kenne ich auch: In vorauseilendem Gehorsam, ja, fast schon übergriffig, Dinge für andere zu tun, von denen ich dachte, dass sie von mir erwartet werden. Das hat es mir auch in der Jugend schwergemacht, zu einer Peergroup, wie man es heute nennt, zu gehören. Ich war mir nie sicher, wie ich mich eigentlich verhalten sollte. Ich bin auf Menschen geflogen, die mir nicht bekömmlich waren, weil sie oft nicht das meinten, was sie sagten, und es mir überließen, herauszuhören, um was es eigentlich ging. Dass es Menschen in meinem direkten Umfeld gibt, die anders sind, die tatsächlich offen sagen, was sie möchten, und es dann auch wirklich stimmt, habe ich erst spät erleben dürfen. Das lag unter anderem natürlich auch daran, dass ich Menschen durch meine Projektionen oft gar keine echte Chance geben konnte, von mir als authentisch wahrgenommen zu werden, weil in mir gleich das Programm „Zwischen-den-Zeilen-lesen“ ansprang.
Nochmal zurück zu der fehlenden Möglichkeit, offene Auseinandersetzung zu lernen. Selbstverständlich habe ich in den Augen meiner Eltern nicht immer alles richtig gemacht. Die Reaktion meiner Mutter war dann, mir – natürlich nonverbal – Verletzung zu signalisieren. Die Reaktion meines Vaters ging dahin, mich spüren zu lassen, dass es nicht genügte, dass ich mir nicht genug Mühe gegeben hatte. Auch dieser Satz wurde nie ausgesprochen …
Dieses „Es genügt nicht“ hing eigentlich am längsten als Damoklesschwert über meinem Haupt und wirkte gleichzeitig als innerer Antreiber.
Sehr berührt hat es mich, als ich mit meinem Vater in seinen letzten Lebensjahren über diesen Satz sprach. Zu dem Zeitpunkt war längst ein intensiver, offener und wertschätzender Austausch über das, was uns bewegt, möglich und wir haben ihn beide als durchaus bereichernd erlebt. Er sagte nämlich unter Tränen zu mir: „Aber das ist doch mein Satz den solltest du nie übernehmen.“
Die Präambel in unserem ungeschriebenen Familiengesetzbuch würde ich heute so formulieren:
Mit gutem Willen und entsprechender Anstrengung, darauf achtend, dass man niemandem zu nahe tritt oder ihn gar verletzt, kann man fast alles schaffen, und man ist ein Leben lang für das verantwortlich, was man sich vertraut gemacht hat.
Wie alle Eltern wollten die meinen uns bestmöglich auf das Leben vorbereiten.
Ich bin sicher, dass es ihnen dabei enorm wichtig war, uns zu unabhängigen, sich ihrer Stärken und Schwächen bewussten, nicht verführbaren Menschen zu erziehen. Aber wie das so ist mit den guten Absichten: Nicht immer wählen wir die richtigen Mittel, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Das mit der Unabhängigkeit und der Nichtverführbarkeit hat bei mir jedenfalls nicht so gut funktioniert …
DER PANTHER
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf – dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille
– und hört im Herzen auf zu sein.
R. M. Rilke