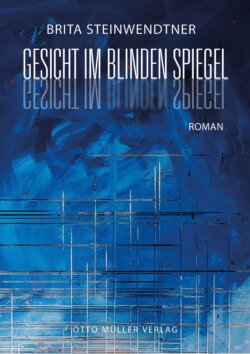Читать книгу Gesicht im blinden Spiegel - Brita Steinwendtner - Страница 8
KÖNIGGRÄTZ I
ОглавлениеKalter Regen fällt auf die Felder nieder.
Sie stehen hoch und reif.
Die Ähren schwer vom Nass, biegsam bergab.
Regengetränkt die Erde.
Matschig die Fuhrstraßen, lehmig die Hohlwege.
Nebelbahnen ziehen her und hin.
Grauer Himmel hockt auf den Hügelkuppen.
Saatkrähen fliegen über die Dörfer.
Die Menschen versperren ihre Häuser.
Sie warten.
Unheil liegt in der Luft.
Wie schön ist das Land in der Sonne gewesen.
Sommerlich noch vor wenigen Tagen und friedlich vor wenigen Wochen. Dem Reifen hingegeben. Die Kornfelder wuchsen in ihr Gelb, der Hafer zitterte im leichten Wind, die Wiesen standen gut für fette Rinderweiden. Sanfte Hügel einer Urlandschaft, von Gletschern geschliffen, fruchtbar und wasserreich, in der Ebene zieht die Elbe westwärts den fernen Häfen zu, dem Meer. Es war ein Wispern und Rascheln, Summen und Zwitschern gewesen, Käfer und Insekten, Schmetterlinge und Vögel nützten die Stunde. Die Sonne eines heißen Juni kam früh und ging spät. An den Wegrändern blühten Kamille, Kornraden und weiße Schafgarben. Die Menschen taten ihr Tagewerk, bereiteten die Ernte vor, schmiedeten das Werkzeug, gingen zur Messe am Sonntag. Kaufleute zogen auf den Hauptstraßen von Ost nach West und von Nord nach Süd und weithin. Der Klang der Mittagsglocken flog über die Hügel, die mit lichten Wäldchen bestanden waren. Wenn die Sonne sank und Kühle aufstieg, ging ein leises Rauschen durch Fichten und Buchen. Lindenblüten fielen sacht zu Boden.
„Böhmisches Paradies“ nennen die Menschen diesen Flecken Erde.
Aber jetzt ist Aufruhr im Land.
Lärm und Räderrollen, Kommando, Schrei und Befehl. Seit Wochen unübersehbare Militärkolonnen, Mann und Munition, Geschütze, Kanonen, Feldküchen, Lazarette. Reiterschwadronen querfeldein, Marschschritt in den friedlichen Dörfern. Einquartierung von Soldaten, Errichtung von Lagern auf fruchtbaren Äckern, zertrampelter Grund. In das Umland der Elbe wälzen sich gewaltige Armeen Richtung Königgrätz: Vom Süden her kommen die Österreicher aus Brünn, Olmütz und Pardubitz. Vom Nordwesten und Norden, von Reichenberg, Höhenwasser und Trautenau her rückt die gegnerische Heeresmacht vor.
Aufmarsch zur großen Schlacht.
Um Land und Bodenschätze? In den Annalen steht geschrieben: Jetzt, 1866, geht es um den Ausschluss Habsburgs und des österreichischen Kaisers aus dem Deutschen Bund. Um Machtgewinn für das aufstrebende Preußen.
Es ist Krieg.
Die, die ihn befehlen, wissen immer, worum es geht.
Jene, die für ihn sterben, selten.
Dies hier ist ein Bruderkrieg.
Sind sie nicht kurz zuvor noch Waffenbrüder gewesen, Preußen und Österreich gemeinsam gegen Dänemark um Schleswig und Holstein? Und werden sie nicht bald darauf den Zweibund zur Freundschaft und gegen zukünftige Feinde schließen und dies wiederum nur wenige Jahre später für einen Krieg nützen, der zum Weltenbrand werden wird?
Warum dazwischen dieser Krieg?
’s ist Krieg! ’s ist Krieg! O Gottes Engel wehre
Und rede Du darein!
’s ist leider Krieg – und ich begehre
Nicht schuld daran zu sein!
2. Juli 1866.
Kalter Regen fällt auf die Felder nieder.
Fällt von den Bäumen auf die Zelte eines Feldlagers.
Es liegt am Fuß des Hügels von Chlum.
Johannes Czermak wartet.
Geduldig poliert er sein Signalhorn.
Obwohl es blank ist wie eine Monstranz.
Er hat Angst.
Zwei seiner Freunde sind mit ihm gekommen.
Kaum sechzehn Jahre alle drei.
Viel zu jung für den Krieg.
Johannes, Bohumil und Ferdinand.
Sie glaubten dem Plunder der Parolen.
Die Mädchen werden Kränze flechten.
Eitles Herz, berauscht von sich.
Vom Gerassel einer angeblich großen Zeit.
Sie wussten nicht, was das ist: eine Schlacht.
Johannes hat sich an den Rand des Lagers zurückgezogen. Zwischen drei Bäumen ist eine Plane gespannt, hier ist er geschützt. Er redet sich ein, dass er voll Vorfreude ist, begierig, in die Schlacht zu gehen und für Kaiser und Vaterland zu sterben. „Seinen Mann stellen“, auch das hat er oft gehört. Stirbt man leichter und leichtsinniger, wenn man jung ist? Warum kommt ihm jetzt Agáta in den Sinn, die zarte Geigenspielerin aus der Musikschule von Neustadt an der Mettau? Agáta, die ihn Jan oder Johánek nennt, eine weiche Melodie in ihrem Sprechen hat und ihm die Haut zum Brennen bringt? Er verdrängt ihr Bild und kommt wieder auf Tapferkeit und Mut und Ehre. So heißt es doch, so steht es in den Zeitungen und auf den Anschlägen an Rathäusern und Kirchen. So wird geredet überall und die Faust gereckt und Hurra gerufen. Was jedes einzelne Wort bedeutet, darüber denkt er nicht nach, die Worte sind groß und hehr und Rattenfänger.
Die drei Freiwilligen-Freunde wurden rekrutiert. Da die Zeit für die Befähigung zur Waffe kaum reichte, sie alle drei jedoch gute Musiker waren, wurden sie zunächst als Heeresmusiker angenommen: Johannes als Trompeter, Bohumil und Ferdinand als Trommler. Ein rudimentäres Trompetencorps für die Infanterie. Gegebenenfalls könnten sie in eine größere Formation eingegliedert werden, denn wichtig ist Musik im Kampf, aufputschend immer voran, tatámtatara, zum freudigen Angriff! Da lagen sie nun, in einer der zahllosen Einheiten der habsburgischen Armee am Fuße des Hügels von Chlum.
Nahe von Königgrätz.
Am Rand des Böhmischen Paradieses.
Johannes war der, der den Ton angab. Er war wendig in Körper und Kopf. Groß gewachsen und zäh. Sein Haar trug er immer länger als seine Kameraden, strich es zurück, wenn er träumte, ließ es über die Augen fallen, wenn er wütend war. Manche fanden, er wäre ein wenig wankelmütig. Schnell, vielleicht zu schnell begeistert, schnell entmutigt. Er lernte leicht, sprach sprudelnd, liebte jedoch mehr, was er verschwieg.
Vor allem liebte er das Trompetenspiel.
Das Strahlende an ihm, Engel mit den Posaunen.
Liebte das Laute und Wilde.
Es riss den Himmel auf.
Gold und Messing und Jubel.
Trompete war Überschwang und Schmetterei.
Schmeichelei in den leiseren Tönen.
Er war noch so jung.
Mühelos hatte Johannes die Klappentrompete erlernt und jüngst die vor kurzem erfundene Ventiltrompete, die noch etliche Gegner unter den Musikern hatte. Aber in Neustadt hatte er Herrn Procháska als ersten Lehrer gehabt und jetzt in Braunau den Kapellmeister Sorokin, der aus Czernowitz stammte und über ein reiches Musikrepertoire verfügte, beide hervorragende, aufgeschlossene Lehrer. Und das Signalhorn für die Schlacht war sowieso ein Leichtes. Die Töne flogen ihm voraus, es war, als ob er ihnen folgen und ohne Mühe zu den Wolken aufsteigen könnte.
Johannes entstammte einer gemischten deutschböhmisch-tschechischen Familie aus Neustadt an der Mettau/Nové Město nad Metují, Bohumil war Tscheche aus Pardubitz/Pardubice und Ferdinand war der Sohn von assimilierten jüdischen Eltern aus Wien. Sie gingen zusammen in das Gymnasium des Benediktinerklosters von Braunau an der böhmischschlesischen Grenze und durften bereits groß aufspielen mit Orchester und Orgel zur Feier des Heiligen Benedikt oder mit der Blasmusik an der Spitze eines Festzuges anlässlich der vielen Stadtfeste. Sie genossen den Jubel und fühlten sich wichtig.
Die blühende Stadt Braunau, tschechisch Broumov, liegt auf einer flussreichen Hochebene zwischen den Ausläufern des Falken- und Eulengebirges sowie in einem spannungsreichen Grenz- und Mischgebiet. Nur einen Steinwurf von der damaligen schlesisch-preußisch-polnischen Grenze entfernt, war seine Lage immer schon ideal für lebhaften Handel und gute Verkehrswege. Viele Sprachen waren auf dem ausladenden Marktplatz zu hören, Deutsch, Polnisch, Jiddisch, Ruthenisch und Tschechisch, das im größeren Raum von Böhmens Nordosten vorherrschend war. Das habsburgische Kaiserreich stand über allem, über Stadt, Kloster und rechtschaffenem Gedeihen, und verstand sich als Schirmherr gegenseitiger Toleranz. Die Wirklichkeit hat andere Draperien und drängt auf handfeste Lösungen.
Sonntagnachmittag im Kaffeehaus. Die Stunde, die die Freunde zur freien Verfügung hatten. Hier wurde Schach und Billard gespielt und unterschiedliche Zeitungen lagen auf: Die Neue Freie Presse und das Fremden Blatt aus Wien, die Prager Zeitung und die Schlesische Zeitung aus dem preußisch regierten Breslau. Sie fühlten sich sehr erwachsen, zündeten sich eine Zigarette an und schlugen ein Bein über das andere. Inmitten von Qualm, zitternden Staubpartikeln und der Geräuschkulisse leisen Gesprächs lasen sie von Aufrüstung und Abrüstung und von neuerlicher, sogar verstärkter „geheimer“ Rüstung. Sie verfolgten die gegenseitigen Vorwürfe, Bezichtigungen und Beschuldigungen, die Lügen und die Prahlereien. Lasen von Wahrheit und Gerechtigkeit und immer war Gott im Krieg dabei, mit Überzeugung auf jeder Seite. Im Gymnasium der Benediktiner war es klar, auf welcher Seite Gott stehen würde, auf der österreichischen selbstverständlich, auf der katholischen. Die meisten Patres predigten den Angriff auf die preußischen Protestanten.
Nur einer, ein Mann mittleren Alters namens Korbinian, der neu in das Kloster gekommen und offensichtlich kein Ordensmitglied war, fand einen anderen Zugang. Johannes fühlte sich spontan zu ihm hingezogen. Korbinian lehrte Poesie, Grammatik und Geschichte, aber sein Unterricht unterschied sich vom übrigen. Am Ende einer Stunde forderte er seine Zöglinge auf, nachzudenken. Zum Beispiel über jene Stelle aus Homers Ilias, der zufolge Achill den besiegten Hektor von schnellen Rossen um das Grab seines Freundes Patroklos schleifen lässt, zwölf Tage lang. Oder sich in einen Soldaten zu versetzen, der beobachtet, wie sein Feldherr Napoleon mit der Leibgarde sicher über die Beresina setzt, während Abertausende in panischer Flucht vor den russischen Verfolgern niedergemetzelt und auf den übrigen einstürzenden Brücken zertrampelt werden, im eiskalten Fluss ertrinken und auf den Bergen ihrer angeschwemmten Leichen neue Brücken errichtet werden.
Johannes, Bohumil und Ferdinand hatten wenig Lust, darüber nachzudenken. Das eine Beispiel war Mythos, das andere gemildert durch die Tatsache, dass Napoleon von gerechter Strafe ereilt, schließlich besiegt und auf St. Helena verbannt wurde. Außerdem lagen die Begebenheiten so weit zurück, was sollte sie das angehen, sie, die gerade sechzehn waren und alles, was sich vor ihrer Geburt ereignet hatte, als Kehricht ansahen.
Die Wirklichkeit ist offen und elastisch, hatte Pater Korbinian gesagt. Sie heißt alles willkommen – die Tatsachen, die es gibt, wie Granit und Granatäpfel, und jene, die sie schafft durch bravouröse Rhetorik, wie Krieg und Frieden. Aber da waren die drei schon beim Trommeln und Trompeten.
Als die Kunde vom nahenden Krieg kam, wurde das Konvikt geschlossen und die Schüler wurden nachhause geschickt. Auf der Postkutschenreise redeten sie sich in Euphorie. Weg von Kloster und Gott, weg von daheim, den Maßregelungen und dem Alltäglich-Langweiligen. Hin zu Abenteuer, Dreinhauen und Nichts-gefallen-Lassen. Vom Feind. Die Preußen wären sich zwar ihrer Überlegenheit durch straffe Disziplin und das hochmoderne Zündnadelgewehr gewiss, was sollte dieser Schlagbolzen jedoch ausrichten gegen „eine Million auserlesener Soldaten“ der Österreicher? Eine Viertelmillion sei schon auf dem Weg, Soldaten aus Böhmen, Mähren und Wolhynien, aus Galizien und Lodomerien, Ungarn, Österreich und Illyrien, Kroatien, Dalmatien und Slawonien… Und im Kopf gingen die Reden von Hass und Hetze im Kreis. Also nieder mit dem Feind!
Sie debattierten mit brennendem Herzen und wenig Verstand. Redeten sich in einen heißen Wirbel im Getrappel der Pferde, und Habsburg wurde immer besser und Preußen immer schlechter, der Kaiser in Wien ein sorgender Vater für seine Völker, der preußische König und sein Ratgeber Otto von Bismarck hingegen Vertreter von „Blut und Eisen“, Habsburg wurde zur Schirmmacht und Preußen zum Aggressor, und das, nein, das wollten sie denn doch nicht dulden, die drei in der Postkutsche, so weit waren sie gekommen, als sie durch die dichten Wälder des Falkengebirges hinunter nach Hronov und durch Nachod fuhren. Und als bald danach Neustadt an der lieblichen Mettau vor ihnen lag, wo Johannes zuhause war, war der Entschluss gefasst: Dass sie für Kaiser und Vaterland kämpfen würden auf Biegen und Brechen. In den Krieg!
Was sollt ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen
Und blutig, bleich und blaß
Die Geister der Erschlagnen zu mir kämen,
Und vor mir weinten, was?
Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten,
Verstümmelt und halb tot
Im Staub sich vor mir wälzten und mir fluchten
In ihrer Todesnot?
2. Juli abends.
Kalter Regen fällt auf die Soldaten nieder.
Johannes lehnt an einem Baumstamm am Rand des Infanterie-Feldlagers Nr. … Die genaue Bezeichnung hat er sich nicht gemerkt. Die eilige Verlegung gab ihm keine Möglichkeit mehr, seinen Eltern Ort und Abteilung zu schreiben. Erst seit kurzem weiß er, dass der Ort hier Chlum heißt. Das Dorf liegt auf der Kuppe eines bei Schönwetter weithin sichtbaren Hügels und besteht nur aus einer Handvoll Häusern, umgeben von Feldern und Wiesen von großer Fruchtbarkeit. Vom Tal der Elbe aus gesehen ruht es wie eine Verheißung unter dem Blau des Himmels und den Sternen der Nacht.
Aber es war Krieg.
Chlum wurde zum strategischen Orientierungspunkt für die Heerführer beider Lager. Auf österreichischer Seite war es Feldzeugmeister Ludwig August Ritter von Benedek, Preußens Heerscharen wurden angeführt von König Wilhelm I. und seinem Generalstabschef, Helmuth von Moltke. Die tragische Geschichte Benedeks wird in zahlreichen Berichten und Büchern beschrieben werden und Johannes wird sie Jahre später lesen – aber morgen schon, bereits am Abend nach der Schlacht, wird Benedek als zögerlich bis unfähig beurteilt werden, Moltke als genial.
Düster die Wolken, regenverhangen der anbrechende Abend.
Im Lager Unruhe, Hektik, Kommandos. Vereinzelt ein Streit. Das Klirren von Gläsern aus einem Zelt, Singen. Artillerie wird in Stellung gebracht. Munition aufgefüllt. Granaten und Schrapnells in Kisten dorthin und dahin getragen. Säbel werden in die Scheide gesteckt. Bajonette auf den Vorderladergewehren geschärft. Pferde gefüttert und gestriegelt. Sättel aufgebockt. Offiziere abseits im Gespräch. Ordonanzen eiligen Schritts. Ein Reiter kommt im Galopp aus Richtung Josephstadt an der oberen Elbe, wo Benedek sein Hauptquartier aufgeschlagen hat.
Johannes spielt leise auf seiner Trompete.
Er spielt eine Fuge von Bach.
Bohumil und Ferdinand kommen angerannt.
Rufen: Morgen!
Morgen geht es los!
Wenn tausend, tausend Väter, Mütter, Bräute,
So glücklich vor dem Krieg,
Nun alle elend, nun alle arme Leute,
Wehklagten über mich?
3. Juli 1866.
Der Schlaf kam als Gaukler in dieser Nacht. Ließ schlafen und erwachen und aufschrecken und Johannes trieb es in dieses Morgen und zurück ins Gestern. Und fragte und zweifelte und war zerzankt mit sich. Flugsand von Erinnerungen. An die Mutter, die sich abwandte, als er ging, an die zornige Geste des Vaters, des Tischlermeisters Quirin Czermak, der sich an die Stirn schlug und in einem ausholenden Bogen die Hand resigniert sinken ließ, an Cäcilia, die Schwester, die am Fenster stand und die Hände über der Brust kreuzte. Aber waren nicht die beiden älteren Brüder, Franz und Karl, längst in der Armee? Sie mussten ja, als die Mobilmachung ausgerufen wurde. Karl, der sich Karel nannte, wollte zwar nicht gehen, aber Franz ging pflichtbewusst. Im Halbschlaf wurde Johannes von groben Männern fortgezerrt, er riss sich los im Traum und flüchtete in die Tischlerwerkstatt des Vaters, roch den Leim, hörte das Hämmern und Nageln, draußen war Winter, der Platz mit den Arkaden war zugeschneit, es war sein Marktplatz, sein Städtchen, in dem er geboren war und das er in sich trug als glückliche Selbstverständlichkeit: Neustadt an der Mettau. Ein Kleinod sei es, hörte er seit seiner Kindheit sagen, ein Renaissance-Juwel, auf eine steil abfallende Tonschieferrippe gebaut, an drei Seiten von der Mettau umflossen, alte Bürgerhäuser, ein Schloss und eine Kirche in der Diagonale des Stadtplatzes, in dessen Mitte eine Dreifaltigkeits- und eine Mariensäule zum Schutz aller Menschen, die hier lebten. Die Tschechen nennen das Städtchen Nové Město nad Metují und ihn, Johannes, nennen sie von klein auf Jan und beides war ihm recht,
– und als der Morgenappell durch den Regen hindurch die Zeltgassen entlangtönt, war er im Traum doch gerade Schlittschuhlaufen auf der zugefrorenen Mettau, es krachte, das Eis barst,
– und zum zweiten Mal wird zur Tagwache geblasen, lauter diesmal, drängender, auftaumelnd stößt Johannes mit Bohumil zusammen, der ihn an den Schultern rüttelt, alle drei springen in die Montur, nehmen ihre Instrumente, Trommel und Signalhorn, das lauter ist, auch ordinärer als die schlanke Trompete, gut für das Aufpeitschen der Soldaten, um sie voranzujagen und ihnen die Angst vor dem Tod und dem Töten zu nehmen. Gewehre mit aufgepflanzten Bajonetten hängen um ihre Schultern, denn auch die Musikanten müssen zur Waffe greifen, wenn das Mutmachen zu Ende und der Schlachtenruf zum dritten oder vierten Mal verklungen sein wird, – Johannes, Bohumil und Ferdinand spielen sich in einen Rausch, tatütatü-tatámtatara, sie stürmen mit der ganzen Kompanie den schlammigen Acker des Hügels von Chlum hinauf, wie durch ein Wunder überleben sie den mörderischen Kugelhagel der preußischen Zündnadelgewehre, die vier-, fünfmal schneller nachladen und schießen können als die hoffnungslos veralteten Vorderlader der österreichischen Truppen, sie stürmen im Schein des brennenden Kirchturms, dichter Nebel und der Gestank verbrannten Pulvers liegen über dem Schlachtenlärm, sie werden zurückgeworfen, greifen wieder an, Dröhnen der Kanonen, Splittern von Granaten, ein verirrtes Schrapnell, das vorzeitig in der Luft explodiert, prasselt wie Hagel auf die Erde nieder. Eine Rast ist ihnen vergönnt bis Nachschub kommt, endlich Verstärkung.
Bei einem Schluck kalten Tees hält Johannes inne und sieht, welch farbenprächtiges Bild die unterschiedlichen Regimenter bieten, die sich in der Ebene von Königgrätz in Formation bewegen, Infanterie, Kavallerie und Landwehr: Eine Symphonie in Weiß, Dunkelblau und Mittelblau, Kragen und Manschetten mit Gold, Rot oder Orange verziert, Messingknöpfe und Verschnürungen blitzen auf, Braun und Grau manche Waffenröcke, krapprot die Hosen der Husaren, leuchtend die Federbüsche, Tschakos und Kappen, ruhmreich ausstaffiert zum Sieg, eine hellfröhliche Buntheit alten Standesbewusstseins und gehegter Traditionen, und es scheint ihm, dass es –,
– dass es eine festliche Friedensparade wäre.
Und sie heimgehen könnten.
Nachhause.
Hügelauf sind die Hänge und Hohlwege jedoch übersät mit Toten, Verwundeten und Sterbenden, ihr Schrei schießt in Ohr und Hirn, die Stabs-Damianner hetzen im Ritt über die Felder, um die Verwundeten aufzuspüren, viel zu wenige können von den Sanitätern fortgeschafft werden, Blessierten- und Bandagenträger rufen sich Unverständliches zu, die Verbandsplätze sind überfüllt, die Feldspitäler am Rand ebenso.
Noch ein letzter Angriff, schallt der Befehl durch die Reihen!
Für Kaiser und Vaterland und Sieg!
Wer Chlum erobert, gewinnt die Schlacht!
Von Euch hängt es ab, Soldaten, von Euch!
Stürmt, schießt, kämpft bis zum Letzten!
Und Johannes, Bohumil und Ferdinand marschieren wieder mannhaft in das mörderische Feuer, tatütatütatüüüü-tatámtatara, nur zu, damit es vorbei ist, endlich zu Ende, Kartätschen und Vierpfünder nehmen sie unter Beschuss, Äste, Steine und Splitter fliegen durch die Luft, die Ruthenen zur Linken versuchen zu fliehen, auf der rechten Seite hören sie von der Ebene herauf die Kapelle der Hoch- und Deutschmeister die Hymne „Gott erhalte, Gott beschütze/Unsern Kaiser, unser Land“ spielen, und lauter blasen und trommeln die Drei, tatütatü-tatámtatara, Inferno von Kugeln, Schrapnells und Granaten, der Fahnenträger stürzt, es stürzen die Vielen rundum, jeder schießt und sticht um sich, so viel er kann –
Rausch des Krieges
Irrwitz des Tötens – – – –
Wenn Hunger, böse Seuch und ihre Nöten
Freund, Freund und Feind ins Grab
Versammleten, und mir zu Ehren krähten
Von einer Leich herab?
Was hülf mir Kron und Land und Gold und Ehre?
Die könnten mich nicht freun!
’s ist leider Krieg – und ich begehre
Nicht schuld daran zu sein!
4. Juli, früh am Morgen.
Ein Mann im langen schwarzen Gewand geht langsam über den Höhenrücken von Chlum. Der Regen hat aufgehört, der Nebel sich gelichtet. Das Dorf ist zerstört, der Kirchturm ein Trümmerhaufen, aus dem immer noch Rauch aufsteigt. Die wenigen Häuser sind bis auf die Grundmauern zerschossen, verwüstet die Bauerngärten. Auf den Dorfwegen, Feldern und Wiesen liegen die Leichen. Das Wäldchen ist zerfurcht von Schützengräben, sie sind voll Blut. Und dunkelrot sind die Hohlwege, die zu ihm hinaufführen, keine Erde mehr zu sehen, kein Lehm, kein Gras. „Hohlweg der Toten“ wird in den Büchern stehen. Die Bäume sind kahl vom Beschuss der Artillerie, schwarz stehen sie da im Grauen des Morgens. Die letzten Fackeln der Patrouillen, die nach Überlebenden suchten, sind verlöscht. Die Leichenplünderer sind weg.
Der Mann im langen Habit geht über das Schlachtfeld.
Stunde um Stunde.
Mittag ist vorüber.
Der König von Preußen, Wilhelm I., kommt mit seiner Entourage das hügelige Schlachtfeld heraufgeritten. Am späten Abend zuvor hat er seiner Gemahlin nach Berlin noch ein Telegramm geschickt: „Vollständiger Sieg über die österreichische Armee … Ich preise Gott für seine Gnade; wir sind alle wohl.“ In der hereinbrechenden Dunkelheit war rings der Feuerschein der brennenden Dörfer zu sehen und aus einem der Lager war ferne Musik zu hören gewesen, Märsche vergangener Siege, der Dessauermarsch, der Hohenfriedbergermarsch … Und als der Zapfenstreich erklungen wäre, so wurde berichtet, hätte sich der feierliche Choral „Nun danket alle Gott“ von Bataillon zu Bataillon fortgepflanzt über die nächtliche Ebene.
„Ein bisschen viel Gott“, wird Karl, Johannes’ mittlerer Bruder, der Karel genannt werden will, später zu seinem Vater sagen. „Und praktisch ist es auch: Man bedankt sich für eine Gnade, die einem geschenkt worden ist, somit ist das, was man getan hat, richtig und gottgefällig und somit müssen sich Kaiser-König-General nicht schuldig fühlen. Bravo!“
Der Mann im langen, weiten Gewand geht über das Schlachtfeld.
Langsam, konzentriert und suchend.
Der König von Preußen erweist auf der Höhe von Chlum zwei hier gefallenen Kommandeuren die letzte Ehre. Die Trompeter blasen einen Trauermarsch. Sonst liegt Totenstille über den Wäldern, niedergebrannten Dörfern und dem zertrampelten Korn.
Die Pontonbrücken über die Elbe sind zerstört.
Der Sieger hat das Vorrecht, einer Schlacht den Namen für immer zu geben. Viele Dörfer im Umkreis hätten diesen zweifelhaften Ruhm verdient: Sadowa, Lipa oder Rosberitz, Langenhof, Problus oder sogar ein Wald, der zur Gruft für Tausende wurde, der Swibwald. Am meisten wohl Chlum, wo die erbittertsten und verlustreichsten Kämpfe stattgefunden hatten. Eine „Schlacht von Chlum“ jedoch hätte keinen Klang gehabt, kein Ansehen für die Nachwelt. In ungefähr zwölf Kilometern Entfernung liegt eine fürstliche, eine blühende, stolze Stadt: Königgrätz. Und der König nannte das blutige Geschehen vom 3. Juli des Jahres 1866:
„Die Schlacht von Königgrätz“
In den Geschichtsbüchern wird später zu lesen sein, dass die Schlacht von Königgrätz die größte Schlacht des 19. Jahrhunderts auf böhmischem Boden war. Zwischen 350 000 und 400 000 Mann wären sich gegenübergestanden. Man wird die Zahl der Toten, Verwundeten, Vermissten und Gefangenen auflisten, sogar die Anzahl der toten Pferde und verlorenen oder gewonnenen Geschütze. Wer jedoch hat die toten und verwundeten Männer, Frauen und Kinder in den Dörfern gezählt? Wer berichtete vom Elend der Überlebenden, deren Häuser und Scheunen verbrannt und deren Ernte, Werkstätten und Lebensgrundlagen vernichtet waren? Wer kann sagen, wessen ganzes Leben zerstört wurde, das Leben selbst, wenn über die Jahre hin in der Erinnerung nur der Krieg bleibt?
Vorboten nur des Kommenden.
Vorhölle – –
Noch ist der Tag des 4. Juli 1866 nicht zu Ende.
Von Johannes ist nichts zu berichten.
Auch nicht von Bohumil und Ferdinand.
Sie sind verschollen.
Auf dem Hügel von Chlum sucht der Mann im langen Habit nach Überlebenden.
Benedeks geschlagene Restarmee zieht inzwischen in Eilmärschen Richtung Südwesten mit dem Ziel Olmütz, wo man auf Verstärkung aus Wien hofft. Durch die heldenmütige Reiterschlacht bei Stresetitz-Langenhof und den langen, erbitterten Kampf um den Hügel von Chlum waren die Preußen an schneller Verfolgung gehindert worden. Einige der zurückflutenden Einheiten jedoch, die in der noch von den Österreichern gehaltenen Stadt Königgrätz Zuflucht suchen wollten, fanden sich zu ihrem Entsetzen vor verschlossenen Toren: Der Kommandant hatte sie in der Dunkelheit und Verwirrung für feindliche Preußen gehalten, hatte die Tore schließen, die Schleusen öffnen und das Gebiet vor dem Glacis durch das Wasser der Elbe überfluten lassen, so dass hunderte Soldaten ertranken oder in den Sümpfen erstickten.
Resümierend wird die Nachwelt dennoch festhalten, dass Benedek große Umsicht und Tatkraft bewiesen hätte, die restlichen österreichischen Streitkräfte, 180 000 Mann, zu retten und einen einigermaßen geordneten Rückzug zu organisieren.
„Ich bin mittendrin gewesen auf dem Marsch zurück“, erzählt Karel später im elterlichen Haus auf dem Stadtplatz von Neustadt an der Mettau, „das war ein Desaster, wer redet da von ‚geordnet‘? Im Straßengraben sind wir gelegen, haben unsere zerschundenen Füße gekühlt, elendiglich war das, kein Wasser, nichts zu trinken, im Kampfgebiet waren die Brunnen kaputt oder vergiftet, halb verhungert sind wir, war ja nichts mehr da, alles längst requiriert schon auf dem Hinmarsch, krepierte Pferde, kaputte Geschütze, alles drunter und drüber, alle Sprachen durcheinander, kein Mensch hat den andern verstanden, sechzehn Sprachen sind’s in der Armee, könnt ihr euch das vorstellen? Ulanen und ein paar zerlumpte Tiroler Jäger sind an uns vorbeigeritten, wir zu Fuß waren im Dreck, viele haben ihre Wunden selbst mit irgendeinem Fetzen verbunden, ununterbrochen sind Hilfstransporte an uns vorbeigefahren, die Bahnhöfe waren überfüllt und stinkend von Schwerverletzten und Verstümmelten, die auf einen Zug gewartet haben, die Strecken waren alle gesperrt für den Zivilverkehr, um diese Elendsgestalten, Hunderte und Tausende, nach Wien bringen zu können, kein Sinn im ganzen Krepieren, wozu die ganze Tapferkeit, die Cholera hat viele erwischt, wir waren so erschöpft, dass … Ach was, ihr habt ja doch keine Ahnung! Keine Ahnung habt ihr! Braucht das Zeug, das sie schreiben, gar nicht zu lesen!“
Der Mann im langen Gewand sucht nach Überlebenden.
Er kümmert sich nicht um die Heldenfeier des Königs von Preußen. Langsam geht er über das Schlachtfeld, den Blick zu Boden gesenkt, aufmerksam und von Zeit zu Zeit mit einem Stock etwas umdrehend, etwas, das einmal ein Mensch war. Er ist der preußischen Armee attachiert, aber er unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind. Er erkennt sie an der Uniform, aber es hat nichts zu bedeuten. Der Mann sucht nach Verwundeten. Prüft, ob nicht doch einer noch lebe. Nicht verblutet sei an zerfetztem Bein, offenem Gedärm oder einer Kugel im Kopf. Die Hoffnung ist nicht groß. Die Nacht ist kalt gewesen, der Tag ist schwül und heiß. Es ist fast zwanzig Stunden nach dem Ende der Schlacht. Große schwarze Vögel haben sich zu reicher Beute niedergelassen. Aber er hat früher mitunter noch nach drei, vier Tagen Überlebende gefunden.
Der Mann steigt stetig über den Tod.
Er scheint ein Ritter des Johanniterordens zu sein. Die Johanniter sind die Engel der Schlacht von Königgrätz. Alle sind sie freiwillig gekommen und haben ein kleines Heer besonderer Art mitgebracht: Ärzte, Geistliche, Krankenwärter und -wärterinnen, Bahrenträger, Schwestern und Brüder zur Pflege. Sie kamen, um die dem Militär unterstellten Hilfseinrichtungen zu unterstützen. Waren die ersten, die Lebensmittel und Verbandszeug in die Lazarette brachten, und bauten um die Kampfzone mit freiwilligen Spenden der Ritter bewegliche Krankenstationen auf. Für die Schwerverwundeten öffneten sie ihre großen Ordensspitäler vom Rheinland über Dresden bis zu den Städten Schlesiens. Zu ihrer Unterstützung integrierten sie kleine Gruppen von Männer- und Frauen-Kongregationen aus den unzähligen deutschen Kleinstaaten und Reichsstädten, wie Franziskaner, Barmherzige Schwestern, Alexianer-Brüder oder Cölestinerinnen zur Heiligen Maria. Schon am Nachmittag der Schlacht von Chlum standen siebzig Wagen der Johanniter zum Abtransport der Verletzten bereit.
Der Mann im langen Gewand ist seit Tag und Nacht und Tag auf den Beinen, ohne ein Stück Brot, nur mit einem Schluck Wasser. Er hat schon Viele gerettet. Er ist müde. Aber noch immer sieht man ihn suchen, langsam und gebeugt.
Und da – – hat er da eine Bewegung gesehen, eine winzige Bewegung? Das Heben einer Hand, eines Fingers vielleicht nur, aber doch eine Bewegung? War es Täuschung? Er kniet nieder. Tastet, prüft. Ein junger Soldat. Er hat ein zerschossenes Gesicht. Sein Mund ist ein Loch voll verkrustetem Blut. Der Rest eines Signalhorns liegt an einem dünnen Riemen neben seiner Schulter. Der Johanniter fühlt den Puls: der lebt! Ja, der lebt! Er springt auf, winkt den beiden Trägern, die am Waldrand gewartet haben. Kaum noch Wärme in diesem Häufchen Mensch. Ist eiskalt und totenblass, er muss große Mengen Blut verloren haben. Ein zweiter junger Soldat liegt zusammengekrümmt zwischen den Knien des ersten. Er ist tot.
Kinder, das sind ja fast noch Kinder!, ruft der Mann, als sie den Verletzten vorsichtig auf den zweirädrigen Karren betten und den aufgewühlten Hügel Richtung Lazarett hinunterfahren. Hat man sie einfach zur Schlacht getrieben, braves Schlachtvieh? Hatten die keine Väter, die es ihnen verboten haben, in den Krieg zu ziehen? Wer hat das zugelassen? Wer hat sie so verführt? Und schlägt sich auf den Kopf und rennt voraus. Die beiden Helfer sehen sich verschreckt an. Und leiser, zu sich selbst gesprochen am Rand des Zuckerrübenfeldes: Waren sie selbst so verblendet, so leichtsinnig, so ahnungslos? So überzeugt vom Siegen? Und wussten nichts vom Tod?
Warum? Wütend schreit er es hinaus: Warum? Da hilft kein Gott, kein Heiliger.
Er hat viel gesehen, ist schlachterfahren und abgestumpft, um es ertragen zu können. Aber dieser junge Soldat mit dem zerfetzten Gesicht erinnert ihn an einen anderen, der ihm nahe, sehr nahe war. Und den er in den Straßenschlachten von Prag während der Aufstände gegen die Habsburger im Jahre 1848 verloren hat.
Und den er nicht hatte retten können.
Der König von Preußen kommt zurück vom Hügel von Chlum. Mit seinem Gefolge reitet er an dem kleinen Elendszug vorüber. Die milchigen, feuchtigkeitsgetränkten Strahlen der Sonne dieses neuen Tages lassen die goldenen Uniformknöpfe aufblitzen. Zwei Offiziere lachen. Die Hufe der Pferde werfen Schlamm auf. Der Ritter von den Johannitern kümmert sich nicht darum. Er beugt nicht das Knie. Er schaut den Halbtoten an auf dem hölzernen Karren.
Du, sagt er still. Du, ja, du sollst gerettet werden.