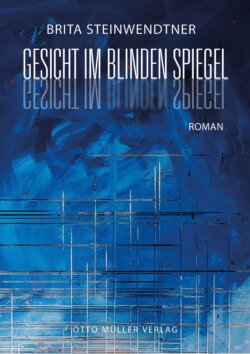Читать книгу Gesicht im blinden Spiegel - Brita Steinwendtner - Страница 9
II
ОглавлениеEin junger Soldat liegt im Lazarett von Jičín.
Es ist dunkel.
Es ist Nacht am Tag und Nacht in der Nacht.
Der Arzt kommt und geht, die Schwestern kommen und gehen. Er merkt es nicht. Nur wenn der Johanniter den Raum betritt, wo die Moribunden liegen, scheint er unruhig zu werden. Die dritte Woche nach der Schlacht geht zu Ende. Noch kann der Arzt nicht sagen, ob der junge Mann durchkommen wird. Er wisse auch nicht, sagt er zum Ordensritter, ob er es ihm wünschen solle. Die rechte Seite von Kinn und Wange ist schwer verletzt, die Unterlippe ein mühsam zusammengeflicktes Etwas. Ein Schrapnell, ein Granatsplitter, eine Gewehrkugel – es ist schwer zu sagen. Ein Glück, sagt der Arzt, dass der Kieferknochen nicht stärker zerstört ist. Ein Teil der Wunden hat zu eitern begonnen.
Der Patient hat hohes Fieber.
Schüttelfrost wirft ihn vom Lager auf.
Dann wieder bricht Schweiß am ganzen Körper aus.
Der Mann im schwarzen Gewand sitzt an seiner Seite.
Viele Tage und Nächte, wenn es der Dienst erlaubt.
Er redet mit dem immer noch Bewusstlosen.
Nimmt die leblose Hand.
Redet ruhig, aber stetig und erzählt ihm Geschichten von der Schönheit. Vom Glanz der Sommertage draußen über dem Stadtplatz von Jičín, über den sich der Himmel blau wölbt, als ob nichts geschehen wäre, über den kleine Wolkenbänke ziehen und nachts der Mond aufgeht als Hort der Träume. Erzählt, wie unter den Arkaden das Leben weiterläuft, der Schneider einen neuen Herrenanzug in der Auslage drapiert, eine Bäuerin aus ihrem Weidenkorb Eier, jungen Lauch und rote Ribisel verkauft und in den Wirtshäusern Bier und Nussschnaps ausgeschenkt werden. Dass beim Uhrmacher ein Schild an der Türe hängt mit der Aufschrift „Geschlossen durch Tod von Meister und Lehrbub“ erzählt er nicht und ebenso wenig, dass viele schwarz gekleidete Frauen über das Pflaster gehen, die adeligen Damen mit wehendem Witwenschleier bis zum Boden. Er verschweigt, dass Wehklagen aus den offenen Fenstern zu hören ist und dass der eine oder andere Amputierte den ersten scheuen Ausgang versucht, mühsam das Gehen mit Krücken erlernend mit nur einem Bein oder das Gleichgewicht suchend mit nur einem Arm. Dass Kinder an den Ecken stehen und die Hand aufhalten, die Augen groß vor Hunger. Wenn er daran denkt, schweigt der Johanniter eine Weile. Hält die Hand, streicht mit einem Tuch über die schweißnasse Stirn. Lüftet die Bettdecke. Und beginnt vielleicht wieder zu reden, bevor er geht, und erzählt, dass in den Gärten und Alleen die Akazienblüten ihren verrückt machenden Duft verströmen und die Abende lau und still sind.
Und dann erzählt er von der Liebe.
Niemand wusste, wie der Verletzte hieß. Woher er kam und wen man verständigen könnte. Alles, was Auskunft über die Identität hätte geben können, war zerschossen und verloren. Man erkannte an der Kleidung, dass er Österreicher war, zumindest auf der österreichischen Seite gekämpft hatte. Aber man wusste nicht genau, in welcher Kompanie, unter welchem Kommandeur. Viele von ihnen waren tot. Allein bei den letzten Angriffen auf Chlum und Umgebung hatte das I. Korps, Benedeks letzte Reserve, fast 300 Offiziere und beinahe 6 000 Mann verloren. Abertausende waren von den Preußen gefangen genommen worden. Es gab zwar Verbindungen unter den Lazaretten beider Seiten, den Stellen für Gefangenenaustausch und auch zwischen den Organisationen, die sich um den Verbleib der Vermissten bemühten.
Aber es herrschte Chaos.
Die Restarmee der Habsburger war auf der Flucht.
Die Preußen drängten nach.
Die einen kämpften ums Überleben.
Die anderen waren im Siegestaumel.
Man musste also warten.
Sich gedulden, bis der Verletzte sprechen konnte.
Falls er je sprechen können sollte.
Oder schreiben.
Es war die sechste Woche nach der Schlacht von Königgrätz.
Der Sommer hatte sich das Böhmische Paradies als sein bevorzugtes Reich gewählt und bedachte es mit allen seinen Gaben. Mit stetem Schönwetter, erträglicher Hitze, milden Gewittern. In den späten Stunden des Tages legte sich angenehme Kühle über Land und Menschen. Morgens stiegen die Lerchen in den tiefblauen Himmel und abends sang die Amsel zur guten Nacht. In den Randgebieten des Paradieses, wo keine Truppen durchgezogen und keine Kämpfe stattgefunden hatten, war das Getreide geerntet, reifte der Hopfen, röteten sich die Birnen und blühten die Levkojen in den Gärten.
In den Hügeln und Tälern um Rosberitz, Sadowa und Chlum, um Skalitz und Königgrätz sowie in den weitläufigen Ebenen an den Ufern der oberen Elbe begann unter der leisen Melodie der Trauer ein neuer Tag. „Wiederaufbau“ wird es benannt nach jedem Krieg. Die Menschen weinten und arbeiteten. Suchten zusammen, was geblieben war: eine Erinnerung, einen Kinderwagen, eine Säge, ein paar Ziegel, einen Flecken Erde. Sie gingen schlafen und sie gingen ans Tagewerk und sie gingen auf den Friedhof. Sie gingen zur Sonntagsmesse irgendwo in den Trümmern oder blieben trotzig zuhause und irgendwann merkten sie, dass sie überlebt hatten und suchten nach einer Zukunft, vielleicht nach einer kleinen zärtlichen Berührung.
Helmuth von Moltke besetzte Prag, das geschlagene österreichische Heer flüchtete weiter Richtung Wien. Bekam Verstärkung von Erzherzog Albrecht, der von der siegreichen italienischen Front zurückberufen worden war. In Niederösterreich wütete die Cholera, gierige Trabantin großer Heereszüge. Ministerpräsident Otto von Bismarck, der wie keiner sonst zur Entscheidungsschlacht gedrängt hatte, verhinderte zur Überraschung aller nun die Fortsetzung des Krieges mit besseren Argumenten: Das Ziel, Österreich aus dem Deutschen Bund zu verdrängen, wäre erreicht, jetzt aber wäre es klüger, den Gegner für zukünftige Zusammenarbeit zu gewinnen. Am 23. August 1866 wurde in Prag Frieden geschlossen.
Um den Mann im langen schwarzen Gewand, der sich Johanniter nennt, ist eine Aura des Unerklärlichen. Wie nicht ganz von dieser Welt, wie zwischen den Zeiten.
Jetzt öffnet er leise die Tür zum Krankenzimmer. Bleibt eine Weile, geht und kommt wieder und setzt sein stilles Reden fort, du sollst wissen, mein kleiner Soldat, sagt er, dass ein Aufatmen durch das Land geht. Es war ein unseliger Bruderkrieg, aber jetzt ist Frieden. Wenn du aufwachen wirst, wirst du wissen, was das bedeutet: Frieden. Du wirst es erstmals erkennen. Und du wirst später – glaub es mir einfach, Lieber – den Dichter Theodor Fontane lesen, er wird diesen Krieg den „Deutschen Krieg“ nennen und dies zu einer Zeit, in der Preußen bereits den nächsten Krieg siegreich beendet haben wird. Es wird überhaupt viel geschrieben und spekuliert werden, in Berlin auf diese Weise, in Prag auf jene, in Wien auf eine dritte Art und in Lemberg, Sarajewo, Paris oder Venedig noch einmal anders.
Venetien, auch das sollst du wissen, ist übrigens in seinem italienischen Teil für Österreich verloren. Es ist eine geheime Schacherei der Mächtigen gewesen, dennoch hat man mit Trommeln und Trompeten nur wenige Tage vor Königgrätz zur Schlacht von Custoza geblasen. Sie ist von den Österreichern gewonnen worden, aber es war sinnlos. Verbrecherisch sinnlos die Toten, Verwundeten, Elenden auf beiden Seiten. Venetien war verloren, bevor die ersten Kampfhandlungen begonnen haben …
Der Kranke stöhnt auf.
Durch das offene Fenster ist das Wiehern eines Pferdes zu hören, dann ein Kinderlachen, das Springen eines Balls. Leichter Wind bewegt die Vorhänge.
In das Haus Nr. 1223 in Neustadt an der Mettau, dem Haus mit dem Schaf als Emblem auf der Fassade zum Marktplatz, war in den Wochen nach der Schlacht von Königgrätz das Schweigen eingezogen. Die Eltern schwiegen, die Tochter schwieg. Die beiden älteren Söhne hatten die Kämpfe überlebt. Franz, der Älteste, war wieder nach Wien abgereist, wo er nach Abschluss des Polytechnikums schon vor dem Krieg eine Stelle im Eisenbahnministerium gefunden hatte. Er war ungern gefahren. Unter den Geschwistern liebte er Johannes am meisten, den Jüngsten, der an seinem großen Bruder hing wie am Leitstern seines Lebens. Johannes war der kleine Rausch in einer nüchternen Familie gewesen, er lachte und wirbelte durch die Wohnung und später spielte er Trompete. Mit elf Jahren hatte er begonnen, er hätte es schon viel früher tun wollen. Aber der Musiklehrer hatte davon abgeraten, denn zuerst müssten Zähne, Kiefer und Lippen gefestigt sein, um einen entsprechenden Druck und eine präzise Spannung aufbauen zu können. Aber elf, zwölf Jahre, da könne man beginnen. Und: der Bub habe großes Talent – das sagte er bereits nach kurzer Zeit. Franz wollte in Wien im Kriegsministerium Nachforschungen betreiben, ein Zeichen finden, einen Hinweis, eine Hoffnung. In den Gefangenenlisten schien Johannes nicht auf, das wussten sie.
Karel, der es sich verbat, Karl gerufen zu werden und der Neustadt an der Mettau nicht anders als mit dem tschechischen Namen Nové Město nad Metují in den Mund nahm, hatte noch ein Jahr des verhassten Militärdienstes zu leisten. Er war kein Pazifist, neigte mitunter sogar zu Gewalttätigkeit. Aber es war die k.k. Armee des Habsburger Reiches, dem er nicht dienen wollte und das den Bestrebungen nach einer unabhängigen tschechischen Nation im Wege stand. Er hatte vor, nach Absolvierung seines Dienstes nach Prag zu gehen. Er wusste noch nicht, was genau er dort wollte, aber es war Prag, wohin er musste, in Prag wurde die tschechische Sache vertreten, in Prag war was los, sagte er. Er nahm die Sache mit Johannes, und wieder sagte er „die Sache“, leichter als die übrige Familie. Er wird schon auftauchen, der Kleine, sagte er, und zum Vater: „Hättest ihn halt nicht gehen lassen sollen.“
Der Vater Quirin Czermak war ein milder Mann. Er hatte weder mit Drohungen noch mit klugen Einwänden den stürmisch-überzeugt-verblendeten Johannes daran hindern können, sich freiwillig zu melden. Er wusste auch den radikal-tschechischen Ansichten Karels nichts entgegenzusetzen. Quirin hielt sie für das Ergebnis von Agitatoren, denn er hatte Zeit seines Lebens die friedliche Koexistenz gelebt und war dafür eingestanden. Er selbst hatte gemischt österreichisch-tschechische Ahnen, wie sein Vor- und Zuname zeigten, und seine Frau Rosa, die Mutter seiner vier Kinder, war die Tochter eines tschechischen Bauern. Alle in der Familie waren – besser oder schlechter – zweisprachig, mit Vorliebe zum einen oder anderen Idiom, aber dennoch geübt in beiden. So nahm er Karels Verhalten als Zeichen der Zeit und fand Trost in der Beobachtung, dass der ideologische Riss in vielen Familien durch die Generationen ging.
Die Unsicherheit über das Schicksal von Johannes hatte die Lichtlosigkeit in das Haus gebracht, die leiseren Schritte, die freudlosen Mahlzeiten. Die Mutter weinte, wenn sie alleine war. An manchen Sonntagen ging sie zur alten Holzkirche hinaus, die im sechzehnten Jahrhundert für Johannes den Täufer vor den Toren der Stadt erbaut worden war und einsam am Rand der Wälder lag. Nach ihm, dem Heiligen, hatten sie ihren Jüngsten getauft. Quirin glaubte, Schuld zu sein am Weinen, am Weggehenlassen, dem ganzen Unglück. Nicht, dass ihm jemand Vorwürfe gemacht hätte, aber unausgesprochen vielleicht doch. Franz nahm das Ereignis als freie Entscheidung des kleinen Bruders. Sie hatten in Erfahrung gebracht, dass Bohumil tot war, hatten den Eltern in Pardubice kondoliert und bedauert, dass sie nicht von der Totenfeier benachrichtigt worden waren. Sie hätten gerne erfragt, ob Bohumils Eltern Genaueres über die letzten Tage vor der Schlacht wüssten, ob sie herausgefunden hätten, wo genau, in welchem Kampf, unter wessen Kommando Bohumil zu Tode gekommen wäre – sie waren jedoch auf kühle, fast feindselige Ablehnung gestoßen und mit der Auskunft abgefertigt worden, dass man nichts wüsste. Auf dem Partezettel stand nur: Geboren am … Gestorben am 3. Juli 1866. Der dritte der drei Freunde, Ferdinand, war möglicherweise von den Preußen gefangen genommen worden. Franz hatte dessen Namen in den Gefangenenlisten gefunden, es hatte sich jedoch herausgestellt, dass es nur eine Namensgleichheit war, und von einem sechzehnjährigen Ferdinand Weiss aus Wien gab es vorläufig keine Kenntnis. Die Behörden versprachen weitere Nachforschungen. Ferdinands Eltern übersiedelten bald darauf nach Czernowitz, von wo aus sie alles versuchen wollten, um den Verbleib der Söhne herauszufinden.
Quirin Czermak stand in seiner Werkstatt an der Rückseite des Hauses Nr. 1223.
Er blickte in das sonnige Gärtlein.
Nahm gedankenlos ein Werkzeug zur Hand.
Legte es wieder hin.
Dachte daran, wie alles geworden war.
Die Werkstatt hier war ihm längst zu klein, darum hatte er am Ufer der Mettau ein leerstehendes Gebäude gemietet. Er selbst ging mehrmals am Tag den steilen Fußweg mit den vielen Treppenabsätzen hinunter, um den beiden Gesellen und dem Lehrbuben Anweisungen zu geben und die Arbeit zu überwachen. Quirin war Kunsttischler und weithin bekannt für seine Geschicklichkeit und seinen ästhetischen Sinn. Vom Lehrbuben in Jičín hatte er sich zum gesuchten und hoch geschätzten Kunsttischler mit zwei Betrieben in Neustadt emporgearbeitet. Er war ernst und zuverlässig und lieferte pünktlich. Sein Ruf gründete sich vor allem auf seine Fertigkeit, Kommoden und Kästen, Tische und Sessel sowie kleinere Einrichtungsgegenstände und Schatullen in barockem Stil anzufertigen. Das war gerade in Mode gekommen und beliebt in Adelskreisen und bei zu Ansehen und Reichtum gekommenen Bürgern. Er war viel unterwegs in den zahlreichen Schlössern und neuen Villen des Böhmischen Paradieses, des Glatzer Grenzlandes und des Königgrätzer Kreises. Wenn er eine neue Bibliothek mit verzierten Einbauten auftragsgemäß ausgeführt hatte und die Bücher wieder in Reih und Glied standen, nahm er mit Staunen diese für ihn neue Welt wahr. Er hatte Scheu und Ehrfurcht davor. Und erzählte zuhause den damals noch kleinen Kindern davon, mit unterschiedlicher Resonanz. Nur Johannes hatte große Augen gemacht und wollte das nächste Mal mitgenommen werden. Rosa bewunderte liebevoll ihren Mann, der begonnen hatte, sich selbst eine kleine Bibliothek zu bauen, Bücher zu kaufen und sie auch zu lesen. Rosa war auf einem Bauernhof aufgewachsen, auf dem die tägliche Mühsal und Sorge um Kuh, Krautkopf und Heuschober das Leben bestimmt hatten, nur ein Kalender hing an der Küchenwand mit Heiligengeschichten.
Bei der adeligen Herrschaft von Neustadt war Herr Czermak beliebt. Das Schloss, das auf dem Felsrücken hoch über der Mettau lag, hatte mehrmals die Besitzer gewechselt, von den Leslies zu den Liechtensteins bis zu den Lambergs und anderen. Die herrschaftlichen Familien wohnten schon lange nicht mehr hier, sie kamen nur kurz auf Besuch und hatten einen Verwalter eingesetzt. Wichtig für sie waren allein die beträchtlichen Erträge aus Land-, Forst- und Handelswirtschaft. Dass diese mit zunehmender Liberalisierung und dem Aufkommen weitläufiger Industrieanlagen kleiner wurden, nahmen sie mit Unmut zur Kenntnis.
„Groß genug für das Adelspack“, sagte Karel, „jagt sie zum Teufel, diese österreichischen Ausbeuter!“
„Vergiss nicht“, entgegnete der Vater, „dass unter ihnen auch viele böhmisch-tschechische Geschlechter waren und sind, die Wallensteins zum Beispiel, die ursprünglich Valdštejna geheißen haben, wie du weißt, die Trčkas, Kinskys und so weiter –“
„Egal, sie haben uns alle lang genug regiert und ausgesaugt! Und die meisten sind ja doch aus Wien gekommen, zumindest aus dem Dunstkreis des Kaisers, dem das reiche Böhmen brav den immer leeren Säckel gefüllt hat.“
„Gebt doch Frieden“, sagte Rosa und brachte die süße Nachspeise. Der Nebel stand vor den Fenstern der Wohnstube im ersten Stock des Hauses am Marktplatz von Neustadt an der Mettau oder Nové Město nad Metují, dem Städtchen, das abseits lag und nur ein kleiner Reflex auf der Spiegelwand der großen Weltbühne war.
Der ganze Besitz des Schlosses zeigte Spuren von Verfall. Ab und zu kam die Gräfin Elisabetta, die volksnah und in vielen karitativen Organisationen tätig war, um nachzusehen und das Schlimmste zu verhindern. Sie hatte Quirin beauftragt, die vom Holzwurm zerfressene Bibliothek zu restaurieren. Es war eine langwierige und mühsame Arbeit. Die Gräfin unterhielt sich gerne mit dem Tischler. Eines Tages brachte sie einen bescheidenen Imbiss, schenkte aus einer verstaubten Flasche zwei Gläser Weißwein ein und forderte ihn auf, Platz zu nehmen.
„Lernt einer Ihrer Söhne nicht Trompete?“
„Ja, Johannes, der Jüngste.“
„Er geht doch in die Musikschule, die ich unterstütze?“
„Ja, seit zwei Jahren schon.“
„Scheint sehr begabt zu sein.“
„Das freut mich zu hören, Frau Gräfin.“
„Ist er auch ein Leser?“
„Ich glaube, auch das bejahen zu können.“
„Liest er mit Freude und Eifer?“
„Darüber könnte Ihnen meine Frau besser Auskunft geben. Eingeschrieben ist er jedenfalls im hiesigen Lesezirkel Zur Slawischen Linde, die, wie Sie wissen, nach dem Revolutionsjahr 1848 gegründet worden ist. Und in den Ferien bringt er aus dem Gymnasium von Braunau jeweils einen Stapel Bücher mit nachhause, die er sich aus der Klosterbibliothek leihen darf.“
„Dann habe ich ein Geschenk für ihn.“
„Frau Gräfin –?“
„Den Trompeter von Säckingen.“
„Ist mir nicht bekannt.“
„Joseph Victor von Scheffel hat das Buch geschrieben.“
„Es wäre meinem Sohn sicher eine Ehre! Verbindlichsten Dank, Frau Gräfin.“
Johannes war damals dreizehn Jahre alt. Als er zu Weihnachten nachhause kam, fand er das Buch und ward nicht mehr gesehen. Las den Sang vom Oberrhein in einem Tag zu Ende. Hatte einen roten Kopf und fliegende Gedanken. „… der Welt eins aufspielen und titanisch Himmelstürmen mit der Kunst um ewig ferne Schönheit…“ Johannes las und las wieder und lernte auswendig. „…in der Schlacht zum Angriff blasen, markig und bedeutsam…“ Und Johannes spielte. Und wollte werden wie der junge Trompeter von Säckingen. Bis dahin war er ein guter Trompetenschüler, ab jetzt war er eingeweiht.
Quirin Czermak ging in der Werkstatt auf und ab.
Spatzen hüpften durch den kleinen Garten, der bis an die Wehrstraße reichte, die das Städtchen umfasste. Durch die Fenster fiel Sonnenlicht, in dem feiner Holzstaub zitterte. Im schmalen Beet an der Mauer roch der Salbei, blühten die Rosen, reiften die Marillen am Spalier. Ein Truthahn schickte seine Koloraturen in den Tag. Er hörte Cäcilia Klavierspielen. Die Liebe zur Musik hatten sie und Johannes von der Mutter geerbt, die oft mit den Kindern sang, gut Akkordeon spielte und mit der tschechischen Volksmusik aufgewachsen war. Zu allen Festen wurde in den Dörfern ringsum aufgespielt, zur Kirchweih, zum Christfest, zur Auferstehung und zum Wochenmarkt, zu Geburtstagen, Ehrungen und Beerdigungen. Oder einfach zur Lust, um die Schinderei des Tages zu vergessen. Johannes hatte sein Trompetenspiel schnell vervollkommnet und durfte bei den Festen der Nationalgarde bereits in der ersten Reihe der Kapelle mitmarschieren.
Jetzt lag seine schlanke Ventiltrompete in einem Zimmereck.
Das Signalhorn hatte er ja mitgenommen in die Schlacht … Eine Dose Holzleim fiel dem Tischlermeister aus der Hand. Er grollte mit sich selbst, als er die Reste aus den Hobelspänen zu retten versuchte, es war ein teurer Leim, den er erst kürzlich in der Soukenická von Königgrätz gekauft hatte.
Sehr unruhig, zerfahren war Herr Czermak. Vormittags hatte er den Metzger Brandeis getroffen, der weit in der Gegend herumkam, um die besten Rinder, Schweine und Schafe zu kaufen. Quirin verstand sich gut mit dem Metzger, ihre Kinder waren ungefähr gleichen Alters. Brandeis konnte den Schmerz des Tischlers verstehen. Er selbst war verschont geblieben: sein einziger Sohn – die anderen fünf Kinder waren Mädchen – war unversehrt zurückgekehrt vom sinnlosen Schlachten. Im Gespräch hatte sich herausgestellt, dass Brandeis am Tag zuvor in Jičín gewesen war, wo er die Krüppel gesehen und erfahren hatte, dass das Lazarett der Johanniter bald geschlossen werden sollte, jetzt, mehr als acht Wochen nach dem Unglückstag vom 3. Juli. Und Brandeis sagte: „Kannst mit mir fahren, Quirin, übermorgen muss ich nach Münchengrätz, ich hab genug Platz im Rosswagen, da kann ich dich in Jičín abladen und am Abend wieder mit nachhaus’ nehmen.“
Jetzt konnte er nicht mehr aus.
Jetzt musste es sein.
Der Tischlermeister wusste, dass es in Jičín dieses private Lazarett eines Ordens gab, das im ehemaligen Schloss des Generalissimus Wallenstein untergebracht war. Das große österreichische Lazarett stand in Königgrätz, dort hatte er nachgefragt, jedoch nichts erfahren und die Verwundeten waren bald darauf nach Wien verlegt worden. Bis zum heutigen Vormittag hatte er einen Besuch in Jičín aufgeschoben – unentschuldbar war es und unerklärlich für ihn selbst. Flucht vor einer Nachricht, die er nicht hören wollte? Aber jetzt, wenn die Krankenstation geschlossen werden sollte, musste er hin.
Das Lazarett ist nur mehr schwach belegt.
Die Geheilten sind entlassen.
Viele der Moribunden sind gestorben.
Aber er, dieser junge, unbekannte Soldat, lebt.
Nur minutenweise ist er bei Bewusstsein.
Der Johanniter bleibt an seinem Bett.
Hält seine Hand.
Die eitrigen Wunden heilen langsam.
Der Arzt hat Zuversicht.
Hoffnung will er nicht sagen.
Gut wäre die Überstellung in ein Ordensspital.
Der Johanniter möchte den Verletzten mitnehmen.
Er hat ihn sich erwählt für das Leben.
Es wird langsam Herbst, erzählt er ihm. Und Nebel liegen morgens über der Stadt. Du weißt ja, sagt er, dass sie zwischen drei Flüssen liegt: der Cidlina, der Mrlina und der böhmischen Iser. Es ist Frieden und die Gefangenen kommen nachhause. Die Schwalben sammeln sich. Am Wochenende wird das erste Fest nach dem Krieg gefeiert: das Fest zum Erntedank. Es hat kaum Ernte und Früchte gegeben, aber das Wenige soll gefeiert werden. Vielleicht wird sogar getanzt. Die Mädchen werden in Überzahl sein, aber es gibt hübsche Mädchen hier, sagt der Johanniter mehr zu sich selbst als zum jungen Soldaten, und da …
da glaubt, ja, da sieht er, beugt sich näher …
kann es sein?
Kann es wirklich sein, dass ein schiefes kleines Lächeln in dessen Gesicht zu erkennen ist? Der Johanniter springt auf, öffnet das Fenster, „Er hört mich“, ruft er, schreit es fast in die Dunkelheit, „Er kann mich hören!“ … Vielleicht versteht er, was ich sage! Vielleicht versteht er schon längst, was ich ihm erzähle – –
Quirin Czermak steigt aus dem Pferdegespann.
Jičín ist ihm vertraut.
Hier ist er zur Welt gekommen.
Achtzehn Jahre hat er hier gelebt, bevor er auf die Walz ging, wie viele seiner Handwerkskollegen. Auf seiner Wanderschaft hat er bittere Armut gesehen in den Werkstätten von Schneidern, Tischlern und Schustern, in denen mitunter von fünf Uhr früh bis zehn Uhr nachts nur mit kurzen Pausen gearbeitet werden musste. Nicht nur einmal hat er mit einem Zweiten das Bett geteilt, um sich ein paar Kreuzer vom Kostgeld zu ersparen. Hat viel erfahren vom Elend in den Ziegeleien, den Steinbrüchen und Webereien, hat viele Neugeborene sterben sehen, viele Kinder, die nichts zu essen hatten, da der Lohn des Vaters kaum für mehr als ein Stück Brot für alle Neune reichte. Auch viel Heiterkeit und Lebensmut hat er in den Schenken und Wohnhäusern erlebt, die an größeren Orten für Handwerker und Arbeiter errichtet wurden, viel Zukunftshoffnung auch in den Fortbildungseinrichtungen der aufstrebenden sozialdemokratischen Bewegung sowie in den nationalpatriotischen tschechischen Turnvereinen der Sokoln, die später zu Zentren des Aufruhrs gegen Habsburg wurden. Bis Nürnberg, Basel und sogar bis Venedig ist er auf seiner Wanderschaft gekommen. Dann zog er weiter nach Wien und schließlich gründete er in Neustadt an der Mettau seine eigene Werkstatt. Wenige Jahre später konnte er bereits das Haus auf dem Marktplatz kaufen. Wann war das? Das war in einem anderen Leben, sagt er sich.
Ruhelos geht Herr Czermak über den Stadtplatz von Jičín. Gitschin heißt es auf Deutsch. Hier kennt er jedes Haus. Der Platz ist jenem von Neustadt ähnlich, viereckig, mit Arkaden eingerahmt, alles nur etwas größer, repräsentativer. In der Schule haben sie von Wallenstein gelernt, der Jičín reich gemacht und sich hier in den Jahren seines Aufstiegs ein Schloss hat erbauen lassen. Etwas heruntergekommen sieht es jetzt aus. Noch kein Licht aus den Fenstern, es ist früh am Morgen. Herr Brandeis hatte noch ein Stück des Weges bis Münchengrätz vor sich, so waren sie bei Dunkelheit aufgebrochen. Auf der Fahrt hatten sie schemenhaft die Türme von Königgrätz, ein Stück weiter den Swibwald und den Hügel von Chlum gesehen.
Der Stadtplatz belebt sich langsam.
Der Tischlermeister zieht sich zur Pestsäule in der Mitte des Platzes zurück, wo weniger Betrieb ist als unter den Arkaden. Kurz überlegt er, ob er beim jungen Kaufmann Jakob Kraus anklopfen soll, der ihn vor kurzem um Rat für den Umbau seines Papierkontors gefragt und eine mit Intarsien verzierte Kassette für den Schmuck seiner Frau, der schönen Arzttochter Ernestine, in Auftrag gegeben hat. Jakob Kraus war eine bahnbrechende, wenngleich höchst simple Erfindung gelungen: Papiersäcke, die geklebt waren – eine Erfindung, mit der Kraus die gesamte Monarchie belieferte und sich damit ansehnlichen Reichtum erwarb.
Aber Quirin zögert, hinüberzugehen.
Es ist ja noch zu früh.
Er lässt sich auf den Stufen des Säulensockels nieder. Will gerne beten zu allen Heiligen, aber er hat noch nie beten können. Er zählt die schwarzen Quadrate der Steinplatten zu seinen Füßen und die weißen Trennstreifen dazwischen. Horcht auf die Geräusche der erwachenden Stadt, beobachtet die eleganten Droschken, die Ochsenkarren, die hastenden Dienstmädchen, die Männer, die Bierfässer schleppen, und die Männer in schwarzen Anzügen und weißen Hemden.
Die Minuten sind lahme Hunde.
Und dann – –
Dann sieht er den Beinamputierten.
Mit Krücken kommt er aus den Schlossarkaden. Quirin schluckt. Beginnt zu hecheln. Sein Herz schlägt in den Schläfen. Er steht langsam auf und zieht seinen schwarzen Gehrock gerade. Warum hat er keinen Stock mitgebracht. Es schwindelt ihn. Wenn jetzt jemand um Hilfe riefe, er würde es nicht hören. Wenn jetzt Hagel fiele, er würde ihn nicht spüren, und wenn ein Zwerg mit Blattgoldhut vor ihm stünde, er würde ihn nicht sehen.
Dann geht er zügig zu Wallensteins Schloss.
Nähert sich dem Krüppel.
Nein, nicht dieses Wort!
Und fragt, ob das Lazarett schon geöffnet sei für Besucher – –
Erst am nächsten Morgen konnte der Tischlermeister sprechen. Er saß die ganze Nacht stumm und mit leerem Blick in seinem Lehnstuhl. Zitterte. Rosa brachte eine warme Decke und heißen Tee. Von der Dreifaltigkeitskirche hörten sie das Schlagen der Viertelstunden, der halben Stunden, der Dreiviertelstunden und der ganzen Stunden.
Um fünf hörten sie von ferne die ersten Pferdefuhrwerke, die den steilen Berg vom Tal der Mettau heraufkamen und erst lauter wurden, wenn sie durch das Horská Tor auf den Marktplatz einbogen. Rosa trug die Pendeluhr in die Küche, sie konnte das Ticken nicht ertragen. Um halb acht nickte der Tischlermeister ein und Rosa sagte zu Cäcilia, die zur Probe für das Marionettentheater musste, dass der Vater schlafe und sie noch nichts wisse. Dann waren sie wieder allein. Rosa lief zum Bäcker zwei Häuser weiter, kaufte frische Semmeln und drei Marmeladekipferl und kochte starken Kaffee.
Irgendwann am Vormittag fand Quirin stockende Worte. Sagte, dass er an der Pforte Johannes beschrieben und gefragt hätte, ob ein junger Mann, der dieser Beschreibung ähnlich wäre, hier läge. Die Nonne hätte einen Mann geholt, der sich als Ritter des Johanniterordens vorstellte. Dieser hätte sofort vermutet, dass einer seiner Patienten der Gesuchte wäre. Als sie am Ende eines langen Ganges vor einer Tür angekommen wären, hätte der Ritter ihn zurückgehalten. Hätte ihn beim Arm genommen und ihn fragend, forschend angeblickt. Quirin hätte genickt.
Ja, es wäre Johannes gewesen.
Dieses Stück Mensch, das er, der eigene Vater, erst nach längerem Hinsehen erkannt hätte. Er könne nicht beschreiben, was er gesehen hätte. Er könne nur sagen: das Gesicht. Der Johanniter hätte erzählt, wie er Johannes am Tag nach der Schlacht auf dem Totenfeld des Hügels von Chlum gefunden, ihn in das Lazarett gebracht und ihn bis heute gepflegt hätte.
Der Ritter hätte ihn nochmals am Arm genommen.
Eine Weile gewartet, bis er sagte:
„Er wird leben.“
Später hätte der Johanniter gefragt, ob der Vater die Einwilligung gäbe, den Sohn mit nach Breslau zu nehmen, wo im Ordensspital gute Ärzte zur Verfügung stünden und der Verwundete die beste Pflege fände. Das Lazarett in Jičín würde in drei Tagen geschlossen werden. Er, Quirin, hätte zugestimmt.
Der Tischlermeister saß totenblass im Lehnstuhl und wusste nicht, ob das Folgende wirklich gesprochen oder nur gedacht wurde.
Was hätten wir denn mit ihm tun sollen.
Johannes hat mich nicht erkannt.
Er wäre uns gestorben.
Dann wären wir wenigstens bei ihm gewesen –
Wenn er sterben muss, sagte Rosa.
Aber vielleicht … im Spital … wer weiß –
Ja, vielleicht hast du recht …
Dann umarmte sie ihn.
Sie spürte sein Zittern.
Das ist ihm geblieben.
Als Johannes erwachte, war er Schmerz. Er suchte ihn. Fingerte über den Kopf. Kam der Schmerz vom Gesicht? Der rechten Wange, den Lippen? Da war ein Fehlen. Ein holperndes Tasten wie über einen dreckigen, aufgewühlten Hohlweg. Nein, das war nicht er. Nein. Nicht seine Hand. Nicht sein Gesicht. Der Schmerz gehörte ihm, aber das Gesicht gehörte ihm nicht. Es musste ein Fremder sein. War das Traben von Pferden zu hören? Die Nacht kam, die Dämmerung, wieder die Nacht. Das ging so hin. Wie lange? Gab es Tage im Taumelgefühl dieser Reise? Denn eine Reise war es, schien ihm. Als ob ihn jemand an einer dunkelroten Wand vorüberzöge. 33, 33. Die Zahl spukte durch seinen Kopf. 33, er wusste nicht, was dies bedeuten sollte. Gab es eine Welt da draußen hinter den Vorhängen des Verschlags, in dem er dahintrieb? Jemand war bei ihm, dessen Stimme er kannte. Wie kam es, dass er eine Wärme spürte, wenn er sie hörte?
Die Stimme sagte: Du bist zurück, Johannes.
Im Spital des Johanniterordens in Breslau blieb Johannes fast zwei Jahre. Er wurde drei Mal operiert. Es waren zwei junge Ärzte am Werk, die in Berlin an der Charité ausgebildet worden waren. Später, als der neue, der größte aller bisherigen Kriege kam, wurden sie zu gesuchten Spezialisten. Nach der letzten Operation hatte Johannes’ Gesicht ein Aussehen, das man als Menschengesicht bezeichnen konnte.
Wie er diese Jahre überstand, ist nicht zu sagen.
Wie er in das Leben zurückfand, ebenso nicht.
Der Vater kam alle drei Monate.
Es war eine lange Reise von Neustadt nach Breslau.
Ein paar Mal war die Mutter mit.
Sie rang um Fassung.
Aber es war ihr Kind.
Und es lebte.
Auch Franz kam und sprach dem kleinen Bruder Mut zu. Er hatte in den Straßen von Wien Schlimmeres gesehen. Er war mit der neuen Kaiser-Ferdinands-Nordbahn gekommen, die von Wien nach Krakau führte, völkerverbindend und zugleich wirtschaftlich notwendig zu den ergiebigen Kohle-, Eisen- und Salzlagern der Monarchie. Franz berichtete dem Vater über alle Einzelheiten der Strecke, an der er mehrmals umgestiegen war, wie großartig diese neue Erfindung wäre, eine Revolution, sagte er, das wird ein ganzes Zeitalter verändern! Von Wien nach Laibach sei die gesamte Südbahn schon fertig, sogar die Bergstrecke über den Semmering, eine technische und europäische Großtat! Bis in die letzten Dörfer der Monarchie, bis Galizien und Lodomerien werden wir Schienen legen und sie an die große Welt anschließen, an den Fortschritt, du wirst sehen, Vater, wie groß …, und Franz unterbrach sich, als er sah, wie abwesend der Vater aus dem Fenster ihres Breslauer Hotels blickte. Er erschrak über sich selbst, wie konnte er so taktlos sein und so begeistert von einer hellen Zukunft sprechen, die der Jüngste so nicht haben würde.
Quirin Czermak sprach mit dem Johanniter und dankte ihm. Tat es bei jedem Besuch, bei dem er die langsame Genesung seines Sohnes beobachten konnte. Dankte ihm mit wachsender Intensität, wollte ihn beschenken – Geld wollte er nicht anbieten –, ihm Gutes tun, aber der Mann sagte nur:
Ich liebe Ihren Sohn, ich tue es um seines Lebens willen.
Von Breslau, der schönen Stadt zwischen vielen Flussläufen, Kanälen, Brücken und Kirchen, der fürstlichen, herzoglichen, und seit mehr als einem Jahrhundert königlich-preußischen Stadt mit den herrlichen Plätzen und reichen Bürgerhäusern sowie den Fabriken der explodierenden Industrialisierung sah Johannes nichts. Er war zu schwach und die Zeit zwischen den Operationen zu kurz, als dass er die schützenden Mauern des Ordensspitals hätte verlassen können oder wollen.
Er schlich die Gänge des Hauses entlang. Die Schwestern grüßten freundlich und lächelten ihn an, sie kannten ihn schon gut. Nachts spielte er auf einer imaginären Trompete ins Nichts. Er spielte mit schwachem Atem und sperrigen Fingern den Trompetenpart aus barocken Konzerten, am liebsten den Solopart aus Antonio Vivaldis Concerto für Trompete und Streichorchester in D-Dur, und spielte, wachte, träumte, weinte, Wut und warum …
In der Abteilung, in der Johannes lag, gab es keine Spiegel und keine Bilder. Einmal hatte er sich verirrt und war in den Trakt der Quarantänepatienten gekommen. Da sah er im Glas eines Heiligenbildes zum ersten Mal sein Gesicht. Lange stand er da, ungläubig.
Der Schock nahm ihm den Atem. Er sah sich erstarrt an. Führte seine Hand über die versehrte rechte Narbenwange, sah das deformierte Kinn, betastete seine Lippen. Schaute lange dieses Bild an, aus dem ihn ein Mensch anblickte, den er nicht kannte. Dann ballte er eine Faust und zerschlug das Glas. Er schrie und schreiend rannte er weg, eine Blutspur hinterlassend, irrte panisch durch das Ordenshaus, suchte einen Ausgang, weg, nur weg von diesem Gesicht, weg von der Wahrheit und in den Tod … Als er schließlich ein offenes Tor fand und immer noch schreiend ins Freie wollte, rannte er in die Arme des Johanniters.
Johannes brauchte Wochen, bis er nicht mehr an Selbstmord dachte. Einer der Ärzte kam und brachte Tropfen zur Beruhigung. Er versuchte, ihm Mut zu machen und bemühte sich. Nach der Operation, die noch vor ihm liege, sagte er, wird es besser sein.
Es wurde besser.
Johannes hatte wieder einen Mund.
Die Wunden heilten gut.
Die Narbenschmerzen waren erträglich.
Schwester Łucja, eine langgediente, freundliche Ordensschwester, die schwer an ihrem gedrungenen Körper trug, hatte es sich in den Kopf gesetzt – oder war sie beauftragt worden? – ihn wieder das Sprechen zu lehren. Vor allem die Labiallaute b, p und m, ebenso das schwierige f und w. Sie hatte große Geduld und übte mit ihm das Konjugieren lateinischer Verben wie amo, amas, amat, amamus, amatis, amant, amo, amas…, ich liebe, du liebst …, amabo, amabis…, ich werde lieben, du wirst lieben… und übte deutsche Nomina: Peter und Paul, Wiese, Weide, Wald und Wolf … Johannes entwickelte nach anfänglichem Widerstand Freude an diesen Übungen, er merkte den Fortschritt, übte alleine viele Stunden während der eintönigen Tage und langsam begann er, sich auf morgen zu freuen und übermorgen und weiter. So wuchs eine kleine Zukunft.
Den Johanniter sah er seltener als früher. Der Ordensmann war tagelang bei Kranken auswärts unterwegs und im Haus selbst in vielerlei Pflege und Organisation eingebunden. Johannes vermisste ihn. Ihn und die Wärme, die von ihm ausging, die dunkle, weiche Stimme, die ihn zurückbrachte, wenn er ins Nichts wollte. Er rügte sich selbst, einen so abgegriffenen Vergleich zu denken: wenn der Johanniter kam, ging die Sonne auf. Der seltsame Mann wusste gut zu unterhalten, berichtete von der Welt draußen, dem Absterben und dem Wiederkommen, der neuen Mode und den neuen Fabrikschloten, vom Tod eines Dichters namens Heinrich Heine und dann sprach er, verwirrend und verworren für Johannes, von einem „Privilegium de non tolerandis Judaeis“, dann wieder von Galilei oder der Abschaffung der Sklaverei in den USA, sprach von Flucht und Kriegen, dem Trojanischen, dem Dreißigjährigen und den weltumspannenden, die bevorstünden, erzählte von Giftgas und Revolutionen. Er sprach vollkommen ununterschieden und selbstverständlich von dem, was war und was sein und kommen würde, als ob er auf Flügeln die Jahrhunderte überbrückte oder auf einem Regenbogen.
Der Mann hatte etwas Rätselhaftes.
Er war ohne Zeit und ohne Begriff.
Jeden Sonntagmorgen, bevor sie gemeinsam zur Messe in die Ordenskirche gingen, brachte der Johanniter ein neues Buch oder die Schlesische Zeitung mit. Und immer nahm er wie nebenbei ein Blatt aus einem kleinen Stapel von Zetteln, den er aus der Innentasche seines langen Habits zog, und legte es Johannes auf den Tisch. Darauf hatte er in einer kleinen Schrift eine Strophe oder ein, zwei Sätze geschrieben, ohne zu vermerken, von wem sie stammten oder den Beschenkten aufzufordern, darüber nachzudenken. Nur einen einzigen Namen hatte er unter dem Zitat „Il fine dell’ uomo, come d’ogn‘ altro animato, è vivere“ angegeben: Paolo Sarpi. Dadurch waren beide wie ein Wegweiser herausgehoben und Johannes im Gedächtnis geblieben. Die übrigen Beispiele standen einfach da als Zeichen für irgendetwas.
… mit der einen hand zeichnen sie soldaten, und mit
der anderen radieren sie sie wieder aus.
Laß ab von diesem Zweifeln, Klauben,
Vor dem das Beste selbst zerfällt,
Und wahre dir den vollen Glauben
An diese Welt trotz dieser Welt
… verliebt in das Grün des fernsten Grases
Ich glaube jedem, der die Wahrheit sucht.
Ich glaube keinem, der sie gefunden hat.
Il carnato del cielo
sveglia oasi
al nomade d’amore
Die Rötung des Himmels
weckt Oasen
für den Nomaden der Liebe
Mein sind die jahre nicht, die mir die zeit genommen;
Mein sind die jahre nicht, die etwa möchten kommen;
Der augenblick ist mein, und nehm’ ich den in acht,
So ist der mein, der jahr und ewigkeit gemacht.
Eines Tages – es war kurz vor der Entlassung des Patienten – machte der Johanniter mit Johannes eine Ausfahrt. Es war die erste nach fast zwei Jahren. Johannes hatte Angst.
Er sträubte sich, aber der Mann führte ihn vor das Tor, wo eine Droschke mit zwei braunglänzenden Pferden und einem Kutscher wartete. Sie fuhren durch die belebte Stadt, die zur Großstadt geworden war. Fuhren über die Zuflüsse der Oder, in deren Tiefebene Breslau liegt, und über Hunderte von Kanälen, die der Stadt schon früh den Ruf eingetragen hatten, das „Venedig des Nordens“ zu sein. Es war ein milder Abend, die Straßen und Plätze waren überfüllt mit Menschen, vor den Hotels standen livrierte Pagen, Glocken tönten von der Marienkirche, der Duft von Gebratenem lag in der Luft, aus einem Haus hörte er Geigenmusik, aus einem anderen Streit, Knechte schleppten weiße Säcke in eine Bäckerei, Kinder spielten Ball, ein Marktschreier bot Lakritzen an und ein anderer Gewinnlose, es war ein Leben, wie er es gekannt hatte von früher.
Es war die Alltäglichkeit, die weitergegangen war in den Monaten, als er litt, es gab also noch ein Lachen und es gab Burschen und Mädchen, manche umarmten sich und eine wahnsinnige Lust überkam ihn, dabei zu sein, mittendrin, wieder Teil der Welt zu werden –
– und Johannes beugte sich aus dem Fenster der Droschke und wollte singen, und hatte plötzlich das Bild von Agáta vor sich, die damals, ja, irgendwann bevor es geschah, in der Musikschule zugleich mit ihm Unterricht genommen hatte, Agáta, die so zart Geige spielte, deren Kleid wehte, wenn er sie nachhause begleitete und die sagte, wie schön hast du heute wieder gespielt mit Deiner Trompete, Jan, war das eine Fuge von Bach? Sie hatte Jan zu ihm gesagt und jetzt schien es ihm, dass aus ihrem Mund der tschechische Name zärtlicher klang, Agáta, die eine leichte Röte auf ihren Wangen hatte, wenn sie sich vor dem Gartentor ihres Elternhauses verabschiedeten und sie mit ernster Miene sagte, bis morgen, Jan, und es ihm ganz heiß geworden war… Und in der Droschke durch die Gassen von Breslau und das pralle Leben fahrend, dachte er: Vielleicht hab ich für sie spielen wollen im Krieg, ihr zeigen, dass ich schon ein mutiger Mann bin und vor sie hintreten in der Uniform eines kaiserlich-königlichen Feldmusikanten – –
und da spürte er die Hand des Johanniters, der sagte:
„Jetzt bist du angekommen, Johannes.“
Drei Wochen später wurde Johannes aus dem Ordensspital entlassen. Der älteste Bruder kam, um seinen jüngsten abzuholen. Franz hatte sich vier Tage Urlaub genommen. Er hatte ein beträchtliches Geldgeschenk des Vaters dabei, das er dem Johanniter mit ausdrücklichem Dank der Eltern als Spende für den Orden überreichte. Der Vater hätte gern mehr gegeben, sagte Franz, aber er wäre seit dem Unglück mit Johannes ein gebrochener Mann. Das Zittern seiner Hände würde ihm keine feinen Schnitzarbeiten mehr erlauben, so dass die Geschäfte nicht mehr so gut gingen wie früher.
Ein breitkrempiger Hut warf Schatten auf Johannes’ Gesicht. Leicht gebückt, aber halbwegs bei Kräften, ging er am Arm seines Bruders zur Droschke, die sie zum Bahnhof von Breslau brachte. Hier begann die lange Reise, die sie mit mehrmaligem Umsteigen über Mährisch-Ostrau, Olmütz und Pardubitz in das ehemalige Hussitenstädtchen Josephstadt/Jaroměř führen würde, wo die Mettau in die Elbe mündet und sie nur mehr ein kurzes Stück nach Neustadt zurückzulegen hätten.
Nachhause.
Franz hatte sich diese Route liebevoll ausgedacht, um auf diese Weise Johannes in ein neues, überraschendes Leben zu führen und der Erinnerung an die Schlacht einen Gegenpol zu offerieren. Er wollte ihm zeigen, wie schnell und unabhängig vom Schicksal des Einzelnen die Karawane der Menschen weiterzog, über das Geschehene hinwegging, schuldbeladen, achtlos oder freigedacht. Neuen Zielen zu, einem Fortschritt entgegen, der nicht aufzuhalten sein würde.
Johannes stand in der Bahnhofshalle und richtete sich auf. Sah die hohen Glas- und Eisenkonstruktionen, die Arabesken und Goldintarsien in den Mosaiken, sah die Buntheit der eilenden Menschen, die keine Notiz von ihm nahmen und sich in einem Strudel von Sprachen unterhielten, Polnisch, Tschechisch, Deutsch, Russisch, Ungarisch und Jiddisch, hörte das Englisch und Französisch fremdländischer Herren, aus dem Gewirr von Rufen, Fragen und Gepäckstücken erstand eine Welt aus Kaufleuten, Beamten, Luxusreisenden und Ochsenhändlern, aus hochmütigen Damen, Getreidemaklern und galizischen Rabbinern, und Johannes sah die rauchige Bierstube mit armseligen Gestalten und das elegante Restaurant mit weiß gedeckten Tischen, auf der Empore des Speisesaales spielte eine Kapelle Walzermelodien, er hörte das ungeduldige Rufen der Träger, die Maschinen der gewaltigen Lokomotiven sprangen in stotterndem, dann rhythmischem Takt an, Räder ächzten, Johannes stand da im Qualm und unter dem Gewölbe aus Lärm und Stimmen und war nichts als Staunen. Und wunderte sich immer noch, als sie im Coupé saßen und die Landschaft in einem nie gekannten Tempo vorüberzog, die Industrieanlagen und die Vororte auftauchten und wieder verschwanden, die Uferböschungen der Oder, die Dörfer, Felder, Wälder und Wege, ein Schwalbenflug, eine Halluzination und das Vorspiel von Mozarts Don Giovanni.
Es war Abend, als sie in Neustadt ankamen. Die Mettau lag im Dunkel, der Marktplatz im Licht der Gaslaternen. Der Vater empfing sie unter dem Tor des Hauses mit der Nr. 1223 und dem Lamm als Zeichen. Cäcilia bekam feuchte Augen, als sie Johannes sah, umarmte ihn stürmisch und barg ihren Kopf an seiner Schulter. Er roch ihr Haar, ihre Haut. Karel war in Prag geblieben, er musste zu einer Versammlung, schickte aber herzliche Grüße. Die Mutter hatte ein Festmahl bereitet und Reseden auf den Tisch gestellt. Der Rinderbraten und die Serviettenknödel waren zart, die Kerzen brannten, das Gespräch stockte. Über der Dreifaltigkeit stand der Sichelmond.
Zuhause.
Johannes hielt sich viel in der Werkstatt des Vaters auf. Er machte kleine Handreichungen, kehrte die Späne von Hobel und grober Schnitzerei in einen Korb und polierte die feineren Schnitzmesser, die nicht mehr in Gebrauch waren. Er ließ sich Farben und Wirkungsweise der verschiedenen Beizen und Lacke erklären und die unterschiedliche Seele von Buchen-, Eichen-, Linden- und Birnenholz. Es war ein neues Feld für Johannes und das Handfeste daran gefiel ihm, es beruhigte ihn. Vater und Sohn waren sich einig im Schweigen und es entstand eine Nähe, die es früher nicht gegeben hatte. Manchmal saßen sie im Gärtlein an der Werkstattmauer, die noch die Wärme des Tages gespeichert hatte. Über Zaun und Wehrstraße hinweg schauten sie in das Grün der jenseits der Mettau liegenden Hochflächen. Wenn die Mutter eine Erfrischung brachte und sie die beiden still nebeneinandersitzen sah, flog etwas Helles über ihr Gesicht. Die Männer prosteten sich zu, zitternd der Ältere. Der Geselle für die Großaufträge arbeitete nach den Anweisungen seines Meisters selbständig in der Werkstatt am Ufer der Mettau, den zweiten Gesellen hatte Quirin Czermak schweren Herzens entlassen müssen. Den Lehrbuben konnte er noch behalten. Dem Vater war der steile Weg in das Tal zu beschwerlich geworden, so ging Johannes oft mehrmals am Tag als Bote hin und her. Er blieb eine Weile am Ufer des Wassers, sah den Spiegelungen des Himmels zu und zählte die vorübertreibenden Blätter.
An der Wehranlage des Flusses lag unmittelbar neben dem Besitz des Vaters der Betrieb eines Schmieds. Herr Vitus Kriwanek stand manchmal vor seinen lauten, großräumigen Werkstätten, rauchte eine Pfeife und hob eine Hand zum Gruß. Mit der Zeit kamen sie ins Gespräch. Herr Kriwanek war einer der wenigen, der nie nach dem Befinden von Johannes fragte, ihm offen in das Gesicht blickte und keinerlei Anzeichen von Überraschung oder Abwehr zeigte. Johannes wusste, dass er seine beiden Söhne in der Schlacht von Königgrätz verloren hatte. Der eine starb bereits bei den ersten Kampfhandlungen um Sadowa, der andere gegen Abend auf dem Hügel von Chlum. Nie sprachen sie darüber. Aber Johannes hatte ein Gefühl des Aufgenommenseins und war dankbar dafür.
Wieder sammelten sich die Schwalben, fielen die Kastanien, ließ das warme Licht der Septembersonne die Erde erglühen. Auf dem Erntedankfest wurde getanzt, die Mädchen waren hübsch und hatten geflochtene Blumenkränze im Haar. Agáta war nicht unter ihnen. Johannes stand am Fenster im ersten Stock. Er sah das fröhliche Treiben auf dem Marktplatz unter sich und war bedacht darauf, nicht gesehen zu werden. Ein Mann schrie etwas in ein trichterförmiges Sprachrohr, der Tanz stockte, ein Trompetentrio und ein Trommelwirbel schmetterten ein musikalisches Hurra und der Tanz begann von neuem, schneller, wilder.
Wie viele Jahre war es her, dass ihm der Johanniter im Lazarett des Wallenstein’schen Schlosses vom Erntedankfest auf dem Stadtplatz von Jičín erzählt und er es mehr träumend als wachend wahrgenommen hatte? Drei? Vier Jahre?
Die Mutter schlug ihr Akkordeon in ein Tuch ein und stellte es auf den Dachboden. Die Ventiltrompete hatte sie längst verräumt. Mit großer Natürlichkeit und Zurückhaltung umsorgte sie Johannes, ohne ihn zu demütigen. Da sie ein Bauernkind war, kannte sie den Umgang mit verletztem Leben. Heilen braucht Geduld, sagte sie zu ihrem Mann, und tat, wovon sie glaubte, dass es gut war. Manchmal, wenn sie den langen Weg nach Rezek zum Hof des Bruders ging – die Eltern lebten nicht mehr – nahm sie Johannes mit. Mit Verwunderung hörte er dieser sonst stillen Frau zu, wie sie ihm lebhaft über die Beschaffenheit von Ackererde, Baumrinde oder Vogelkot zu erzählen wusste. Am Hof selbst half er beim Äpfelklauben und blieb eine Weile bei den Kühen auf der Weide. Beobachtete ihr unermüdliches Fressen, das zungenlange Abrupfen der Grasbüschel und das stoisch verinnerlichte Wiederkäuen. Sie sahen ihn nicht an. Wenn Regen bevorstand, zogen die Tiere alle in dieselbe Richtung, langsam und fressend über die weite Hochfläche hin. An klaren Tagen sah man bis zu den fernen Waldrücken des Adlergebirges.
Königgrätz. Mit dem Zweispänner waren Vater und Sohn unterwegs, um in der Soukenická neue Ware einzukaufen. Quirin wählte mit Bedacht Beizen, Holzleim und Pauspapier für die Arabeskenverzierungen. Er würde es kaum mehr brauchen. Seine Hände zitterten und die technischen sowie chemischen Entwicklungen überrollten rasant sein Handwerk. Johannes sah sich mittlerweile in der Stadt um. In aller Pracht stand sie vor seinen Augen, goldne Zier, mächtige Kirchtürme und Selbstbewusstsein demonstrierende Bürgerhäuser. Er sah das lockende Leben eines blühenden Gemeinwesens. Im Kopf hatte er andere Bilder. Er dachte an die in den Wassermassen der geöffneten Schleusen Ertrunkenen des 3. Juli und wünschte sich in ihre Gesellschaft.
Johannes, du musst wieder mehr unter Menschen gehen –. Es fiel ihm schwer. Die Arkaden des Marktplatzes von Neustadt boten Schutz vor Schnee, Unwetter und Sommerhitze, aber nicht vor dichtgedrängten Menschen. Er gab sich Mühe. Gab Antwort, wenn man ihn fragte, ihm Mitleid und Zuneigung zeigte, ihn einlud, doch einmal vorbeizukommen. Durchreisende starrten ihn an. Kinder tuschelten. Mit dem einen oder anderen Freund von früher kam er ins Gespräch, sie hatten sich nichts mehr zu sagen. Sie waren jetzt um die zwanzig und das Leben hatte ihnen gegensätzliche Erfahrungen zugedacht. Mit ihnen zu reden, war Qual, er hatte keinen Anteil an guten Positionen, Plänen, Liebschaften und der Lust am Dasein. Den Mädchen ging er aus dem Weg. In der Schenke trank er Bier, beim Bäcker kaufte er Kaisersemmeln und beim Metzger Brandeis bestellte er Rinderbraten für den Sonntag.
„Dass Gott erbarm“, sagte Herr Brandeis zu seiner Frau, „der arme Teufel“.
Im März erlitt Johannes einen schweren Rückfall. Die Narben entzündeten sich und begannen wieder zu eitern. Der Hausarzt stieß an seine Grenzen und wies ihn in das Spital der Barmherzigen Brüder ein, ein anderes gab es nicht in Neustadt. Mehrere Wochen blieb Johannes bei den Barmherzigen.
In der Klosterbibliothek war er stiller Gast.
Nachts kam die Musik, schlich sich ein, kam von irgendwo her, aus dem Bauch, dem Kopf, dem Atem. Dem Traum. Nachts kamen sie, die Melodien, die er geliebt hatte, Lieder, Ouvertüren, Märsche, er brauchte kein Orchester, er brauchte nur seine goldne Ventiltrompete, er selbst würde auf dem Turm des Schlosses und Agáta allein unten auf dem Marktplatz stehen, sie würde zu ihm heraufschauen, Leute würden sich um sie scharen und alle würden den Blick zu ihm, dem Trompeter, erheben, es gäbe keine Grammatik mehr und keine Gräber, nur Girlanden über seiner Stirn.
Im Klostergarten half er gern, als es ihm besser ging, und freundete sich mit Sempronius an, einem alten Pater, der ihm kichernd von früher erzählte, als ob die Geschichte eine flotte Polka wäre und alles Unglück flüchtig wie ein Tanzschritt. Erzählte von Festen und Bränden, Kuhhandel und Kriegen und von Albrecht von Wallenstein, der einst kurze Zeit der Herr von Neustadt war, als man ihn noch ehrte für Siege, Macht und Reichtum. Wallenstein, der ermordet wurde in Eger. Und einer seiner Meuchelmörder, der Ire Walter Leslie, wurde in Wien sofort hoch geehrt, die reichste Beute jedoch war, so Sempronius weiter, „Na, was glaubst du? Unsere Stadt! Samt Schloss und allen dazugehörenden Dörfern und Landbesitzungen – so ist der Mörder mit dem ehemaligen Besitz des Ermordeten belohnt worden!“
Als Johannes nach seinem Spitalsaufenthalt in das Elternhaus zurückkehrte, gab es manche Veränderung. Franz wurde nach Brünn in die dortige Zentralstelle der Habsburgischen Eisenbahnen versetzt und Karel machte in Prag in der tschechischen Widerstandsbewegung Karriere. Cäcilia feierte große Hochzeit mit dem Gemeindevorsteher von Königinhof, einem angesehenen Mann, sie freute sich auf ein angenehmes Leben in der schönen Stadt an der Elbe. Niemand in der Familie verstand Cäcilias Wahl, denn Hermann war ein roher Militarist, ein Verächter alles Tschechischen und vielfach aktiv in deutschnationalen Vereinigungen.
Johannes selbst hatte sich verändert.
Es musste alles anders werden, er musste anders werden! So konnte es nicht weitergehen. Wange und Mund waren gut geheilt. Man sah ihn häufiger auf dem Marktplatz, es schien, dass sich die Leute an ihn gewöhnt hatten und er sich an sie.
Der Metzger Brandeis sah es mit Freude und sagte zu seiner Frau: „Ich glaub, der Czermak-Bub ist über den Berg.“
Häufig wurde Johannes in der Bücherleihstelle Zur Slawischen Linde gesehen. Zuhause rückte er einen Tisch an das Fenster der großen Stube, von wo aus er auf das Leben des Marktplatzes blicken konnte und es mit zunehmender Neugier verfolgte. In jüngster Zeit sah ihn die Mutter mitunter sogar lachen. „Weißt du“, fragte er, „wie der Heinrich Heine den Gottvater beschreibt, als er die Welt erschaffen hat? Hör zu:
Kaum hab ich die Welt zu schaffen begonnen,
In einer Woche war’s abgetan.
Doch hatt ich vorher tief ausgesonnen
Jahrtausendlang den Schöpfungsplan.
Das Schaffen selbst ist eitel Bewegung,
Das stümpert sich leicht in kurzer Frist …
‚das stümpert sich leicht‘ – ist das nicht gut? Das bin ich, ich stümpere auch so vor mich hin, zwar nicht leicht, aber es wird schon –“, sagte Johannes und seine Mutter war überrascht vom ironischen Unterton. Mit größerer Anteilnahme las er nun täglich die Neue Freie Presse, die in der ganzen Monarchie vertrieben wurde, und am Wochenende kaufte er Národní listy, das Organ der Jungtschechen, Karels Lieblingszeitung. Sich bilden, wissen, was geschieht, sich ändern, das wollte er. Den Gedanken, noch einmal in das Gymnasium nach Braunau zurückzukehren, um die Schule abzuschließen, verwarf er. Ebenso das Angebot des Vaters, die Kunsttischlerei zu erlernen. Er war fast einundzwanzig, er scheute sich einerseits, dem Spott seiner Mitschüler ausgesetzt zu sein, andererseits, dem Vater nicht genügen zu können. So entschloss er sich, nach Breslau zu reisen, um den Johanniter um Rat und, im besten Fall, eine Arbeitsmöglichkeit zu ersuchen. Er hatte ihm seit seiner Rückkehr mehrere Briefe geschrieben, jedoch nie Antwort erhalten. Johannes deutete es als Überlastung.
Breslau wurde eine Enttäuschung. Der Johanniter war nicht mehr im Ordensspital. Er wäre nach Johannes’ Entlassung fortgegangen, wahrscheinlich nach Köln, hieß es, vielleicht sogar nach Jerusalem. Die Anonymität der großen Stadt, die Johannes bei der denkwürdigen ersten Ausfahrt so genossen hatte und in der er jetzt heimisch zu werden hoffte, erschreckte ihn. So allein gelassen, verstörten ihn die vielen Menschen und die tausend Möglichkeiten, hier zu arbeiten und zu leben.
Eine Nacht blieb er im Gästezimmer des Klosters. Schlaflos. Fragte sich, was er denn nun eigentlich tun wolle. Er hatte den Eindruck, dass noch jemand im Zimmer war. Keineswegs unheimlich kam es ihm vor, eher vertraut. Ich bin lange genug hier gewesen, das wird es sein, sagte er sich.
Trotzdem zündete er eine Kerze an.
Blieb stehen vor dem Spiegel.
Sah sich, blickte sich an.
Nach langer Zeit nickte er sich zu.
Er ballte keine Faust, zerschlug nicht das Glas und rannte nicht in Panik davon. Er wusste, dass am Tor niemand auf ihn warten würde, außer er selbst.
Johannes fuhr in die Provinz, in das Vertraute zurück. Er stand auf dem Bahnhof von Breslau, hielt der Menge stand, schob seinen Hut aus dem Gesicht. Beschloss, nicht ohne Theatralik, ab jetzt mutig zu sein und seine Lethargie auf die Schienen zu werfen.
Er kaufte eine Karte und stieg in ein Coupé. Er fuhr dieselbe Strecke wie damals mit Franz. Mit jedem Stoß der Räder, so stellte er es sich im Rausch des Tempos vor, vernichtete er ein Zögern, ein Selbstmitleid, ein Hadern, einen Selbstmordgedanken.
Er blickte aus dem Fenster, er kannte die Gegend nicht, er wollte sie in Zukunft kennenlernen. Jedes rhythmische Schlagen der Räder war ihm ein Ja und ein Ja.
In Gedanken warf er die Blätter, auf die er seine Albträume geschrieben hatte, aus dem Fenster, und übergab sie der flüchtigen Welt.
Als er nach Neustadt kam, war er voller Pläne. Er dachte daran, nach Czernowitz zu fahren, um Ferdinand zu suchen. Der Freund war tatsächlich von den Preußen gefangen genommen, nach drei Monaten jedoch entlassen worden und war zu seinen Eltern zurückgekehrt. Zunächst jedoch wollte Johannes nach Brünn, um mit Franz die Zukunft zu besprechen.
Es kam anders.
Das Rauschrot der Träume erlosch.
Zwei alltägliche Erlebnisse machten zunichte, was so mühsam erkämpft war. Schneller als gedacht und tiefer als befürchtet.
An einem warmen Nachmittag schlenderte Johannes zwischen den ergrünenden Bäumen über die Kohenského-Chaussee. Eine Schar Kinder kam ihm entgegen. Schon von weitem riefen sie: „Das Krüpperl kommt, das Krüpperl kommt, das Krüpperl ohne Kinn und Kauen“, sie lachten und liefen kichernd davon. Da packte ihn die Wut, er rannte ihnen nach, wartet nur, schrie er, drohte, hatte sie mit erhobenem Stock fast eingeholt, Passanten blieben erschrocken stehen, ein Mann hielt ihn grob auf – als er die Verzweiflung im entstellten Gesicht des Verfolgers sah, hielt er inne und ließ los.
Kurze Zeit später traf er an einem Sonntagmorgen einen Kameraden aus der Musikschule, mit dem er in der Kapelle der Nationalgarde gespielt hatte. Filip war in großer Montur, trug seine Posaune unter dem Arm und war auf dem Weg zum Hochamt in der Dreifaltigkeitskirche, in der an diesem Tag mit großem Orchester Primiz für einen jungen Neustädter Priester gefeiert werden sollte. Allein dieser Anblick zerschnitt die Fäden, mit denen sich Johannes sein kunstvolles Überlebensnetz geknüpft hatte. Filip war bester Laune, sein rundes Gesicht glänzte, er schwitzte in der Tracht, stieß Johannes mehrmals übermütig an, plapperte vor sich hin, erzählte aus seinem Leben und seiner erfolgreichen Posaunerei und fragte dann: „Weißt du eigentlich, dass Agáta geheiratet hat? Sie ist nach Troppau gezogen, weißt eh, der Hauptstadt vom mickrigen Restgebiet Österreichisch-Schlesien, dort lebt sie jetzt – bist ihr ja einmal nachgestiegen, der zarten Geigerin Agáta, oder nicht? Na ja, jetzt wär das alles sowieso vorbei für dich …“ Und Filip stieß Johannes nochmals freundschaftlich auf die Brust, sagte noch „Nichts für ungut, tut mir leid, entschuldige“, und ging seines Weges zum Kirchentor.
Johannes war erstarrt.
Danach verstummte er.
Er war ein Krüppel.
Ein Krüppel würde er bleiben.
Unnütz, ungeliebt, eine Spottfigur.
Nach wenigen Tagen sah man ihn hinunter an das schattige Ufer der Mettau gehen. Er klopfte beim Schmied an, bei Herrn Vitus Kriwanek.
Sie sprachen lange.
Kurz darauf fing Johannes eine Schmiedelehre an.
Er wollte in die Finsternis.
In das Ungesehene.
Wollte die Fertigkeit für Feinarbeiten erlernen.
Für schmiedeeiserne Grabkreuze.
Für die Toten von Chlum.
Für Bohumil und die Namenlosen.
Gegen alle Einwände von Eltern und Geschwistern blieb Johannes bei seinem Entschluss, starrköpfig wie 1866. Zum Neujahrsfest starb der Vater. Jetzt, als es zu Ende ging, konnten sie reden und der Sohn bat um Verzeihung. Es wäre die falsche Entscheidung gewesen damals, sagte Johannes, diesmal jedoch wäre es die richtige.
„Du bist nicht schuld an meinem Weggehen gewesen, du hättest mich nicht halten können. Die Phrasen der Kriegshetzer sind nicht schuld, ich hätte sie nicht glauben müssen. Ich allein bin’s, ich war unwissend, selbstherrlich und ehrsüchtig – oder wir alle sind schuldig, weil wir es seit ewig nicht schaffen, Frieden zu machen.“
„Du redest plötzlich so sicher“, sagte der Vater, „wie kommt das?“
„Ich hab viel an den Johanniter gedacht in der letzten Zeit. Manchmal hab ich das Gefühl, dass er in meiner Nähe ist. Du hast ihn ja gekannt, er war so ungreifbar. Im Morgengrauen, wenn ich noch im Halbschlaf bin, kommt es mir vor, als ob ich mit ihm reden könnte und er mir Ratschläge gäbe. Und dass es die richtigen sind.“
Johannes brachte ein frisches Glas Wasser für den Vater, beugte sich nahe zu ihm und sagte noch, dass er nach diesen langen vier Jahren der Mutlosigkeit endlich eingesehen habe, dass er selbst sein Leben leichtfertig weggeworfen habe, jetzt sei er so weit, ein neues zu suchen. Er stand auf und ging zum Fenster. Kahl stand der Marillenbaum an sein Spalier gebunden. Die Türe zur Werkstatt war verriegelt. Auf der Wehrstraße zwischen Zaun und Felsabsturz zog ein Ochsengespann vorüber, der Leiterwagen ächzte unter einer schweren Last. Jenseits der Mettau lagen die Höhenrücken im Weiß der Schneefelder und dem Schwarz der Nadelwälder. Der Himmel war grau und nieder.
Der Vater starb wenig später, zittrig, herzkrank und versöhnt.
Der Tischlergeselle, der inzwischen Meister geworden war, führte die Werkstatt weiter, kam ohne das Ansehen von Quirin Czermak jedoch bald in Schwierigkeiten und musste den Betrieb zum Verkauf anbieten. Weder Franz noch Karel konnten mit so großen Summen aushelfen. Für das Gewerbe gab es keinen Interessenten, zum Verkauf stand demnach nur das schöne Haus auf dem Marktplatz, das ohne gutes Einkommen nicht zu halten war. Neuer Besitzer wurde der ehrgeizige Versicherungsbeauftragte Svoboda, dessen Akquisitionen weit in das Gebiet des Böhmischen Paradieses und des Glatzer Grenzlandes hineinreichten und der ein repräsentatives Büro auf dem Stadtplatz von Königgrätz besaß. Seine Frau, belesen und beflissen – Johannes kannte sie flüchtig aus der Bücherei Zur Slawischen Linde –, war Lehrerin in Nachod, so lag Neustadt günstig in der Mitte. Rosa Czermak kehrte auf den elterlichen Bauernhof zurück, ihr Bruder hieß sie willkommen als Arbeitskraft und Hüterin seiner kleineren Kinder.
Johannes zog in das Gebäude der ehemaligen Werkstatt am Ufer der Mettau, das der Familie geblieben war. Es war nicht schwierig, den Raum in eine bescheidene Bleibe mit zwei Zimmern umzubauen, Fließwasser gab es reichlich, eine Toilette war im Schuppen vorhanden und Johannes hatte keine großen Ansprüche. Der frühere Lehrbub, der eine andere Arbeit im Ort gefunden hatte, half ihm gerne. Der glücklose Nachfolger des Vaters ging in das Sägewerk von Weckelsdorf/Teplice.
Und die große politische Landschaft? Was wäre von ihr zu erzählen?
Nach der Völkerschlacht von 1866 wurde der Deutsche Bund unter der Führung Österreichs aufgelöst. Dies hatte zur Folge, dass der habsburgische Kaiser jegliche Verankerung in deutschen Landen verlor und das Kernland Österreich plötzlich eine Minderheit im eigenen Reich wurde, bevölkerungsmäßig und von der Sprache her. Dies zwang Kaiser Franz Joseph I. schon ein Jahr nach Königgrätz eine Personalunion mit den Ungarn einzugehen, so dass aus der k.k. Monarchie eine gleichberechtigte k.u.k. Doppelmonarchie wurde, was die anderen Kronländer, vor allem Böhmen, zutiefst verletzte und in den kommenden Jahren zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen führte. Preußen hingegen annektierte oder vereinigte innerhalb kürzester Zeit alle deutschen Königreiche und Kleinstaaten, stieg zur politischen und militärischen Großmacht auf und stürzte sich in einen Krieg mit Frankreich.
Vielleicht hatte der stille Tischlermeister Czermak aus Neustadt an der Mettau eine Ahnung von den sich daraus ergebenden Entwicklungen. In der kleinen Bibliothek, die nach seinem Tod auf den ältesten Sohn Franz überging, fand dieser viele Jahre später im Band VII der in Leder gebundenen 15 Bände der Gesammelten Schriften von Wilhelm von Humboldt einen offenbar noch vom Vater eingelegten Zettel mit folgender Stelle:
… Man muß auf keine Weise den wahren und eigentlichen Zweck des Deutschen Bundes vergessen, insofern er mit der europäischen Politik zusammenhängt. Dieser Zweck ist Sicherung der Ruhe; das ganze Dasein des Bundes ist mithin auf Erhaltung des Gleichgewichtes durch innewohnende Schwerkraft berechnet; diesem würde nun durchaus entgegengearbeitet, wenn in den Reihen der europäischen Staaten … noch ein neuer kollektiver eingeführt würde. Niemand könnte dann hindern, daß nicht Deutschland als Deutschland auch ein erobernder Staat würde, was kein echter Deutscher wollen kann …
Jahreswende 1870/71.
Europa hielt den Atem an.
Preußen feierte einen großen, schnellen Sieg.
Der deutsch-französische Krieg war zu Ende. Am 18. Jänner 1871 kam es zu einem denkwürdigen, weit in das 20. Jahrhundert dunkel-folgenreich hineinwirkenden Ereignis: Im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles, dem Schloss der französischen Könige, wurde vor der besiegten und gedemütigten Grande Nation der preußische König Wilhelm II. zum deutschen Kaiser gekrönt und das deutsche Kaiserreich ausgerufen.