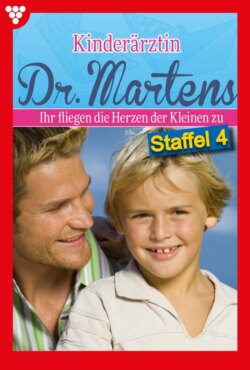Читать книгу Kinderärztin Dr. Martens Staffel 4 – Arztroman - Britta Frey - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Kann ich jetzt gehen, Mami?« fragte der achtjährige Florian ungeduldig und fügte noch hinzu: »Ich bin mit den Hausaufgaben fertig. Wenn du willst, kannst du meinen Hausaufsatz heute abend durchlesen und mir sagen, ob er dir gefällt.«
»Fein.« Daniela Redlich strich sich über das dichte blonde Haar, das noch nie eine Dauerwelle gesehen hatte, weil das nicht notwendig war. Es bauschte sich in Wellen und Löckchen um das schmale Gesicht der jungen Frau, die vormittags in der Gemeindeverwaltung Ögelas arbeitete, weil die Witwenrente, die sie nach dem Unfalltod ihres Mannes bezog, naturgemäß recht gering war. So gering, daß sie gezwungen war, sich etwas dazuzuverdienen. Aber das ging sehr gut, denn morgens, wenn Florian zur Schule mußte, verließen sie gemeinsam die Wohnung, und mittags holte Florian seine Mutter am Gemeindehaus ab, und sie gingen gemeinsam wieder heim.
Sie hatten ihr Leben ganz aufeinander eingestellt, ohne sich einzuengen. Und da sie beide fabelhaft organisieren konnten, kamen sie auch sehr gut zurecht.
Daniela strich Florian über das Haar, das etwas dunkler, aber ebenso lockig wie ihres war.
»Lauf nur, aber vorher versprichst du mir, nicht leichtsinnig zu sein. Laß dir nicht etwa einfallen, auf den Baggersee zu laufen. Die Eisschicht ist noch nicht dick genug. Sie wird unter dir brechen – und ich brauche dir wohl kaum zu erzählen, wie gefährlich das ist.«
»Du kennst mich doch, Mami«, sagte Florian treuherzig. Daniela lachte leise und gab ihm einen liebevollen Klaps auf die Schulter.
»Eben, mein Sohn«, sagte sie neckend. »Und deshalb sage ich dir ja auch, daß du vorsichtig sein sollst.«
»Keine Sorge, Mami. Du kannst dich auf mich verlassen«, beteuerte Florian, wand sich den von Daniela gestrickten bunten Schal um den Hals und lief schon davon, ehe sie noch etwas sagen konnte. Lächelnd schaute sie hinter ihm drein. Ihr Junge! Er war alles, was sie hatte, alles, wofür es sich zu leben lohnte.
Damals, vor etwas mehr als zwei Jahren, als Hans ihr die Nachricht gebracht hatte, daß Günther tödlich verunglückt sei, hatte sie zuerst geglaubt, das Leben müsse nun auch für sie aufhören. Aber sie hatte sich ihrem schrecklichen Schmerz nur einige Tage überlassen. Dann hatte sie sich daran erinnert, daß da Florian war. Florian, der damals Sechsjährige, der sie brauchte und auf sie angewiesen war.
Tapfer hatte Daniela Redlich ihr Leben selbst in die Hand genommen, war glücklich gewesen, als sie die Stelle bei der Gemeindeverwaltung angeboten bekam, und hatte einsehen müssen, daß die Welt sich weiterdrehte, wenn man auch persönlichen Kummer zu tragen hatte, der fast zu schwer erscheinen wollte.
Langsam, aber sicher, hatte sie ihr Leben und damit auch das Florians, wieder in den Griff bekommen. Sie hatte den Traum vom eigenen Häuschen im Grünen begraben müssen, denn dazu würde sie nie das Geld aufbringen können. Sie hatte sich mit Florian das gemietete Häuschen sehr gemütlich eingerichtet und wünschte sich nur eines – daß es so bleiben möge.
Florian kam in der Schule gut mit. Er war nicht der Klassenbeste, aber das erwartete Daniela auch nicht von ihrem Buben. Er war aufgeschlossen und lernte gut, war ordentlicher als alle seine Freunde zusammen, wie Daniela von den anderen Müttern erfuhr, und dachte stets daran, daß er seiner Mutter so wenig Arbeit wie möglich machte. Manchmal, so dachte Daniela oft, benahm er sich schon wie ein kleiner Erwachsener.
Im Augenblick jedoch war Florian alles andere als erwachsen. Er lief über die dünne Schneedecke, die sich in den letzten Tagen gebildet hatte, hinüber zum Schulhof, wo er sich mit den anderen Buben verabredet hatte. Sie beschlossen, eine Schlittenbahn anzulegen, möglichst lang und breit. Aber schon bald mußten sie einsehen, daß das noch nicht möglich war. Es war einfach noch nicht genug Schnee gefallen. Zwar fing es wieder an zu schneien, aber es würde noch dauern, bis genug Schnee gefallen war, um eine richtige, zünftige Bahn anlegen zu können.
»Was tun wir jetzt?« fragte Klaus Lange, dessen Vater eine Autoreparaturwerkstatt hatte, in der man herrlich spielen konnte. Leider wurde das nur äußerst selten erlaubt, und wenn, dann standen nicht mehr allzu viele Autos da, in denen man die herrlichsten Spiele aushecken konnte.
»Laß uns mal nachsehen, ob bei deinem Vater viel zu tun ist«, schlug Florian vor. Die anderen, Berthold Wieland und Heiner Mander, die mit Florian in eine Klasse gingen, nickten begeistert.
Im Schnee draußen war es sehr schön, und sie waren auch froh, daß endlich mehr Schnee fiel, aber in der Werkstatt war die Heizung an. Und das war auch nicht zu verachten. Unterwegs trafen sie noch drei andere Klassenkameraden, die sich ihnen anschlossen, als sie hörten, daß man zur Werkstatt wollte.
Aber dort wartete eine große Enttäuschung auf sie. Man konnte sie in der Werkstatt nicht gebrauchen, weil ungewöhnlich viel zu tun war. Die meisten Autofahrer erinnerten sich in letzter Sekunde daran, daß man bei diesem Wetter besser Winterreifen aufziehen sollte. Und wieder andere wollten ihr Auto winterfest machen. Jedenfalls war für die nunmehr sechs Buben kein Platz vorhanden. Und so beschlossen sie, weil sie unbedingt zusammenbleiben wollten, daß sie sich etwas anderes einfallen lassen mußten.
Wie immer war Klaus Lange der Wortführer. Und er schlug vor: »Kommt mit! Wir schauen auf das große Thermometer an der Werkstattwand draußen. Und wenn es unter drei Grad ist, sollten wir die Eisdecke auf dem Baggersee kontrollieren. Wäre doch einsame Spitze, wenn wir endlich Schlittschuh laufen könnten, was?«
Florian dachte an das Versprechen, das er seiner Mutter gegeben hatte. Aber dann sagte er sich, daß sie ja nicht auf den Baggersee wollten, sondern nur nachschauen, ob das Eis bald dick genug war, daß man sich hinauswagen konnte.
Kinder haben es immer eilig. Es war beinahe, als ging es ihnen nicht schnell genug, zum See zu kommen. Sie rannten, schrien durcheinander, hoben die Arme hoch, als wollten sie den fallenden Schnee einfangen. Sie stürmten voran. Ja, Kinder haben es wirklich immer eilig.
So mochten auch einige Einwohner von Ögela denken, denen sie begegneten. Es waren bei diesem Wetter nicht viele Leute unterwegs. Die meisten verschoben die Einkäufe, die sie sich eigentlich vorgenommen hatten, auf den nächsten Tag und blieben lieber daheim in ihren warmen Wohnungen.
Diejenigen aber, denen die Buben begegneten, schauten ihnen kopfschüttelnd nach und mochten sich wohl fragen, was in aller Welt diese Buben dazu brachte, sich bei diesem Wetter draußen aufzuhalten und dazu auch noch die beste Laune zu haben, die man sich nur vorstellen konnte.
Ein paar Leute lächelten mehr oder weniger wehmütig, wohl, weil sie sich an ihre eigene Kindheit erinnerten und daran, daß sie um keinen Deut anders gewesen waren als diese sechs.
Das Ziel der Jungen, der Baggersee, lag am anderen Ende von Ögela, dort, wo es in die Heide ging, wo noch Wacholderbüsche standen und wo die Welt noch in Ordnung war.
Aber jetzt, bei diesem Wetter, war die Heide uninteressant und öde. Keiner der Jungen hätte auch nur einen einzigen Gedanken daran verschwendet, hinauszulaufen. Außer ein paar aufgeschreckten Kaninchen, die in wildem Zickzack-Kurs davonsprangen, oder einem kreischend davonflatternden Vogel würden sie nichts zu sehen bekommen. Und das war wahrlich nicht das, was sie sich an einem solchen Nachmittag vorstellten. Der Baggersee war tief, aber glasklar im Sommer. Es gab sogar Fische darin, und einige der Männer aus Ögela hatten auch einen Angelschein und eine Angelerlaubnis. Aber auch das interessierte die Jungen heute nicht. Sie wollten die Eisdecke in Augenschein nehmen und entscheiden, ob sie dick genug war oder nicht.
Vor der Baracke, in der das kleine Büro der Kiesgrube untergebracht war, stand ein Laster. Wahrscheinlich sollte Kies oder Sand aufgeladen werden. So stark war der Frost noch nicht, daß man sämtliche Bauarbeiten einstellen mußte. Und Ögela war ein aufstrebender Ort, wo viel gebaut wurde. Man wollte es weiterbringen in Ögela, und möglichst bald Stadt sein. Vielleicht bekam man dann auch eine eigene Autobahnzufahrt, und dann konnte man sicher sein, daß auch bald Fremde kommen würden. Ja, die Einwohner von Ögela hatten nichts dagegen, Marktlücken zu entdecken, die sie dann ganz schnell ausfüllen wollten.
Die Buben schlichen sich an der großen Baracke vorbei. Aus dem Schornstein kam Rauch. Bestimmt war es drinnen gemütlich warm. Aber darum kümmerten sich die Kinder nicht. Sie stiegen vorsichtig, um nicht ins Rutschen zu kommen, hinab bis zum Rand des Sees, der niedrig lag, und hockten sich, der Kälte nicht achtend, auf die großen Steine, die am Ufer verstreut lagen.
Endlich nahm Berthold Wieland einen größeren Stein auf und warf ihn schwungvoll auf die Eisfläche, die sich mehr und mehr mit Schnee bedeckte, denn der Schneefall wurde immer heftiger. Das hatte man schon mit größter Zufriedenheit feststellen können.
Berthold Wielands Stein fiel auf die Eisdecke und holperte noch einige Meter weiter. Nun bildete er in der Schneedecke eine Spur und war selbst als dunkler Fleck zu erkennen.
»Menschenskind! Habt ihr das gesehen? Sie hält! Die Eisdecke hält. Großartig. Dann brauchten wir gar nicht auf mehr Schnee zu warten, denn dann könnten wir die Schlittenbahn auch auf dem Eis anlegen. Sie würde hundertmal glatter und schneller auf dem Eis sein als auf Schnee.«
Jetzt meldete sich Florian recht energisch zu Wort.
»Das ist blanker Unsinn. Glaub nur ja nicht, daß die Eisdecke stark genug für uns alle ist, nur, weil ein Stein sie nicht durchschlagen hat. Ich meine, wir haben doch ein ganz anderes Gewicht als so ein Stein.«
»Das können wir auch ausprobieren.« Berthold mochte es gar nicht, wenn man seinen Vorschlägen nicht sofort zustimmte. Schließlich machte er sie doch, weil er selbst sie gut fand!
Klaus Lange, der für jeden Streich zu haben war, gab ihm Schützenhilfe.
»Ich finde die Idee prima«, sagte er begeistert. »Erst geht einer aufs Eis. Wenn es hält, geht der nächste und immer so weiter. Und dann bleiben wir auch nicht ruhig stehen, sondern hopsen und springen. Wenn das Eis dann noch bricht, weiß ich es auch nicht.«
»Das ist doch der helle Wahnsinn!« wandte Florian ein, aber es gab keinen, der auf ihn hörte.
Heiner Mander wollte wissen: »Und wer soll als erster hinausgehen? Wir sollten das auslosen, damit sich keiner reingelegt fühlt. Meint ihr nicht auch, daß das eine herrliche Mutprobe ist? Ich finde, die wäre schon längst einmal wieder fällig. Die letzte Mutprobe hatten wir im Herbst, als Dieter auf den Mast gestiegen ist.«
»Und er ist auch prompt hinabgefallen und hat sich beide Beine gebrochen«, sagte Florian sachlich. Sie schwiegen und starrten ihn für einen Augenblick betroffen an. Klaus murmelte: »Das arme Schwein liegt noch in der Klinik. Ich meine, wir könnten ihn auch mal wieder besuchen, was?«
»Erst wird das Eis untersucht«, beharrte Berthold Wieland und sah wild um sich. Florian wollte gerade eben vorschlagen, daß er doch seinen Mut beweisen sollte, indem er der Erste von ihnen war, der aufs Eis ging. Aber er schwieg. Man hätte ihn vielleicht für einen Feigling halten können. Und es gab nichts Schlimmeres im Leben eines richtigen Jungen, als für feige gehalten zu werden. Es wurde beschlossen, auf besondere Art zu losen. Und zwar nannten sie es Stein, Schere und Papier.
Die zwei, die gegeneinander losten, mußten eine Faust machen. Es wurde bis drei gezählt, und dann mußten sie die Handstellung halten, für die sie sich entschieden hatten. Flache Hand bedeutete Papier. Faust war Stein, und gespreizter Zeige- und Mittelfinger war die Schere. Je nachdem, was zusammentraf, gab es einen Sieger. Bei Papier und Stein war Papier Sieger, denn darin konnte man den Stein einwickeln. Bei Papier und Schere war die Schere Sieger, weil man mit ihr das Papier schneiden konnte. Und bei Schere und Stein war der Stein Sieger, weil man mit ihm die Schere schleifen konnte. Es war alles ganz einfach. Man zählte bis drei, und dann stand der Sieger fest.
Natürlich hatte man beschlossen, daß derjenige, der übrigblieb, auch als Sieger zu betrachten war, der die Ehre hatte, seinen Mut zu beweisen, indem er als Erster von ihnen aufs Eis ging.
Es traf, wie konnte es auch anders sein, ausgerechnet Florian!
Florian, der gar nicht aufs Eis wollte, der Angst davor hatte, einzubrechen, und der sich ganz ernsthaft daran erinnerte, was ihm seine Mutter eingeschärft hatte.
Nicht etwa, daß Florian ein außergewöhnlich gehorsames Kind war – o nein, das konnte man wahrlich nicht behaupten. Er hatte ebenso seine Fehler und machte seine Ausrutscher wie alle anderen. Das war es ja gerade eben, was die Erwachsenen als Erfahrung-Sammeln bezeichneten. Und da war er halt auch ein richtiger Junge, dem es nicht darauf ankam, ein Verbot nicht nur zu umgehen, sondern es ganz einfach nicht zu beachten.
Nur diesmal, hier am Baggersee, da war es anders. Da begriff er, daß seine Mutter weitsichtiger war als alle anderen einsehen wollten. Und nur aus diesem Grund machte er noch eine Einwendung.
»Es ist der helle Wahnsinn, was wir da tun. Von der Gemeinde prüfen sie doch täglich, ob das Eis dick genug ist, weil sie wissen, wie gern wir darauf spielen. Aber sie haben auch ihre Geräte dazu. Und wir, wir sind nur ein paar Kinder, die dazu noch nicht mal die Erlaubnis haben.«
»Mensch, Florian, komm schon! Sei kein Frosch! Das Eis hält. Und nicht nur dich, sondern uns alle.« Das war Berthold Wieland, der Florian jetzt einen abfälligen Blick zuwarf. »Oder willst du deine Feigheit etwa hinter angeblicher Vernunft verbergen?«
»Man ist nicht feige, wenn man vorsichtig ist. Man ist nicht feige, wenn man vernünftig ist. Und ich halte es für unvernünftig, aufs Eis zu gehen, von dem wir doch alle wissen, daß es noch gar nicht fest genug sein kann.«
»Wenn Florian also zu feige ist, schlage ich vor, wir losen neu aus und schließen Florian aus«, sagte Berthold Wieland da wütend. Er mochte Florian nicht besonders, weil Florian ein besserer Schüler und auch beliebter war als er. Er war sogar Klassensprecher, und das gefiel Berthold gar nicht. Er spielte viel zu gern selbst die allererste Geige. Und er war auch nur nett zu denjenigen, die alles, was er tat, guthießen und ihn bewunderten. Zu denen hatte Florian nie gehört. Und Berthold meinte, jetzt die Macht zu haben, Florian, den Rivalen, in die Knie zu zwingen.
»Sachte, sachte, ich mach es schon. Ich wollte nur darauf hinweisen, daß die Erwachsenen schon wissen, warum sie uns was verbieten. Aber daß ich feige bin, kann kein Mensch von mir behaupten. Du am allerwenigsten, Berthold.«
Ehe noch einer etwas von sich geben konnte, nahm Florian einen gewaltigen Anlauf und rannte aufs Eis.
Schon nach wenigen Schritten erwies es sich, daß er recht gehabt hatte. Es krachte, knirschte, barst. Florian hatte, weil alles so schnell ging, nicht mal mehr Zeit, einen entsetzten Schrei auszustoßen.
Instinktiv riß er die Arme hoch. Aber das half ihm auch nichts mehr. Blitzschnell versank er vor den Augen seiner Klassenfreunde.
Schreiend und entsetzt rannten sie davon, kopflos. Keiner wußte, was jetzt zu tun war, damit man Florian aus dem eisigen Wasser herausbekam.
Nur zwei behielten den Überblick, und das waren Heiner Mander und Klaus Lange.
Klaus schrie Heiner zu: »Bleib hier, falls er auftauchen sollte. Dann hilf ihm, so gut du kannst, und wenn du ihm nur deinen Schal zuwirfst, damit du ihn daran festhalten kannst. Ich laufe hoch zur Baracke. Vielleicht sind die Männer mit dem Lastwagen noch da. Die können uns dann helfen.«
Heiner erwiderte nichts. Er stand da und starrte auf die Oberfläche des Baggersees, aber es war nichts zu erkennen. Nur das Loch, das es gegeben hatte, als Florian ins Eis einbrach.
Vor lauter Hilflosigkeit und Angst begann der Junge zu weinen. Florian hatte recht gehabt. Er hatte sie alle gewarnt. Und ausgerechnet Florian hatte das Los getroffen. Er hatte nicht auf den See hinausgewollt, aber sie hatten ihn praktisch dazu gezwungen. Jemand, den man vor anderen als Feigling bezeichnete, kann gar nicht anders, als zu beweisen, daß er keiner ist.
Genau das hatte Florian getan. Und nun war er eingebrochen und vielleicht schon tot…
*
Klaus Lange atmete auf, er seufzte, so daß es schon beinahe wie ein Schluchzen klang, als er sah, daß der Laster noch vor der Baracke stand. Er taumelte beinahe, als er hineinrannte. Und dann konnte er kaum Luft bekommen. Er brachte es aber fertig, hervorzustoßen: »Florian – er ist ins Eis eingebrochen. Jetzt gerade. Vielleicht – vielleicht lebt er noch.«
Der eine Mann, dem man ansah, daß er über unbeschreibliche Kraft verfügte, rief: »Rufen Sie in der Klinik Birkenhain an, Helga. Ich laufe hinaus und versuche, den Kleinen herauszuholen.«
Er achtete nicht auf Klaus Lange, der atemlos auf einen Stuhl gesunken war, sondern rannte schon mit Riesenschritten davon. Klaus folgte ihm und dachte ausgerechnet in diesem Moment, daß er sich ganz genau vorstellen konnte, wie der Läufer bei Baron Münchhausen alle anderen hinter sich gelassen hatte.
Peter Michalke, der Mann mit den langen Beinen, kam am Baggersee-Ufer an, zögerte nicht eine Sekunde, sondern sprang in das eisige Wasser und strebte der Stelle zu, an der sich in der dünnen Eisfläche das große Loch befand, das entstanden war, als das Eis unter Florians Gewicht nachgab.
Peter konnte noch stehen, holt tief Luft und beugte sich unter die dünne Eisschicht. Er sah Florian leblos im Eiswasser liegen und griff nach ihm. Es war ein Griff wie mit einer eisernen Zange, die nie wieder loslassen würde. Er zog den Jungen zu sich heran, sah zu, daß sein Gesicht so schnell wie möglich an die Oberfläche kam und zog ihn mit sich zum Ufer. Er spürte die Kälte nicht, und auch nicht die Nässe, die durch seine Kleider bis auf die Knochen dringen wollte. Er achtete nur auf den Jungen in seinen Armen. Am Ufer legte er Florian mit den Füßen nach oben hin und hielt ihm die Nase zu. Dann holte er tief Luft und blies ihm seinen Atem in die Lungen. Dann unterbrach er das, preßte die Rippen des Jungen zusammen und hob die Hände über den Kopf. Dabei hielt er einen ganz bestimmten Rhythmus ein. Er hielt mit seinen Bemühungen auch nicht inne, als man in der Ferne das Jaulen des Martinshorns hörte, das ankündigte, daß die Hilfe unterwegs war, die man so dringend benötigte. Es war, als sei Peter Michalke kein Mensch, sondern eine Maschine, die präzise arbeitete, bis irgendwer sie abschaltete.
*
Martin Schriewers sah hoch, als Dr. Frerichs mit wehendem Kittel auf ihn zukam und sagte: »Lassen Sie das Schwester Trude weitermachen, Martin. Wir müssen zum Baggersee. Ein Junge ist ins Eis eingebrochen, und wir müssen zusehen, daß wir ihn so schnell wie möglich herbringen.«
Martin Schriewers lief schon hinüber, wo der Krankenwagen immer bereitstand, ließ den Motor an und fuhr an, als Frerichs sich neben ihn auf den Sitz geworfen hatte.
»Zum Baggersee?«, fragte Martin nachdenklich und fügte erbittert hinzu: »Ich weiß nicht, was diese Kinder dazu treibt, sich immer wieder leichtsinnig in solche Gefahren zu begeben. Aber eines weiß ich – wenn das mein Sohn wäre – der könnte sich auf eine saftige Abreibung gefaßt machen, das können Sie mir aber glauben.«
»Ich hoffe im Augenblick sehr, daß das Kind, das ins Eis eingebrochen ist, überhaupt noch in der Lage sein wird, einmal eine Abreibung zu bekommen, Martin.«
Martin Schriewers gab keine Antwort. Dazu gab es nichts mehr zu sagen, denn Dr. Frerichs hatte recht. Hoffentlich lebte dieses Kind noch.
»War da nicht jemand, der das Kind aus dem Wasser holen wollte?« fragte Schriewers, nachdem er schwungvoll eine Kurve genommen hatte.
»Ja, jemand vom Kieswerk wollte das Kind holen. Hoffentlich ist es auch gelungen. Martin, wenn Sie so leichtsinnig fahren, werden wir nie am Baggersee ankommen, sondern bestenfalls im Graben landen«, sagte Frerichs, als Martin wieder eine Kurve nahm, als trainiere er für eine Rallye.
»Keine Sorge, Dr. Frerichs, ich habe den Wagen schon im Griff«, beruhigte Martin ihn und sah kurz zur Seite. »Ich kenne den Wagen in- und auswendig – und er mich wahrscheinlich auch, jedenfalls hat er sich ganz offensichtlich an meine Fahrweise gewöhnt.«
»Das beruhigt mich sehr«, sagte Frerichs spöttisch.
Sie ließen den Wagen an der Baracke stehen, weil sie nicht bis ganz ans Ufer fahren konnten. Der See lag tiefer als die Straße, und es führte nur der Pfad zum Ufer. Aber sie waren schon mit ganz anderen Schwierigkeiten fertiggeworden.
Jeder ihrer Handgriffe saß. Dazu waren sie schon viel zu oft miteinander unterwegs gewesen, um Erste Hilfe zu leisten und einen Patienten in die Klinik zu holen.
In Sekundenschnelle hatten sie die Trage herausgeholt und gingen den Pfad hinab. Martin Schriewers stellte die Trage neben den Mann, der sich immer noch um das leblose Kind bemühte.
Jetzt hob Peter Michalke den Kopf und sah Frerichs und Schriewers unruhig an.
»Er lebt noch, glaube ich.«
Es war kein Puls zu ertasten, kein Atem festzustellen. Aber das mußte nicht bedeuten, daß Florian nicht mehr lebte. Schließlich war er stark unterkühlt, und das konnte seine Rettung bedeuten. Bei starker Unterkühlung arbeitet der menschliche Organismus sozusagen auf Sparflamme. Das konnte sich günstig ausgewirkt haben, denn alle Stoffwechselvorgänge im menschlichen Körper sind chemische Reaktionen. Alle chemischen Reaktionen laufen um so langsamer, je kälter es ist. Also ist auch der Sauerstoffbedarf eines unterkühlten Körpers geringer als normal. Die Verbrennungsvorgänge in den Körper- und Hirnzellen gehen nur langsam vor sich.
»Der Junge war sozusagen eingefroren, Herr Doktor«, erläuterte Peter Michalke, der nun die Kälte spürte und zu zittern begann. Dr. Frerichs nickte ihm anerkennend zu.
»Wir können nur hoffen, daß sich diese Unterkühlung positiv auswirkt, denn ein sozusagen eingefrorener Mensch braucht in diesem Zustand überhaupt keinen Sauerstoff.«
Sie legten Florian auf die Trage. Dann wandte sich Frerichs dem vor Kälte zitternden Peter Michalke zu und sagte freundlich: »Am besten, Sie kommen auch gleich mit. Ich finde, wir sollten Sie zumindest untersuchen, damit wir sicher sein können, daß Sie keinen Schaden davongetragen haben.«
»Machen Sie sich um mich mal keine Sorge, Herr Doktor. Ich kann was vertragen. Aber ich komme gern mit, denn es interessiert mich doch sehr, was mit dem Kerlchen da ist.«
Michalke deutete mit dem Kopf auf den Krankenwagen, in den die Trage mit Florian gerade geschoben wurde. Peter Michalke stieg nach Hartmut Frerichs ein und sah auf Klaus Lange, der dastand, dem die Tränen die rotgefrorenen Wangen hinabliefen, ohne daß er sich dessen so recht bewußt wurde. Er machte einen ganz verzweifelten Eindruck. Zum einen war er zutiefst erschreckt und entsetzt wegen des Unglücks, das Florian getroffen hatte. Und dann erschütterte ihn auch noch, daß die anderen schreiend davongelaufen waren, als wollten sie den Eindruck erwecken, gar nicht dabeigewesen zu sein. Damit wurde der Junge bestimmt so schnell nicht fertig…
*
Noch im Krankenwagen begann die Wiederbelebung Florians. Zuerst brachte Dr. Frerichs einen Tubus, einen Schlauch und das Sauggerät. Martin Schriewers bewies wieder einmal, daß er mehr als Hausmeister, Fahrer und Krankenträger war. Mit sicherem Griff legte er den Spatel, ein rechtwinkliges Stück Metall mit einer eingebauten Miniaturlampe, in Frerichs Hand. Der drückte vorsichtig Florians Zunge seitlich nach oben und erkannte im scharfen Licht der Lampe den Kehlkopfeingang, den Weg zur Luftröhre. Florian rührte sich immer noch nicht. Langsam schob Dr. Frerichs durch den Intubationstubus einen feinen Schlauch in die Luftröhre, direkt in die Bronchien. Das Ende des Gummischlauchs schloß er an das Sauggerät, drückte auf einen Knopf.
Spärlich zwar, aber dennoch gleichmäßig, floß das eingeatmete Wasser aus den Lungenflügeln in den kleinen Plastikbehälter.
»Weiter, Martin!« sagte Dr. Frerichs, dem der Schweiß auf der Stirn stand. Peter Michalke hatte sich in eine Ecke des engen Notarztwagens gedrückt und sah stumm und mit großen Augen auf Florian, der sich immer noch nicht rührte.
Martin Schriewers verband den Tubus mit dem Beatmungsgerät. Noch ein Knopfdruck. Die künstliche Beatmung lief.
Als Peter Michalke spürte, daß Dr. Frerichs sich ein wenig entspannte, fragte er leise, während er sich die Wolldecke, die Martin Schriewers ihm gegeben hatte, eng um den Körper zog: »Wird der Junge dieses Unglück überleben?«
Frerichs hob ungewiß die Schultern. »Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es kommt ganz darauf an, wie lange er unter dem Eis gelegen hat.«
Frerichs nahm das Mikrophon und bat über Funk, daß man in der Klinik alles für eine Wiederbelebung vorbereiten solle.
»Wir brauchen das EKG-Gerät und den Herzschrittmacher. Außerdem wäre es gut, wenn eine Anästhesie vorbereitet würde. Ich glaube sicher, daß wir einen Anästhesisten benötigen werden.«
Martin Schriewers wußte genau, daß es um Sekunden ging. Und so fuhr er denn nach der ersten Hilfe, die Dr. Frerichs geleistet hatte, wie der Sturmwind zur Kinderklinik Birkenhain. Das Martinshorn ließ er gleich an, während er durch Ögela fuhr. Und so wurde jedermann aufmerksam, daß da etwas geschehen war.
Auch Daniela Redlich hörte den Rettungswagen und trat ans Fenster. Sie hätte nicht sagen können, woher, es kam – aber sie hatte plötzlich ein ganz schlimmes Gefühl, fast wie eine Vorahnung.
»Florian!« flüsterte sie und preßte die Hände gegen die Schläfen. Florian war mit seinen Freunden zusammen. Aber wo, um alles in der Welt, waren sie? Daniela hatte keine Ahnung. Deshalb holte sie den Mantel von der Garderobe, schlüpfte hinein, band sich das Kopftuch um und lief die Treppe hinab. Ihr kleiner Wagen stand vor dem Haus, und Daniela warf sich förmlich hinein. Sie würde zum Schulhof fahren. Wahrscheinlich waren die Kinder dort. Jedenfalls hoffte sie das mit zitterndem Herzen.
Aber als sie ankam, war der Schulhof wie leergefegt. Nirgendwo eine Spur von den Kindern.
Daniela fuhr langsam an. Als sie auf die Straße bog, sah sie Klaus Lange. Sie war erleichtert und erschreckt zugleich. Klaus Lange weinte. Und er schien niemanden um sich herum wahrzunehmen!
Daniela hielt an, stieg aus und lief auf den Jungen zu, legte ihre Hand auf seine Schulter und fragte leise: »Würdest du mir sagen, wo ich Florian finde, Klaus?«
»Sie – sie haben ihn in die Klinik Birkenhain gebracht«, schluchzte der Junge auf. »Florian ist ins Eis eingebrochen, und ein Mann hat ihn herausgezogen. Dann ist der Rettungswagen gekommen, und sie haben Florian mit in die Klinik genommen. Er hat sich gar nicht mehr bewegt, und gesagt hat er auch nichts mehr. Er war einfach weg.«
Aber das hörte Daniela Redlich schon nicht mehr. Sie ließ den weinenden Jungen einfach stehen, was sonst nicht ihre Art war, kehrte zu ihrem Wagen zurück und fuhr an.
Ein paar Minuten später hatte sie die Klinik Birkenhain erreicht und stürzte zur Rezeption.
»Wo ist Florian?« fragte sie aufgeregt. »Was ist mit meinem Jungen?«
»Er ist noch im Behandlungsraum. Alle kümmern sich um ihn«, erwiderte Schwester Trude, kam hinter dem Tresen hervor und legte Daniela eine Hand auf die Schulter. »Bitte, Frau Redlich, beruhigen Sie sich. Sie helfen Ihrem Jungen ganz gewiß nicht, wenn Sie jetzt durchdrehen.«
»Aber – ich muß doch zu ihm! Ich bin seine Mutter! Er braucht mich jetzt. Sie können mich doch nicht daran hindern, jetzt bei ihm zu sein!«
»Doch, Frau Redlich, das muß ich sogar. Sie würden nur stören, wenn Sie auch noch ins Untersuchungszimmer gehen würden. Ich kann Ihnen versichern, daß alles für Ihren Jungen getan wird.«
»Diese Versicherung genügt mir nicht!« sagte Daniela und weinte plötzlich. »Ich will bei ihm sein. Verstehen Sie denn nicht? Er ist schließlich alles, was ich noch habe.«
»Sie würden die Ärzte nur behindern, Frau Redlich. Kommen Sie, setzen Sie sich zu mir. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen, bis wir näheren Bescheid bekommen.«
Die gleichbleibend ruhige Art Schwester Trudes verfehlte ihre Wirkung auf Daniela nicht. Sie ließ sich widerstandslos zu der Sitzgruppe hinter den hohen Blattpflanzen führen und setzte sich. Dann sah sie Schwester Trude aus angstvollen Augen an.
»Ich hatte es ihm ausdrücklich verboten!« sagte sie endlich. »Ich habe ihn so davor gewarnt, aufs Eis zu gehen. Es hat nichts genutzt. Das ist sonst gar nicht seine Art, müssen Sie wissen. Florian ist sonst ein folgsamer Junge, der mir kaum Probleme macht.«
»Ach, manchmal, wenn sie mit ihren Kameraden zusammen sind, wollen sie beweisen, wie mutig sie sind.« Schwester Trude sagte es voller Überzeugungskraft, als wisse sie genau Bescheid. Dann fuhr sie fort: »Daß solche Mutproben auch gefährlich sind, erhöht ihren Reiz. Diese Erfahrungen machen wir hier immer wieder. Aber es sind nicht nur diese Kinder hier, Frau Redlich. Es sind Kinder auf der ganzen Welt, die sich auf solche Art beweisen wollen, wie mutig sie sind. Man muß ihnen nur behutsam klarmachen, daß das keine Mutproben sind, sondern nichts weiter als Unsinn und das Herausfordern von Gefahren, die man sehr gut vermeiden könnte.«
»Das verstehe ich ja alles – aber ich verstehe nicht, daß Florian so schnell vergessen konnte, was ich ihm gesagt habe.« Daniela wischte sich noch einmal über die Augen.
»Wissen Sie, wie es herausgefordert worden ist? Da verliert auch der folgsamste Junge schon mal den Überblick und denkt nicht mehr an das, was er versprochen hat oder was ihm verboten worden ist.«
»Trotzdem«, beharrte Daniela fast eigensinnig. »Er hätte nicht aufs Eis gehen dürfen.«
»Nun, jetzt weiß er das wahrscheinlich auch. Ich schwöre Ihnen, daß er das bestimmt nicht noch einmal tun wird.«
»Dabei wissen wir noch gar nicht, ob er mit dem Leben davonkommen wird«, sagte Daniela und senkte den Kopf. Dann aber erhob sie sich und sah auf Schwester Trude hinab.
»Diese Ungewißheit ist nicht länger zu ertragen. Ich lasse mich nun nicht mehr länger daran hindern, zu meinem Jungen zu gehen. Auch von Ihnen nicht.«
Ehe die verdutzte Schwester Trude begriff, was Daniela Redlich vorhatte, war diese schon durch die Schwingtür gegangen und im Untersuchungsraum verschwunden.
Hanna Martens entdeckte sie sofort und sah Dr. Frerichs auffordernd an. Dann sagte sie ruhig: »Er muß hinübergeschafft werden.«
Und schon wurde das fahrbare Bett mit Florian darauf hinausgeschoben. Daniela hatte nur einen einzigen kurzen Blick auf ihren Florian werfen können. Sie war zuerst wie erstarrt vor Entsetzen. Er hatte ein so winzigkleines, tieferblaßtes Gesicht bekommen. Das hatte sie noch nie an ihm gesehen.
»Florian!« stieß sie hervor und klammerte sich an Hanna an. »Was ist mit ihm? Lebt er überhaupt noch? Wo schaffen Sie ihn hin?«
»Wir tun alles für ihn«, sagte Hanna beruhigend. »Aber dazu müssen Sie uns auch in Ruhe arbeiten lassen.«
»Ja, natürlich. Entschuldigen Sie. Es ist nur – er ist doch alles, was ich noch habe. Und ich möchte…« Daniela Redlich brach ab, sah Hanna erstaunt und fassungslos zugleich an und sackte einfach in sich zusammen.
Buchstäblich im letzten Augenblick konnte Hanna sie noch auffangen. Schwester Christiane, die ebenfalls hinzugesprungen war, half ihr.
»Es soll sich jemand um sie kümmern«, sagte Hanna mit leiser Ungeduld in der Stimme. Sie legten Daniela auf eine Untersuchungsliege. »Ich muß hinüber zur Reanimation.« Erleichtert wandte sie sich der soeben eintretenden Dr. Wenke Andergast zu. »Kann ich sie hier lassen?«
»Natürlich. Ich werde mich um sie kümmern.«
Aufatmend verließ Hanna den Untersuchungsraum Sie hatte viel Verständnis für die angstvolle Mutter aber der kleine Florian hatte jetzt Vorrang.
Außerdem war Daniela Redlich bei Dr. Andergast in den allerbesten Händen.
*
Hanna sah ihre Mitarbeiter an, während sie sich über Florian neigte.
»Die Mutter des Jungen ist schon in Behandlung. Normale Ohnmacht. Aber was ist mit ihm? Wie lange hat er unter dem Eis gelegen?«
»Keine Ahnung, Chefin.« Wie um seine Worte noch zu unterstreichen, hob Dr. Frerichs die Schultern. »Der Mann, der ihn herausgezogen hat, sagte, es kann nicht allzu lange gewesen sein. Deshalb können wir immer noch Hoffnung haben.«
»Gut, dann fangen wir gleich mit dem EKG an.«
Sie befanden sich im kleinen OP, der aber ebensogut ausgestattet war wie die beiden großen. Hier hatten sie die modernsten Geräte und damit auch die beste Möglichkeit zur Reanimation, zur Wiederbelebung.
Zügig setzte Dr. Frerichs die Elektroden auf das Brustbein und die Hand- und Fußgelenke des Jungen Plötzlich war die Atmosphäre zum Zerreißen gespannt. Was sagte das EKG? Hanna drückte auf den Knopf. Auf dem mit dem EKG-Gerät verbundenen Monitor leuchtete das Bild auf.
»Verdammt«, entfuhr es der jungen Ärztin gar nicht damenhaft, »das habe ich befürchtet.«
Der gerade Strich eines klinisch toten Herzens flimmerte über die Mattscheibe. Es war nicht einmal der Ansatz jener gezackten Linie vorhanden, die ein intaktes Herz ausstrahlt.
»Externer Herzschrittmacher?« fragte Frerichs und sah Hanna fragend an.
»Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, Herr Frerichs. Nach Ihrem Funkspruch vorhin haben wir ihn schon vorbereitet.«
Das war die Zusammenarbeit, die Hanna Martens so sehr schätzte, und wie sie im Kampf gegen den Tod unbedingt notwendig war!
Mit leichter Hand klebte Hanna zwei Elektroden auf Florians Brustkorb und verband sie mit dem externen Schrittmacher. Dabei handelte es sich um ein Gerät, das Gleichstromstöße von sich gab.
Sinn der im normalen Herztakt eingefluteten Gleichstromstöße war, das klinisch tote Herz erst einmal wieder zum Schlagen zu bringen. Jeder Stromstoß konnte das Herz zusammenziehen und so den Blutkreislauf wieder in Gang setzen. Damit würde dann Sauerstoff in die Zellen des Körpers transportiert. Ziel dieser wichtigen Aktion war natürlich, das Herz aus eigener Kraft wieder schlagen zu lassen – ohne technische Unterstützung.
Fast zwanzig Minuten standen sie um Florian und warteten auf ein Lebenszeichen. Zwischen den Stromstößen schloß Dr. Frerichs ihn immer wieder an das EKG an. Aber sie sahen ständig das gleiche Bild – ein gerader Strich auf dem Monitor.
Plötzlich – eine halbe Stunde war vergangen – glaubte Hanna, wieder Farbe im Gesicht ihres kleinen Patienten zu erkennen. Farbe, die Leben bedeuten konnte!
»Wir sollten ihm noch zwei Minuten Strom geben«, schlug sie mit beherrschter Stimme vor. »Dann sind seine Chancen viel größer.«
»Klar doch«, sagte Dr. Frerichs verbissen.
Wie gebannt schauten sie auf Florian.
Tatsächlich – das Gesicht färbte sich. Das Blau der Lippen wich einem blassen Rot. Der Körper wurde fühlbar wärmer.
Bedeutete das die Rettung? Durften sie alle hoffen?
Die zwei Minuten vergingen schnell. Ja, das EKG-Gerät zeichnete eine gezackte Linie auf. Das Herz schlug wieder.
Sie hatten es geschafft!
Dr. Frerichs schaute Hanna an.
»Mir fällt ein Stein vom Herzen«, sagte er still. Und die anderen verstanden ihn und nickten ihm lächelnd zu.
»Auf die Station mit ihm«, sagte Hanna forscher, als sie sich eigentlich fühlte. »Ich kümmere mich derweilen um die Mutter.«
Als sie in den Untersuchungsraum kam, war Daniela schon wieder wach. Sie saß auf dem Untersuchungsbett und sprang auf, als sie Hannas ansichtig wurde.
»Was ist mit meinem Kind?« rief sie aufgeregt aus. »Was ist mit Florian?«
»Er lebt und wird wieder gesund. Wir haben ihn gerade eben zur Station gebracht.«
Danielas Schultern sackten ein wenig nach vorn. Es war, als müsse auch der Körper der jungen Frau sich von der Last der schrecklichen Angst um ihr Kind erholen.
»Danke«, stammelte die junge Frau, während Tränen der Erleichterung und des Glücks aus ihren Augen strömten. »Ich danke Ihnen so sehr. Mein Leben wäre auch zu Ende gewesen, wenn Florian…« Sie brach ab, als sei sie nicht imstande, das Schreckliche auszusprechen. Aber Hanna verstand sie auch so. Sie legte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter und sagte in beruhigendem Ton: »Sie können in einer Viertelstunde zu Florian aufs Zimmer, Frau Redlich.«
Dann wandte sich Hanna Schwester Trude zu.
»Wo ist der Mann, der den kleinen Florian aus dem Wasser gezogen hat? Ich möchte ihn mir ansehen. Schließlich ist es keine Kleinigkeit, einen Buben aus dem Eiswasser zu ziehen. Wahrscheinlich wird er sich zumindest eine handfeste Erkältung eingehandelt haben.«
»Der Chef kümmert sich um ihn«, gab Schwester Trude zurück. Dann läutete das Telefon, und sie nahm den Hörer auf.
Daniela hielt Hannas Arm fest.
»Ich – ich möchte diesem Mann danken, Frau Dr. Martens. Ich – er hat doch schließlich meinem Florian das Leben gerettet. Ich möchte ihm sagen, daß ich ihm das nie im Leben vergessen werde.«
»Kommen Sie mit! Wir werden also gemeinsam nach ihm sehen.« Hanna lächelte Daniela freundlich an. Und unter diesem Lächeln wurde die junge Frau plötzlich ganz ruhig.
»Er soll wissen, daß er in meinen Augen ein Held ist«, sagte sie still. Und Hanna verstand sie. In ihren Augen war Peter Michalke auch ein Held.
*
Peter Michalke hatte eine Wolldecke um sich geschlungen. Er war jetzt sehr blaß, hatte dunkle Ränder unter den Augen und machte den Eindruck eines Menschen, der mehr hatte leisten müssen, als er eigentlich konnte. Hanna trat mit der plötzlich sehr schüchtern wirkenden Daniela Redlich auf Michalke zu und sagte mitfühlend: »Sicher hat mein Bruder Ihnen schon vorgeschlagen, bis morgen bei uns zu bleiben, nicht wahr? Sie sehen aus, als könnten Sie absolut Ruhe brauchen.«
»Oh, es ist nicht wegen der Anstrengung. Das war gar nicht so schlimm. Es ist nur – es war – also, mein Kind ist tot. Vor drei Jahren tot zur Welt gekommen. Und meine Frau ist dabei gestorben. Das alles steht wieder ganz frisch vor mir. Wie geht es dem Jungen? Florian heißt er ja wohl, nicht wahr?«
»Er ist gerettet, Herr Michalke. Ich habe Ihnen seine Mutter hergebracht. Sie sagte, daß sie sich bei Ihnen bedanken will.«
Jetzt erst trat Daniela vor. Sie sah Peter Michalke lange Zeit schweigend an. Dann aber streckte sie ihm die kleine, schmale Hand entgegen und sagte leise: »Ich – ich wußte gerade eben noch, was ich Ihnen alles sagen wollte, Herr Michalke. Aber ich habe alles vergessen.«
Da lächelte der große Mann, zum ersten Mal, seit er hier war. Er nahm die kleine Hand Danielas vorsichtig in die seine, als fürchte er, sie zu zerbrechen.
»Mir ist es auch lieber, wenn Sie gar nichts sagen. Dank macht mich immer so verlegen. Und dann – was habe ich denn schon groß getan? Ich habe Ihren Jungen aus dem Wasser gezogen, das war auch schon alles. Ich hätte gern mehr für ihn getan – aber ich wußte nicht, was ich tun sollte. Ich war heilfroh, als der Notarztwagen kam.«
»Trotzdem«, beharrte Daniela, die unter seinem Blick immer sicherer wurde. »Ich möchte Ihnen danken. Nicht, weil man das vielleicht von mir erwarten könnte, sondern einzig und allein deswegen, weil es mir ein Bedürfnis ist. Ich wollte, ich könnte Ihnen sagen, was ich empfinde.«
»Ich glaube, das müssen Sie mir nicht sagen, Frau Redlich. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Es ist Ihnen wahrscheinlich, als sei der kleine Florian Ihnen noch einmal geschenkt worden, nicht wahr?«
»Woher wissen Sie das so genau?« fragte Daniela verblüfft und sah erschreckt in sein plötzlich, wieder so traurig und in seiner Trauer einsam wirkendes Gesicht.
»Ich sagte doch eben – ich habe meinen Sohn nur tot gesehen, weil er tot zur Welt kam. Und er hat auch meine Frau gleich mit sich genommen. Davon kann sich ein Mann, der so glücklich war, so schnell nicht mehr erholen.«
»Mein Mann ist auch tot«, sagte Daniela, nur um etwas zu sagen. Sie fühlte sich diesem großen, starken Mann gegenüber unsicher und verlegen, fast schuldig, weil ihr Sohn lebte, während man seinem nicht hatte helfen können.
»Kann ich etwas für Sie tun?« fragte sie endlich und deutete auf die Wolldecke. »Ich könnte in Ihre Wohnung fahren und Ihnen etwas holen.«
»Würden Sie das wirklich tun? Ich gebe ehrlich zu, daß ich mich unter dieser Wolldecke nicht gerade sehr wohlfühle.«
Daniela lächelte ihn an. Es war ganz leicht, diesem Mann ein Lächeln zu schenken, fand sie.
»Geben Sie mir Ihren Wohnungsschlüssel, sagen Sie mir, wo Sie wohnen und wo ich die Sachen, die Sie brauchen, finden kann. Dann fahre ich sofort, wenn ich meinen Sohn habe sehen dürfen, dorthin.«
Eine große Männerhand, aber gut geschnitten und nicht etwa ungeschlacht wirkend, kam unter der Wolldecke hervor. In ihr lag ein kleiner Sicherheitsschlüssel. Peter Michalke sah Daniela dankbar an. Dann beschrieb er ihr genau, wo sein Haus stand, in welches Zimmer sie gehen mußte und in welchem Schrank sie seine Sachen finden würde.
»Gut«, sagte sie und straffte sich unwillkürlich. Dann nickte sie auf ihn hinab und sagte entschlossen: »Ich sehe jetzt erst nach Florian. Und dann fahre ich sofort zu Ihrem Haus. In spätestens einer Stunde haben Sie alles hier, was Sie benötigen.«
»Ach, ich werde morgen wieder nach Hause können. Ich fühle mich eigentlich jetzt schon dazu in der Lage – aber Dr. Martens meint, es sei besser, wenn ich eine Nacht hierbleibe.«
»Das finde ich sehr vernünftig«, sagte Daniela und wandte sich zur Tür. Dort blieb sie noch einmal stehen und versicherte: »Also, in einer Stunde, Herr Michalke.«
Sie ging ganz schnell hinaus, denn sie war sehr verlegen. Wie leicht es ihr gefallen war, sich anzubieten! Hoffentlich glaubte er nicht, daß sie mit ihrem Angebot noch etwas anderes verbinden wollte.
Hanna Martens begleitete sie zum Aufzug, begleitete sie zur Station. Dort stellte sie ihr Schwester Dorte vor, die heute Stationsdienst machte. Schwester Dorte nannte ihnen die Zimmernummer, und dann gingen sie zu Florian.
Er lag noch allein in einem Zimmer. Man hatte ihn an einen Tropf gehängt, weil man damit die Reaktion unterstützen wollte, auch das letzte Wasser, das eventuell noch in den Bronchien verblieben war, auszuschwemmen.
Florian war bei Bewußtsein und sah seine Mutter schuldbewußt an, als sie sich über ihn neigte.
»Mami«, sagte er schwach, »es ging nicht anders. Sie haben mich Feigling genannt. Das konnte ich doch nicht auf mir sitzen lassen, nicht wahr?«
»Ich weiß nicht – ich glaube, andersherum wäre es besser gewesen, in jedem Fall. Ein Feigling ist man ganz bestimmt nicht, wenn man auf das hört, was einem die eigene Mutter dringend ans Herz gelegt hat, Florian. Aber ich will dir keinen Vorwurf machen. Wahrscheinlich verstehst du das alles erst, wenn du selbst einmal Kinder hast. Ich bin glücklich, daß ich dich habe behalten können.«
»Ich bin auch froh darüber, Mami«, sagte er leise. »Ich – ich möchte noch nicht sterben.«
»Das wirst du auch nicht, mein Freund«, sagte Hanna freundlich. »In einer Woche kannst du spätestens wieder heim. Bis dahin wird auch das Eis auf dem Baggersee dick genug sein, daß er für euch freigegeben wird.«
»Ach, ich glaube, so große Lust, dort eine Schlittenbahn anzulegen, habe ich gar nicht mehr«, gab Florian ehrlich zu. Daniela strich ihm liebevoll über das Haar.
»Ich habe Herrn Michalke versprochen, ein paar Sachen für ihn von daheim zu holen. Er ist der Mann, der dich aus dem Wasser geholt hat. Er soll eine Nacht hierbleiben, und seine Sachen sind alle naß.«
»Es war toll von ihm, daß er mir nachgesprungen ist, Mami, nicht?« sagte Florian, dem beinahe die Augen zufielen, so müde war er plötzlich. Daniela strich ihm zärtlich über die Wangen, die wieder eine gesunde Farbe angenommen hatten.
»Ja, Liebling, es war toll von ihm. Nun schlaf dich erst einmal gründlich aus.« Sie beugte sich über ihn und küßte ihn, aber das spürte der Junge schon nicht mehr. Er schlief tief und fest. Man konnte ihm sogar ansehen, daß ihn so schnell nichts würde aufwecken können.
Kinder können unendlich viel im Schlaf verarbeiten, dachte Daniela, als sie leise mit Hanna das Zimmer verließ.
Auf dem Flur erklärte Hanna ihr freundlich: »Morgen früh können wir ihn vom Tropf lassen. Dann legen wir ihn in ein Zimmer mit anderen Kindern. Er hat dann Gesellschaft, was gerade für Kinder sehr wichtig ist.«
»Das wird ihm sicher gefallen«, sagte Daniela leise und lächelte. Aber dann raffte sie sich auf. »Ich fahre jetzt am besten gleich los, damit Herr Michalke nicht so lange auf seine Sachen warten muß.«
Hanna nickte und sah ihr nach, wie sie mit federnden Schritten davonging. Sie machte den Eindruck eines Menschen, der wieder in sich gefestigt war und mit dem Leben fertigwerden konnte.
*
Überrascht hielt Daniela Redlich ihren Golf vor dem Haus an, in dem Peter Michalke wohnte. Es war ein geräumiges Haus, dem man ansah, daß es eigentlich für eine komplette Familie sein sollte, nicht nur für einen einzelnen Mann.
Daniela kam sich beinahe wie ein Eindringling vor, als sie den Schlüssel ins Schloß schob und öffnete. Gleich darauf stand sie in einer geräumigen Diele. Der Boden bestand aus hellgelben Steinen, auf denen ein Bauernteppich lag. Eine große Tür mit gelbbraunen kleinen Glasscheiben führte in ein großes Wohnzimmer mit einer wuchtigen Couchgarnitur aus schwarzem Leder. Der Tisch war groß und mächtig mit seiner dunklen Marmorplatte. Bunte, gestickte Kissen lagen auf Couch und Sesseln, ein paar Gobelinbilder hingen an den Wänden.
Eilig, als habe sie sich auf verbotenes Gelände gewagt, schloß Daniela die Tür wieder und stieg die geschwungene Holztreppe hinauf, in den oberen Stock. Sie fand das Schlafzimmer auf Anhieb und holte aus dem großen Kleiderschrank einen Pyjama, Unterwäsche und einen Anzug. Sie fand noch einen grauen Pullover, von dem Michalke gesprochen hatte, und auch den Bademantel, der innen an der Tür zum Bad hing, das man vom Schlafzimmer aus gleich erreichen konnte. Dann tat sie Rasierapparat und Toilettenartikel in eine Tasche und ging wieder nach unten zurück. Sorgfältig verschloß sie das Haus wieder und setzte sich in ihren Golf. Während sie zur Klinik zurückfuhr, dachte sie: Welch ein hübsches Haus! Wenn Julian noch lebte, hätten wir auch ein so hübsches Haus. So aber leben wir in einer Mietwohnung. Und wir haben uns bisher auch sehr wohl dort gefühlt. Wir werden uns dort auch weiterhin wohl fühlen, wenn wir nur zusammenbleiben können.
Sie hatte es plötzlich sehr eilig, das Haus zu verlassen. Sorgfältig schloß sie ab und ging auf ihren Wagen zu, stieg ein und fuhr schnell davon. Fast hatte sie das Gefühl, als befinde sie sich auf der Flucht.
Es nutzte nichts, daß sie sich sagte, es sei Unsinn, so etwas zu denken, aber das Gefühl blieb und ließ sich nicht vertreiben.
Daniela war fast erleichtert, als sie die Klinik Birkenhain wieder erreicht hatte. Sie würde die Tasche mit den Sachen bei Peter Michalke abliefern und dann wieder zu Florian gehen.
Aber als sie dann vor dem großen Mann stand, der auf dem Bett im Einzelzimmer saß, zog sie sich wie selbstverständlich den Stuhl zurecht, ließ sich darauf nieder und fragte freundlich: »Kann ich noch irgendetwas für Sie tun, Herr Michalke?«
»Oh, ich bin Ihnen sehr dankbar, daß Sie mir diese Sachen geholt haben und…«
»Es ist ein wunderschönes Haus«, sagte Daniela da leise und sah vor sich hin. »Sie haben es sehr schön eingerichtet. Ich – ich war neugierig und habe einen Blick ins Wohnzimmer geworfen«, fügte sie mit verlegenem Lächeln hinzu. »Ganz offensichtlich haben Sie jemanden, der Ihnen alles in Ordnung hält, nicht wahr?« fragte sie dann und war sofort noch verlegener, weil sie fand, daß sie das nichts anging. Was kümmerte es sie, wer bei ihm saubermachte und…
»Nein«, gab Peter Michalke in seiner ruhigen, besonnenen Art zurück. »Nein, ich habe niemanden. Bisher habe ich auch nie daran gedacht, daß ich mir jemanden zum Saubermachen nehmen sollte. Es macht mir Freude, alles allein zu tun.«
Zuerst warf sie ihm einen erstaunten Blick zu, aber dann sagte sie mit feinem Lächeln: »Ich glaube, das kann ich gut verstehen. Wäre ich an Ihrer Stelle, würde ich auch niemanden haben wollen, der in meiner Abwesenheit in meinem Haus alles macht, was gemacht werden muß. Aber es ist dennoch ungewöhnlich für einen Mann, finde ich, daß er ganz allein mit allem zurechtkommt.«
»Ach, in diesen Dingen war ich eigentlich immer schon sehr geschickt. Meine Frau hat sogar ab und zu behauptet, ich sei ein besserer Hausmann, als viele Frauen Hausfrau seien. Das hat mich zuerst geärgert, aber dann habe ich einen gewissen Stolz entwickelt. Und heute kommt mir diese Fähigkeit zugute, verstehen Sie?«
»Ja, ich glaube, daß ich das sogar sehr gut verstehe, Herr Michalke.«
»Viele Leute aus Ögela sagen, ich sei ein Sonderling. Sie verstehen nicht, daß ich mich nicht wieder nach einer Frau umsehe.«
»Darauf sollten Sie nichts geben. Es kommt nicht darauf an, was die Leute sagen, Herr Michalke – es kommt einzig und allein darauf an, daß Sie sich wohl fühlen. Schließlich ist es Ihr Leben, und niemand hat das Recht, Ihnen vorzuschreiben, wie Sie es verbringen oder nicht.«
»Ich bleibe nur bis morgen früh in der Klinik«, sagte er plötzlich und sah sie voll an.
Daniela stellte fest, daß er graue Augen hatte. Wache, gute, kluge graue Augen, fand sie. Er hatte gute Augen, vor denen man sich nicht zu fürchten brauchte.
»Ich bin froh, daß Sie sich nichts zugezogen haben, als Sie Florian aus dem eisigen Wasser holten, Herr Michalke.«
»Ach, Unsinn. Das meine ich nicht. Ich meine, es ist gut, daß ich nur diese eine Nacht hierbleiben muß. Ich mag nicht krank sein. Und vor einem Krankenhaus habe ich regelrecht Angst. Außerdem ist dies doch auch eine Kinderklinik.«
»Oh, glauben Sie nicht, daß man in einer Kinderklinik auch Erwachsene behandeln kann, wenn es notwendig ist?« fragte Daniela lächelnd. Er gab dieses Lächeln zurück, und voller Staunen stellte sie fest, daß sein Gesicht viel jünger wirkte, viel unbeschwerter. Wenn er lächelte, verlor sein Gesicht den verschlossenen, einsamen Ausdruck, der andere Menschen davon zurückhielt, sich näher mit ihm zu beschäftigen. Sie sah in fasziniert an.
»Sicher kann man das, aber ich finde, sie müssen es nicht ausgerechnet an mir beweisen.«
»Es handelt sich doch nur um eine Nacht«, tröstete Daniela ihn. Er nickte ihr zu und nahm den Bademantel und den Pyjama, den sie eingepackt hatte, aus der großen Reisetasche, die sie in seinem Schlafzimmer hinter dem Schrank gefunden hatte.
»Bitte, gehen Sie noch nicht, wenn ich mich jetzt auskleide, ja?« bat er sie und ging auf den Vorhang zu, hinter dem das Waschbecken lag. »Ich möchte gern noch ein wenig in Ihrer Gesellschaft sein. Aber ich möchte auch ebenso gern meine eigenen Sachen anziehen und…«
»Gut«, stimmte sie zu, als er verlegen verstummte. »Ich bleibe noch ein wenig. Schließlich habe ich Zeit genug, Florian schläft, nehme ich an. Und ich arbeite nur vormittags.«
»Es tut mir leid, daß Sie mit dem Jungen allein sind, Frau Redlich. Ein Kind braucht einen Vater, und eine Frau braucht einen Mann, der ihr zur Seite steht und ihr das Gefühl gibt, nicht allein zu sein.«
»Wieso kommen ausgerechnet Sie zu dieser Erkenntnis?« wollte sie wissen. »Sie leben doch auch allein.«
»Ja, und zwar im wahrsten Sinn des Wortes«, gab er ruhig zu. »Aber ich bin wirklich allein und habe niemanden mehr, für den ich mich verantwortlich fühlen muß. Glauben Sie mir – das kann einem auch ganz schön Kummer einbringen.«
»Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen«, gab sie zu. »Ich bin ganz gern mal allein. Aber Alleinsein und Einsamkeit sind zwei sehr verschiedene Begriffe, finden Sie nicht?«
Er schob den Vorhang zur Seite und kam zurück. In seinem dunkelblauen Bademantel setzte er sich auf das Bett und sah sie ernsthaft an. Dann sagte er langsam, so, als müsse er sich jedes Wort überlegen: »O ja, Einsamkeit kann sogar tödlich sein, finde ich. Man kann sich an sie gewöhnen, aber man mag sie eigentlich gar nicht.«
»Und was ist, wenn man sich selbst hineinmanövriert hat?« fragte sie leise, aber sehr eindringlich.
»Dann ist es um so schlimmer, denn man findet überhaupt keine Stelle, an der man beginnen könnte, der Einsamkeit zu entfliehen.«
Sie sah ihn nachdenklich an und fragte dann behutsam: »Wollen Sie denn das? Ich meine, haben Sie es schon einmal ernsthaft versucht?«
Peter Michalke überlegte und schüttelte dann den Kopf.
»Nein«, sagte er, »nein, ich glaube nicht. Ich habe mich damals, als Carola bei der Geburt unseres ersten Kindes starb, in mich selbst zurückgezogen. Ich war sogar eifersüchtig auf meinen eigenen Kummer bedacht. Zuerst sagte ich mir, daß ich niemanden damit belasten wollte. Das rechte Verständnis, das einen aufrichten kann, findet man ja doch nicht. Und plötzlich stellt man fest, daß man es verlernt hat, sich jemandem mitzuteilen. Verstehen Sie, was ich damit sagen will?«
»O ja«, erklärte sie lebhaft, »ja, das verstehe ich sogar sehr gut. Mir ist es beinahe ebenso gegangen. Aber ich konnte mich nicht abkapseln, weil Florian doch da war.«
»Mit einem Kind ist es sicher leichter«, stimmte Michalke nachdenklich zu. Daniela sah ihn offen an.
»Das ist wahr«, gab sie zu. »Aber auch als Alleinstehender braucht man ab und zu jemanden, dem man sich mitteilen kann. Sonst wird man auf die Dauer noch ganz krank.«
»Bei meinen Kollegen gelte ich als stark, als jemand, der in sich gefestigt ist und niemanden braucht.«
»Ihre Kollegen müssen Sie nicht unbedingt genau kennen, Herr Michalke«, wandte sie sanft ein. »Es kommt auf Sie selbst an, darauf, wie weit Sie den Menschen entgegenkommen.«
»Ach, ich fürchte, genau das habe ich verlernt«, wehrte er ab und fuhr, als wolle er damit seine Worte unterstreichen, mit der Hand durch die Luft. »Ich kann das nicht mehr.«
»Haben Sie denn wenigstens schon einmal den Versuch gemacht? Ich kann mir nicht vorstellen, daß Sie sich nur für sich selbst interessieren. Wenn das nämlich so wäre, hätten Sie heute meinen Florian nicht aus dem Eiswasser gezogen.«
»Ich glaube kaum, daß man das in die Waagschale werfen kann. Schließlich war da ein Kind, dessen Leben in Gefahr war. Da handelt man rein instinktiv, weil man handeln muß. Es ist der reine Zwang. Und dann wundert man sich, wenn die Leute hinterher behaupten, man sei ein Held. Das ist blanker Unsinn.«
»Nun, was die anderen sagen, weiß ich nicht, Herr Michalke. In meinen Augen jedenfalls sind Sie ein Held. Sie haben mein einziges Kind gerettet. Und nicht nur mein Kind, sondern auch mein Leben. Wenn Florian nämlich nicht mehr gelebt hätte, wäre auch mein Leben zu Ende gewesen.«
»Hätten Sie sich etwas angetan?« wollte er wissen und sah sie aufmerksam an.
»Nein. Nein, ich glaube nicht«, gab sie nachdenklich zu. »Aber ich wäre an gebrochenem Herzen gestorben, denke ich mir. Man sagt zwar, daß das nicht möglich ist – aber das bestreite ich.«
»Ich auch, denn ich kann mir sehr wohl vorstellen, daß man an gebrochenem Herzen sterben kann. Wenigstens innerlich.«
»Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie innerlich an gebrochenem Herzen gestorben?« wollte sie wissen.
Es dauerte lange, bis er etwas erwiderte. Während dieser Pause sah er sie eindringlich an. Dann schüttelte er den Kopf.
»Nein, bin ich nicht. Und wenn ich es wirklich einmal war, dann bin ich wieder aufgewacht.«
Plötzlich lächelte er. Und dieses Lächeln erfüllte Daniela mit einem Glücksgefühl, das sie sich nicht erklären konnte.
Sie erhob sich geschwind, weil sie sich der Angst, die auf einmal in ihr war, nicht stellen mochte. Noch nicht, denn sie war nicht imstande, sie genau zu definieren.
»Sie sollten sich hinlegen, Herr Michalke. Ich werde Ihre Sachen mitnehmen und sie trocknen und in Ordnung bringen. Wenn ich dann morgen komme, Florian zu besuchen, bringe ich Ihnen alles wieder mit.«
»Der Gedanke, daß Sie sich Arbeit mit mir machen, ist mir aber sehr unangenehm.«
Er hatte sich ebenfalls erhoben und sah auf sie hinab. Da lächelte sie zu ihm auf und sagte einfach: »Das wäre auch eine Art, auf einen anderen Menschen zuzugehen, Herr Michalke. Probieren Sie es nur ruhig einmal aus. Dann werden Sie merken, daß es gar nicht so schwer ist, wie Sie jetzt noch denken.«
Sie verschwand hinter dem Vorhang und nahm die nassen Sachen auf, legte sie sich über den Arm und sagte lächelnd: »Es ist so wenig, was ich für Sie tun kann, Herr Michalke. Verderben Sie mir also nicht die Freude, indem Sie mich daran zu hindern versuchen. Morgen bin ich wieder hier. Dann fahre ich Sie nach Hause. Bis dahin sage ich Ihnen gute Nacht.«
Ehe er noch etwas sagen konnte, war sie schon verschwunden. Nachdenklich sah er auf die Tür, die sie leise geschlossen hatte. Er zog den Bademantel aus und legte ihn auf den Stuhl, auf dem Daniela gerade eben noch gesessen hatte. Dann legte er sich in das Bett, verschränkte die Arme unter dem Kopf und sah gegen die Zimmerdecke.
Nein, mußte er vor sich selbst zugeben, nein, es war gar nicht unangenehm, zu wissen, daß sich jemand um einen kümmerte.
Nur – er wollte sich lieber erst gar nicht daran gewöhnen, denn er konnte sich sehr gut vorstellen, daß die Einsamkeit später, wenn die Verbindung abgebrochen war, noch furchtbarer für ihn sein würde.
Und abbrechen würde die Verbindung auf jeden Fall eines Tages. Es gab keinen einzigen vernünftigen Grund, sie aufrechtzuerhalten.
Peter schloß krampfhaft die Augen. Aber Gedanken sind nicht abhängig von Licht oder Dunkelheit. Sie lassen sich durch kaum etwas unterdrücken.
*
Daniela hatte fast ein schlechtes Gewissen, als sie am nächsten Morgen zugeben mußte, daß sie ausgezeichnet geschlafen hatte. Sie wachte zur gewohnten Zeit auf und zuckte zusammen, als das Telefon schrillte.
Es konnte nur etwas Schlimmes sein. Vielleicht ging es Florian schlechter. Vielleicht wollte man sie auffordern, sofort zur Klinik zu kommen und…
Mit einer fast hektischen Bewegung griff sie nach dem Hörer. Ihre Stimme klang heiser, als sie sich meldete, und sie mußte sich erst einmal räuspern, als sie erkannte, daß es sich um den Bürgermeister handelte, der ihr vorschlug: »Wenn Sie wollen, Frau Redlich, haben Sie Urlaub. Ich könnte mir vorstellen, daß Sie am liebsten den ganzen Tag in der Klinik verbringen würden.«
»Oh, das ist sehr nett von Ihnen. Aber ich muß noch…«
»Es gibt nichts, was Sie nicht auch später noch erledigen können, Frau Redlich. Warum also nehmen Sie nicht einfach eine Woche Urlaub und kümmern sich um Ihren Buben?«
»Danke«, sagte Daniela einfach. »Danke, ich nehme das Angebot sehr gern an.«
»Wenn Sie nachher hinüberfahren in die Klinik, grüßen Sie Florian von mir und sagen Sie ihm, daß er der Erste ist, der erfährt, wenn der Baggersee freigegeben werden kann.«
»Oh, das wird ihn aber sehr stolz machen.« Daniela lachte leise. Es tat so gut, wenn die Menschen bewiesen, daß sie Verständnis hatten.
Eine halbe Stunde später hatte sie alles zusammengepackt, was Florian wohl benötigen konnte. Sein neues Buch mit Heldensagen, das er noch nicht ganz gelesen hatte, Wäsche und ein Puzzle, das sie eigentlich schon hatte für Weihnachten zurücklegen wollen. Sie würde es ihm halt jetzt schon bringen, damit ihm die Zeit, die er noch in der Klinik bleiben mußte, nicht zu lang wurde.
Sie hatte auch Peter Michalkes Tasche gepackt. Sein Anzug war trocken und sorgfältig gebügelt. Wer wusch und bügelte eigentlich sonst für ihn, wenn er niemanden an sich heranließ? fragte sie sich. Wahrscheinlich tat er auch das selbst. Schließlich hatte sie ja erst gestern noch hinreichend Gelegenheit gehabt, festzustellen, daß er die perfekteste Hausfrau war, die man sich nur vorstellen konnte. Es würde sie also gar nicht wundern zu hören, daß er auch für sich selbst wusch und bügelte.
Sie fühlte sich irgendwie erwartungsvoll, als sie in ihren Golf stieg, um zur Klinik zu fahren. Es war ein Gefühl, das sie besonders beschwingt sein ließ, das sie sich aber immer weniger erklären konnte. Es war beinahe so, als erwache sie zu neuem Leben.
Es war nicht zu erklären, aber es machte sie auf eine sonderbare Weise glücklich.
Sie fuhr zur Station und ging zuerst zu Peter Michalke. Sie wollte seine Sachen abgeben und ihn bitten, sie zu Florian zu begleiten, damit dieser sich bei seinem Lebensretter bedanken konnte.
Michalke war frisch rasiert und offensichtlich geduscht, denn sein dunkles Haar war noch dunkler und feucht. Der Duft von einem herben Rasierwasser umgab ihn.
Daniela war plötzlich verlegen, als sie vor ihm stand und ihn anschaute. Sie hielt ihm die Tasche hin und sagte unsicher: »Sie werden vielleicht gar nicht zufrieden sein, Herr Michalke, aber ich habe mir große Mühe gegeben.«
Er nahm ihr die Tasche ab und öffnete sie, zog den frischgebügelten Anzug hervor und sagte begeistert: »Besser hätte es eine chemische Reinigung auch nicht machen können.«
»Wirklich? Meinen Sie das wirklich im Ernst?« fragte sie erleichtert und wartete seine Antwort gar, nicht erst ab, weil sie wissen wollte: »Werden Sie denn nun heute entlassen oder nicht?«
»O ja. Frau Dr. Martens ist schon sehr früh bei mir gewesen und hat mich untersucht. Alles in Ordnung. Es gibt nichts, was mich hier noch als Patienten festhalten könnte.«
»Ich freue mich für Sie. Mein Angebot, das ich Ihnen gestern machte, gilt noch. Ich fahre Sie heim.«
»Und ich koche für Sie. Das ist meine Bedingung«, sagte er ernsthaft. Plötzlich lächelten sie einander an. Es war schön, sich zu verstehen, aber es war noch viel zu früh, ein einziges Wort darüber zu verlieren.
»Oh, diese Bedingung akzeptiere ich sehr gern«, sagte Daniela eilig, während Peter hinter dem Vorhang verschwand, um sich anzukleiden. Schon nach wenigen Minuten war er fertig, und Daniela fand, als er wieder vor ihr stand, daß er noch besser aussah, als sie ihn sich vorgestellt hatte.
»Wollen wir jetzt zu Florian gehen?« erinnerte er sie sanft, als sie stumm blieb. Mechanisch nickte sie und setzte sich in Bewegung. Peter hatte schon alles in seiner Tasche verstaut und konnte das Zimmer in dem Bewußtsein verlassen, es nicht wieder betreten zu müssen.
Schwester Dorte lachte ihnen fröhlich zu.
»Er hat die ganze Nacht durchgeschlafen, Frau Redlich. Sicher wird es nur ein paar Tage dauern, bis Sie Florian wieder mit heimnehmen können. Er ist jetzt schon recht ungeduldig.«
»Oh, das kann man doch sicher als gutes Zeichen werten, nicht wahr?« gab Daniela erleichtert zurück und drückte schon die Klinke zu Florians Zimmer hinab.
Kein Tropf mehr, erkannte Daniela erleichtert und ging schnell auf das Bett zu, zog Florian in die Arme und küßte ihn endlich auf beide Wangen.
»Ich habe schon von Schwester Dorte gehört, daß es dir gutgeht, Florian.«
»Könntest du nicht ein Wort mit Dr. Hanna sprechen, Mami? Ich finde, sie könnte mich ruhig schon heute mit dir heimfahren lassen. Ich möchte nicht hier herumliegen. Das ist so schrecklich langweilig.«
»Ich habe dir dein Buch mitgebracht und ein neues Puzzlespiel, mit dem du dir sicher die Zeit sehr schnell vertreiben kannst«, tröstete Daniela und wies dann auf Peter Michalke, der an der Tür stehengeblieben war und Florian nur ernsthaft anschaute, als wollte er ergründen, ob er diesen kleinen Jungen mochte oder nicht.
»Das ist übrigens Herr Michalke, der dich aus dem Wasser gezogen hat«, sagte Daniela und zog Peter tiefer ins Zimmer hinein. Schweigend streckte Michalke seine große Hand aus und umschloß die Bubenhand.
»Danke«, sagte Florian mit belegter Stimme. »Wenn Sie nicht gewesen wären, hätte Mami mir jetzt kein neues Puzzle mehr kaufen können, nicht wahr?«
»Ich habe einen ganz schönen Schrecken bekommen, als ich dich herausgezogen hatte. Aber anscheinend hat der Doktor doch recht, der behauptete, es sei nur gut für dich gewesen, daß du so stark unterkühlt warst. Aber wieso du aufs Eis hinausgelaufen bist, ist mir immer noch nicht klar. Du hast doch bestimmt gewußt, daß es noch viel zu dünn war, oder?« Florian sah schuldbewußt aus, als er erwiderte: »Ach, es war alles ziemlich blöd. Jedenfalls kommt es mir heute so vor. Ich habe mich wahrscheinlich auch recht dumm benommen.«
»Man sollte erst die Erklärung anhören, bevor man sich ein endgültiges Urteil bildet. Erzähl mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist.«
»Wissen Sie, ich finde es prima, daß Sie nicht gleich schimpfen und mit Vorwürfen um sich werfen. Sie sind genau wie Mami. Die fragt mich auch immer erst nach den Gründen. Und dann kann man alles mit ihr besprechen.«
Peter warf Daniela einen amüsierten Seitenblick zu. Dann nickte er Florian auffordernd zu und meinte ruhig: »Na, dann mal los. Es gibt nichts im Leben, über das man nicht reden könnte, finde ich.«
Und so erzählte Florian endlich, wieso es zu dem schrecklichen Unglück hatte kommen können. Er berichtete nur einfach, blieb strikt bei der Wahrheit und sagte endlich: »So, jetzt wißt Ihr es. Ihr könnt mir ruhig sagen, daß ich mich blöd benommen habe.«
»Nun, das nicht gerade. Aber besonders klug hast du dich auch nicht benommen, finde ich.« Peter Michalke sah Daniela fragend an. Auch Daniela schüttelte den Kopf.
»Ich bin der gleichen Ansicht. Aber reden Sie nur weiter, ich habe das Gefühl, daß Florian Ihnen vertraut und dankbar ist, wenn er mal ein richtiges Männergespräch führen kann. Ich bin zwar seine Vertraute – aber ich könnte mir vorstellen, daß es Sachen gibt, die sich mit einem Mann viel besser bereden lassen als mit einer Frau.«
Für diese Worte erntete sie einen begeisterten Blick ihres Sohnes. Und dann sprach Florian es auch schon aus: »Mami ist doch einsame Spitze, nicht? Sie weiß immer schon im voraus, was mit mir los ist. Manchmal finde ich das richtig unheimlich.«
»Brauchst du aber nicht.« Michalke lachte Florian freundlich an. »Das kann ich dir nämlich ganz genau erklären, mein Lieber. Deine Mami liebt dich. Wahrscheinlich liebt sie dich mehr als alles andere auf der Welt. Und das schafft eine unbeschreibliche innere Verbundenheit, verstehst du? Deshalb allein ist sie imstande, sich in dich hineinzuversetzen und schon im Voraus zu ahnen, wie du auf dieses oder jenes reagierst.«
»Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht«, gab Florian ehrlich zu.
»Das brauchst du auch nicht. Eines Tages weißt du es von ganz allein«, tröstete Peter Michalke freundlich und nahm das Thema wieder auf. »Paß auf, du hast dich nicht klug benommen, weil du gegen dein besseres Wissen versuchen wolltest, den anderen zu zeigen, daß du kein Feigling bist. In gewisser Beziehung hast du aber gezeigt, daß du einer bist.«
»Das ist ja wohl kaum Ihr Ernst«, sagte Florian und sah ganz empört aus. Und auch Danielas Gesichtsausdruck zeigte, daß sie unsicher geworden war. Aber noch mischte sie sich nicht ein. Sie wollte, daß Michalke und Florian allein miteinander klar kamen. Sie würde sich erst dann einmischen, wenn sie einsehen mußte, daß sie einander nicht verstanden. Aber sie hatte das Gefühl, als genügte es, wenn sie nur schweigend beobachtete. Sie war ganz sicher, daß Peter Michalke schon bald das ungeteilte Vertrauen ihres Florian besitzen würde. Und noch wußte sie nicht, ob sie sich darüber freuen oder eifersüchtig deswegen sein würde. Bisher hatte Florian ihr allein gehört. Aber irgendwann würde sie zusehen müssen, daß er sich auch anderen Menschen öffnete. Und – merkwürdigerweise erschien ihr da Peter Michalke am geeignetsten zu sein.
»Paß auf, Florian, ich will versuchen, es dir zu erklären. Ich bin keiner, der viele Worte machen kann. Ich glaube, das habe ich auch in den letzten drei Jahren ziemlich verlernt. Aber sicher werden wir uns prima miteinander verständigen können. Also – du wolltest den anderen gegenüber nicht als Feigling dastehen, obwohl du innerlich davon überzeugt gewesen bist, daß dich die dünne Eisdecke auf dem Baggersee nicht tragen würde, stimmt’s?«
»Genauso ist es«, gab Florian zu und sah Peter unverwandt an. Man merkte dem Jungen deutlich an, wie gespannt er darauf war, was der große starke Mann ihm da erklären würde. Und Daniela gab vor sich selbst auch offen zu, daß es ihr mindestens ebenso erging wie ihrem kleinen Sohn.
»So, und da beginnt die Dummheit, mein Sohn. Wenn ich etwas genau weiß, dann stelle ich mich darauf ein. Du wußtest, daß du ins Eis einbrechen mußtest, unweigerlich. Und wahrscheinlich wußten das die anderen auch. Und dennoch verlangte dieser Berthold Wieland eine Mutprobe. Ziemlich dämlich, findest du nicht auch?«
»Ich weiß nicht.« Florian zögerte sichtlich mit der Antwort. »Berthold ist der Anführer unserer Clique, müssen Sie wissen. Und bisher hat jeder noch widerstandslos das getan, was er gesagt hat.«
»Na, und genau da beginnt eure Dummheit. Ich, wäre ich an deiner Stelle gewesen, hätte Berthold Wieland aufgefordert, seinen eigenen Mut zu beweisen, indem er selbst aufs Eis ging, obwohl feststand, daß er einbrechen würde. Ich bin ganz sicher, daß er das nie beabsichtigte. Richtige Feiglinge, mein Lieber, die schicken immer andere vor. Sie tun nie etwas selbst, was richtigen Mut von ihnen verlangt.«
»Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht«, mußte Florian zugeben. »Aber ich glaube, daß Sie recht haben. Es hat mir nur niemals jemand die Sache so erklären können.«
»Und doch liegt der Fall ganz klar. Hättest du Berthold Wieland gesagt, er soll, besonders weil er euer Anführer ist, erst einmal seinen eigenen Mut beweisen, hätte er sich zurückgezogen, Ausflüchte gemacht und wäre wahrscheinlich nicht mehr länger in euren Augen mutig gewesen, was?«
»Ich glaube kaum. Nein, ich glaube das nicht nur – ich weiß es sogar auch ganz genau. Nein, wir hätten bestimmt gemerkt, daß er nur große Sprüche klopft und nichts weiter dahinter ist.« Florian seufzte auf. »Menschenskind, das ist wirklich klasse. Von der Seite aus habe ich das noch gar nicht gesehen. Und ich wette, die anderen auch nicht.«
»Siehst du – es lohnt sich also immer, über alles nachzudenken, ehe man handelt. Und wenn ein Junge wie Berthold Wieland einen so dummen Einfall hat, dann sollte er ihn auch selbst in die Tat umsetzen. Ich wette mit dir um alles mögliche, daß dieser Unfall, den du erlitten hast, dann nicht stattgefunden hätte.«
Florian sah ihn lange nachdenklich an, ehe er zugab: »Da ist was Wahres dran. Ich glaube, Sie haben in allen Punkten recht. Ich bin wirklich ein ausgemachter Dummkopf.«
»Ach, so hart solltest du auch nicht urteilen. Ich wollte dich nur zum Nachdenken anregen. Wenn mir das gelungen ist, ist schon viel erreicht, meine ich.«
Der Junge streckte dem starken großen Mann spontan die etwas rauhe Hand entgegen und sagte, während er ihn anstrahlte: »Ich bin froh, daß Sie mit mir gesprochen haben. Und Mami sicher auch, nicht, Mami?«
»Ganz bestimmt«, bestätigte Daniela schnell. »Ich gebe aber auch offen zu, daß ich nie so überzeugende Worte gefunden hätte wie Herr Michalke.«
»Das kann dir keiner übelnehmen, Mami, du bist eine Frau. Herr Michalke ist ein Mann, und Männer denken eben manchmal über gewisse Dinge anders als Frauen.«
Daniela warf ihrem Jungen zuerst einen verblüfften Blick zu. Und dann, als sie in die warnenden Augen Michalkes sah, lächelte sie herzlich und sagte friedfertig: »Also schön, ich gebe mich geschlagen. Übrigens wird Herr Michalke heute entlassen. Ich fahre ihn nachher heim, Florian.«
Ehe Peter noch etwas dazu sagen konnte, erklärte Florian schnell: »Das finde ich prima. Und schade finde ich es eigentlich auch. Ich hätte mich nämlich gern öfter mit Ihnen unterhalten.«
»Oh, das kannst du auch. Ich werde dich einfach, solange du noch hierbleiben mußt, besuchen. Und wenn du entlassen worden bist, können wir uns auch miteinander verabreden.«
»Jetzt sagen Sie nur noch, daß Sie Zeit für mich haben werden.«
»Ganz genau, das wollte ich dir sagen, mein Freund. Betrachte mich als deinen Freund, wenn ich auch eine ganze Ecke älter bin als du. Aber das macht nichts. Manchmal ist es gut für einen Jungen, wenn er einen älteren Freund hat, dem er vertrauen kann.«
»Das finde ich ganz prima von Ihnen. Du nicht auch, Mami?« Florian sah zu Daniela, die Peter Michalke einen unsicheren Blick zuwarf.
»Ich würde die Unwahrheit sagen, wenn ich es nicht zugeben würde. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, daß Herr Michalke das Gefühl hat, von uns vereinnahmt zu werden. Wenn sich jemand wie eine Klette an einen anderen hängt, kann er sehr leicht lästig werden, weißt du? Und lästig wollen wir Herrn Michalke doch auf gar keinen Fall sein, gelt?«
Aber da lachte Peter Michalke. Es war ein tiefes, von Herzen kommendes Lachen.
»Die Leute sagen, daß ich ein Sonderling bin, weil ich mich zurückziehe und mich am wohlsten in meinem Haus fühle. Das stimmt aber alles gar nicht. Jedenfalls nicht so, wie es die Leute darstellen wollen. Ich lebe in meinem Haus ganz allein, weil meine Frau und mein kleiner Sohn gestorben sind. Für sie habe ich das Haus gebaut. Ich habe über ein Jahr dafür gebraucht und das meiste selbst gemacht. So habe ich viel einsparen und manches schöner und aufwendiger bauen können, als ich eigentlich vorgehabt hatte. Dann gibt es noch einen großen Garten. Da ist viel Platz, daß man einen richtigen Spielplatz anlegen kann. Und einen Teich habe ich auch. Keinen Springbrunnen, wenn du das meinst, sondern einen richtigen kleinen Weiher, in dem Frösche quaken im Frühjahr, in dessen Ufergräsern es sogar noch ein Rohrdommelpärchen gibt. Im Sommer kommen manchmal Eisvögel. Und es gibt viele, viele Libellen dort, deren Flügel in der Sonne in allen Regenbogenfarben schimmern.«
»Das hört sich prima an«, sagte Florian, der Peter Michalke jedes Wort von den Lippen gelesen hatte.
»Das hört sich nicht nur so an. Du mußt mich unbedingt mit deiner Mami besuchen kommen, wenn du aus der Klinik nach Hause darfst.«
»Ehrlich? Meinen Sie das wirklich und wahrhaftig ehrlich? Ich meine, daß Mami und ich kommen können? Ist ja wohl klar, daß ich mit Begeisterung ja sage, nicht, Mami?«
»Sicher können wir Herrn Michalke einmal besuchen, Florian, aber das soll nicht bedeuten, daß wir ihm oft zur Last fallen werden. Es hat schließlich alles seine Grenzen, verstehst du?«
»Aber wenn Herr Michalke unser Freund ist, ist das doch ganz anders, Mami. Sonst wären es doch keine Freunde, oder?« Er sah unsicher von einem zum anderen. Da beugte sich Peter Michalke zu ihm und erwiderte laut genug, so daß es auch Daniela hören konnte: »Da muß ich dir allerdings völlig recht geben, mein Kleiner. Ich würde mich freuen, wenn du und deine Mami mich so oft wie möglich besuchen würdet.«
Daniela errötete. Als Frau spürte sie genau, daß diese Worte eigentlich nur ihr gegolten hatten.
Sie blieben noch ein wenig bei Florian, aber dann sagte Daniela: »Sei nicht enttäuscht, Liebling, wenn ich dich jetzt allein lasse, nein? Ich habe Herrn Michalke versprochen, ihn heimzufahren. Er soll nicht den ganzen Weg zu Fuß machen. Und ein Taxi lohnt sich nicht, wenn ich den Wagen bei mir habe.«
Das fand Florian auch. Er war auch nicht böse, denn er hatte schließlich sein Buch und ein neues Puzzle. Und – was am wichtigsten war – er wußte, daß er ebenfalls bald nach Hause durfte, weil er wieder ganz gesund war. So schnell ging das eben heutzutage. Erst war ein Mensch klinisch tot, und dann, dank der modernen Medizin, lief er wieder herum, sprach, atmete, aß, arbeitete, als sei nichts geschehen. Eigentlich war das schon ein bißchen unheimlich, fand Daniela. Und das sprach sie auch aus, als sie und Peter Michalke in ihrem Golf saßen und sie den Motor anließ.
Michalke erwiderte in seiner bedächtigen Art: »Wenn man bedenkt, was die Ärzte heutzutage alles schaffen, kann man verstehen, daß manche Menschen sie Halbgötter in Weiß nennen, nicht wahr?«
»Das ist aber nur abwertend gemeint, und eigentlich mag ich diese Bezeichnung auch gar nicht.«
»Da haben Sie recht. Sie ist nicht zutreffend, wenn auch zu verstehen. Eigentlich ist das auch gar kein Thema für uns, Frau Redlich. Wir sind nur froh, daß Florian noch lebt. Und das ist doch auch am wichtigsten, oder?«
Sie hatten das Haus Michalkes viel zu schnell erreicht. Jedenfalls empfand Daniela es so, wenn sie es auch niemals zugegeben hätte. Höchstens vor sich selbst, und auch dann würde sie sich noch schämen.
Peter Michalke sah sie bittend an.
»Kommen Sie noch mit hinein? Ich könnte uns einen Kaffee kochen. Und dann könnten wir uns noch ein bißchen unterhalten, einverstanden?«
Daniela sah ihn ernsthaft an, zögerte ein wenig. In einem Ort wie Ögela blühte der Klatsch, wie sie wußte. Aber dann warf sie den Kopf in den Nacken und sagte entschlossen: »Warum eigentlich nicht? Ich habe übrigens Kuchen gekauft. Zum Backen blieb mir leider keine Zeit. Ich wollte Ihnen das Kuchenpaket mitgeben, damit Sie Ihre Heimkehr feiern konnten. Aber Sie haben recht – zu zweit feiert es sich viel gemütlicher.«
Er strahlte plötzlich und sah aus wie ein kleiner Junge, dem man einen heimlichen Herzenswunsch erfüllt hat.
»Fast könnte ich Florian beneiden, daß er immer mit Ihnen zusammen sein darf. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, daß Sie eine großartige Frau sind, Frau Redlich?«
»Ja, schon oft.« Sie lachte, um ihre plötzliche Verlegenheit zu verbergen. »Florians Vater. Aber seither niemand mehr. Danke, daß Sie eine so gute Meinung von mir haben, Herr Michalke.«
Er schloß die Haustür auf und ließ sie an sich vorübergehen. Dann stellte er seine Reisetasche in die Diele und nahm Daniela den Mantel ab. Er stieß die Tür mit den gelbbraunen Glasscheiben auf, drehte die Heizung an und meinte treuherzig: »Es dauert nicht lange, bis es warm geworden ist. Ich setze nur schnell die Kaffeemaschine in Gang.«
Aber Daniela dachte gar nicht daran, sich in einen Sessel zu setzen und sich bedienen zu lassen. Sie ging energisch mit in die Küche und sah sich begeistert um.
»Bisher war ich fest davon überzeugt, eine modern eingerichtete Küche zu haben. Aber wenn man die Ihre sieht, kann man vor Neid ganz blaß werden.«
»Ich habe lange gebraucht, bis ich mich entschieden habe, wie ich sie einrichten soll«, gab Peter Michalke, den Danielas Begeisterung ganz offensichtlich freute, zu. »Und dann habe ich alles genau aufgezeichnet, so daß ich auch nichts vergaß. Ich bin, wenn ich ehrlich sein will, ein begeisterter Hobby-Koch. Aber für einen allein macht das keinen rechten Spaß. Nun, ich hoffe sehr, daß das nun anders wird. Florians Zustimmung habe ich schon. Es fehlt nur noch Ihre.«
Da wurde Daniela ganz ernst und sagte leise und zögernd: »Bitte, haben Sie Verständnis – ich kann noch gar nichts versprechen. Das geht mir alles ein bißchen zu schnell, verstehen Sie? Ich brauche Zeit, Herr Michalke. Ich muß mich erst daran gewöhnen, daß es in meinem Leben außer Florian noch jemanden gibt, der mir dazu auch noch freundschaftliche Gefühle entgegenbringt.«
»Nicht nur freundschaftliche«, sagte er bestimmt, während er das Wasser in die Kaffeemaschine füllte, Kaffee in die Filtertüte gab und dann die Maschine anstellte. »Ich glaube, mich hat es erwischt.«
Als er spürte, daß Daniela ein wenig zurückzuckte, sah er sie mit beruhigendem Lächeln an und sagte freundlich: »Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Redlich. Ich werde niemals mehr von Ihnen erwarten oder gar verlangen, als Sie mir freiwillig zu geben bereit sind. Aber Sie sollen wissen, daß ich glücklich über jedes warme und verständnisvolle Wort bin, das Sie mir geben.«
Daniela legt ihm spontan die Hand auf den Arm und sagte mitfühlend: »Sie müssen sehr einsam sein.«
»Ja«, gab er offen zu und sah sie ernsthaft an. »Ja, das bin ich. Sie haben wenigstens noch Ihren kleinen Florian. Ich habe niemanden mehr, obwohl ich so gern eine Familie gehabt hätte. Ich war so glücklich mit Carola. Ich war unbeschreiblich glücklich, als sie mir sagte, daß wir ein Kind erwarteten. Ich war noch glücklich, als ich sie nach Celle in die Klinik brachte. Und dann war mit einem Schlage alles aus. Ich war fest davon überzeugt, daß die Welt stillstehen müsse. Aber das tat sie nicht. Sie drehte sich weiter und ich mich mit ihr.«
»Ich glaube, ich kann Sie sehr gut verstehen. Ich weiß, was Sie meinen.«
Er packte den Kuchen aus, den sie mitgebracht hatte, gab ihn auf einen Kuchenteller, schnitt ihn geschickt in mundgerechte Stücke und sah sie an.
»Das erleichtert mich sehr. Ich glaube, ich würde glücklich sein, wenn Sie und Florian sehr, sehr oft bei mir sein würden.«
»Und die Leute?« fragte sie lächelnd. »Was, glauben Sie, werden die Leute von Ögela sagen, wenn man merkt, daß Florian und ich oft hier sind? Man wird über uns zu reden beginnen.«
»Haben Sie Angst davor?« fragte er schnell und ließ sie nicht aus den Augen. Offen erwiderte sie seinen Blick und schüttelte den Kopf.
»Natürlich nicht. Ich habe vor mir selbst zu bestehen. Und das tue ich allemal.«
»Davon bin ich überzeugt.«
Er sah sie auffordernd an. Gemeinsam gingen sie wieder ins große Wohnzimmer, wo er den wuchtigen Schrank öffnete und hübsches Porzellan hervorholte. Er stellte alles auf den Tisch und sah zufrieden zu, wie Daniela es verteilte. Sie setzte sich und sah lächelnd zu ihm auf. Da ging er in die Küche zurück und holte den Kaffee. Endlich saßen sie sich am Tisch gegenüber. Und endlich sprach er das aus, was sie sich nicht getraute zu sagen: »Man kann ganz unmanierlich glücklich sein, wenn man nicht allein am Tisch zu sitzen braucht, finden Sie nicht?«
»Das glaube ich Ihnen aufs Wort, Herr Michalke. Sie brauchen es nicht immer wieder zu betonen: Florian und ich werden Sie oft besuchen kommen. Aber eines müssen Sie mir versprechen!« fügte sie noch entschlossen hinzu.
»Es kommt ganz darauf an, was ich Ihnen versprechen soll«, gab er bedächtig zurück.
»Sie sollen mir versprechen, es auch zu sagen, wenn Sie den Eindruck haben, daß Florian und ich Ihnen zu oft auf die Nerven gehen. Ich gestehe, daß ich ebenso gern herkommen möchte wie Florian – aber es wäre doch unendlich peinlich, wenn ich merkte, daß ich Ihnen zur Last falle. Das möchte ich auf gar keinen Fall.«
»Ein für allemal – Sie fallen mir nicht zur Last, Frau Redlich, niemals. Und nun wollen wir das Thema endgültig zu den Akten legen, einverstanden?«
»Einverstanden«, stimmte sie zu. Er fand das Lächeln, das plötzlich auf ihrem Gesicht stand, ausgesprochen sympathisch. Und das war, wenn er ehrlich sein wollte, eigentlich noch sehr gelinde ausgedrückt…
Daniela blieb länger, als sie eigentlich beabsichtigt hatte. Und länger, als es für ihren Seelenfrieden gut war.
Sie hatten viel miteinander gelacht und festgestellt, daß sie auf vielen Gebieten gleich dachten und urteilten. Mit einem Wort – sie hatten festgestellt, daß sie gleichsam die gleiche Wellenlänge hatten. Und das beglückte sie beide, wenn auch keiner von ihnen wagte, es auszusprechen.
Als Daniela sich endlich verabschiedete, um heimzufahren, hatten sie einander viel besser kennengelernt. Und sie nannten sich bei den Vornamen.
Peter stand da und sah dem verschwindenden Wagen nach. Als er das Haus wieder betrat, sagte er leise: »Wie schön wäre es, wenn sie für immer bei mir bliebe – mit dem Buben.«
*
»Wie geht es Florian?« fragte Roberta Stender, die ihre Wohnung gleich gegenüber Danielas hatte. »Erholt er sich gut?«
»Oh, ich werde ihn bis zum Wochenende nach Hause holen dürfen«, berichtete Daniela bereitwillig und strahlte ihre neugierige Nachbarin nur so an. Roberta Stender nickte ihr zu.
»Ich habe gesehen, wie Sie mit dem Michalke in Ihrem Wagen fuhren. Nett, daß Sie sich ein bißchen um ihn kümmern. Seit ihm seine Frau mit dem Baby weggestorben ist, soll er ja ein ziemlicher Sonderling geworden sein. Aber das haben Sie sicher auch schon feststellen können, oder?«
»Nein. Für mich ist Herr Michalke der Mensch, dem ich das Leben meines einzigen Kindes zu verdanken habe. Wäre er nicht in den Baggersee gesprungen, würde Florian nicht mehr leben.«
Daniela schloß ihre Wohnungstür auf. Aber ehe sie der neugierigen Roberta Stender entfliehen konnte, sagte diese ausgesprochen hämisch: »Er soll ja ein dolles Haus gebaut haben, Frau Redlich.«
»Ja, das stimmt. Es ist bezaubernd.«
Im ersten Augenblick schien die gute Roberta sprachlos, aber dann sagte sie süffisant: »Oh, sagen Sie nur, Sie haben es schon von innen gesehen, Frau Redlich.«
»Ich bin sicher, daß Sie schon wissen, wie oft ich dort gewesen bin… Zweimal! Gestern, als ich für Herr Michalke Sachen holte, und heute, nachdem ich ihn aus der Klinik Birkenhain nach Hause gefahren habe. Deshalb kann ich Ihnen auch zustimmen, wenn Sie betonen, daß er ein hübsches Haus hat. Darin kann man sich durchaus wohl fühlen, Frau Stender.«
Da trat Roberta näher auf sie zu und sagte auffordernd: »Hören Sie – es paßt doch alles prima zusammen. Sie sind allein – er ist allein. Und – er hat ein schönes Haus. Wie wäre es denn, wenn Sie sich mit ihm zusammentun würden? Ich gäbe wer weiß etwas darum, wenn ich ein solches Haus mein eigen nennen könnte.«
»Ach, ich bin mit meiner Wohnung auch sehr zufrieden.« Mehr sagte Daniela nicht. Sie nickte ihrer Nachbarin zurückhaltend zu und verschwand. Daß Roberta Stender wütend sagte: »Eingebildete Pute«, hörte sie zwar noch, aber es störte sie keinesfalls. Dazu war sie viel zu glücklich. Und dieses Glück mochte sie sich nicht verderben lassen, auch nicht von Roberta Stender.
Aber als sie nach dem Abendessen vor dem Fernseher hockte, war sie nicht so aufmerksam wie sonst, obwohl ein spannender Film gezeigt wurde. Sie sah immer Peter Michalke vor sich, als er gesagt hatte, daß er einsam sei. Sie selbst hatte doch wenigstens noch Florian. Aber er – er hatte niemanden. Nur seine Arbeit. Und sie konnte sich sehr gut vorstellen, daß ihm das nicht genügte.
Es war beinahe, als laufe sie vor ihren eigenen Gedanken davon, als sie endlich den Fernseher abstellte, das Licht löschte und in ihr Schlafzimmer ging. Auf einmal fühlte sie sich auch unendlich einsam. Wenn doch wenigstens Florian hier gewesen wäre!
Als sie dann in ihrem Bett lag, hätte sie fast ein wenig geweint, und sie fand, daß sie doch nun wirklich gar keinen Grund hatte, Tränen zu vergießen. Es war alles in schönster Ordnung. Bald würde sie Florian heimholen können. Und sie würden Herrn Michalke besuchen fahren. Daniela lächelte in die Dunkelheit hinein. Es würde viel schöner werden als vor Florians Unfall, wußte sie.
Und dann mußte sie zugeben, daß aus jedem Unglück ein neues Glück entstehen konnte.
Aber sie konnte diese Gedanken nicht mehr weiterspinnen, denn die Augen fielen ihr zu. Und sie schlief tief und traumlos durch bis zum nächsten Morgen.
Sie ging wieder arbeiten, denn sie fand, es gebe keinen Grund, es nicht zu tun. Schließlich konnte sie nicht den ganzen Tag neben Florians Bett hocken. So viel gab es nun auch nicht zu erzählen für sie beide. Es genügte, wenn sie ihn nachmittags besuchte.
Man hatte Florian mit zwei anderen Buben zusammengelegt. Er war sich sehr wichtig vorgekommen, weil er natürlich als erstes hatte erzählen müssen, wie der Unfall eigentlich passiert war.
»Wie ist es, wenn man untergeht und nicht mehr atmen kann?« wollte einer wissen. Florian konnte keine Antwort geben, denn er wußte es ja selbst nicht.
»Was hast du gedacht, als das Eis unter dir nachgab, Florian? Hast du Angst gehabt?«
Auch hierauf konnte der Junge keine einigermaßen zufriedenstellende Antwort geben, denn er war doch gleich ohnmächtig geworden.
»Also ehrlich – das finde ich stinklangweilig«, sagte Richard, der morgen entlassen wurde. Man hatte ihn am Blinddarm operiert, und er war für einen Tag der Held des Zimmers gewesen, was jetzt unzweifelhaft Florian war. »Da kriegt man mal einen aufs Zimmer, der schon mal tot gewesen ist – und wenn man ihn fragt, wie das gewesen ist, dann weiß er es ganz einfach nicht mehr. Du kannst dir doch vorstellen, daß wir das alle sehr gern wissen würden.«
»Klar kann ich das. Ging mir an eurer Stelle wohl auch so. Tut mir aber leid, ich kann gar nichts sagen. Ich muß sofort ohnmächtig geworden sein.«
»Kannst du uns denn wenigstens beschreiben, wie es ist, wenn man ohnmächtig ist?« fragte Richard, der so schnell nicht lockerließ.
»Was soll es denn da schon groß zu beschreiben geben?« fragte Florian ungeduldig und auch schon etwas ärgerlich. »Man ist einfach weg und spürt nichts mehr. Ungefähr so, wie wenn du vor einer Operation deine Narkose bekommst.«
»Das ist doch was ganz anderes! Ich habe vorher schreckliche Angst ausgestanden!«
»Denkst du vielleicht, ich nicht? Ich habe schließlich vorher gewußt, daß das Eis mich nicht tragen würde.«
»Und trotzdem bist du draufgegangen?«
»Heute würde mir das auch nicht mehr im Traum einfallen, das schwöre ich dir. Aber als ich es tat, bildete ich mir ein, ich müßte meinen Mut beweisen. Könnte mir heute nicht mehr passieren. Heute weiß ich, daß es einen großen Unterschied zwischen Mut und Dummheit gibt. Und wenn man seinen Verstand gebraucht, dann ist das noch lange keine Feigheit.«
»Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das?«
»Ach, das kann man nicht so genau beschreiben. Das muß man selbst erlebt haben. Jedenfalls ist derjenige, der aus Vernunft eine so blöde Mutprobe ablehnt, in meinen Augen kein Feigling mehr. Es gehört viel mehr Mut dazu, etwas zu verweigern. Aber das begreift man erst, wenn es fast zu spät ist.«
Florian kam sich bei diesen Worten sehr erwachsen vor. Und vielleicht war er durch sein Erlebnis und die Erkenntnis, die er daraus gewonnen hatte, dem Erwachsensein ein gutes Stück nähergekommen, ohne es selbst bemerkt zu haben. Als am frühen Nachmittag seine Mutter kam, ihn zu besuchen und ihm ein Stück frischen Apfelkuchen mitbrachte, strahlte er sie an.
»Fein, daß du da bist, Mami. Ich finde es so blöd, hier liegen zu müssen. Aber nächsten Freitag darf ich heim. Das hat Dr. Hanna mir heute morgen fest versprochen.«
»Ich freue mich darüber, mein Kleiner. Wir werden eine richtige kleine Feier daraus machen, ja?«
»Könnten wir Herr Michalke auch dazu einladen?« wollte Florian wissen. Daniela errötete, ärgerte sich darüber und errötete noch mehr. Verwirrt wandte sie den Blick zum Fenster und holte einmal tief Luft, ehe sie erwiderte: »Einladen können wir ihn durchaus, mein Junge. Es fragt sich nur, ob er Zeit hat und auch kommen möchte.«
»Klar kommt er. Er ist doch mein Freund, Mami.«
So einfach ist das für Florian, dachte Daniela fast ein wenig neidisch. Kinder hatten es viel leichter, ihre Meinung zu sagen und ihre Gefühle zu zeigen. Viel leichter als Erwachsene.
»Nun, wir werden sehen«, schloß sie dieses Thema ab. Sie mochte sich nicht darüber unterhalten, weil sie selbst sich noch keine feste Meinung gebildet hatte. Und wie sie es sah, würde das auch noch ein Weilchen dauern. Aber das mußte sie mit sich selbst abmachen, dabei konnte Florian ihr nicht helfen.
An diesem Tag wurde es ganz besonders früh dunkel, und heftiger Schneefall setzte ein. Daniela wollte sich eben von Florian verabschieden, als es kurz klopfte und dann die große Gestalt Peter Michalkes sichtbar wurde. Er strahlte, als er Daniela an Florians Bett sitzen sah.
»Mensch, Herr Michalke, daß Sie mich schon besuchen kommen, finde ich einfach Spitze.« Florian strahlte so sehr, daß Daniela schon ein bißchen eifersüchtig werden wollte. Aber sie nahm sich zusammen und lächelte. Michalke setzte sich vorsichtig auf einen Stuhl und zog ein Buch aus dem Anorak, den er trug.
»Ich habe lange nachgedacht, was ich dir wohl mitbringen könnte, Florian. Und da fiel mir ein, daß ich, als ich in deinem Alter war, gern die Geschichte von Lederstrumpf gelesen habe. Da habe ich dir das Buch eben mitgebracht.«
Artig bedankte sich Florian. Daniela sah Peter vorwurfsvoll an und sagte mit leisem Vorwurf in der Stimme: »Sie scheinen zu glauben, daß Sie Florian etwas mitbringen müssen, wenn Sie ihn besuchen. Ich finde, Ihr Besuch ist schon sehr viel wert. Da braucht es keine Geschenke.«
»Aber es macht mir doch selbst Freude, ihm etwas mitzubringen, von dem ich weiß, daß er es mag. Sie wollen doch nicht, daß mir die Freude verdorben wird, nein?« Michalke sah sie treuherzig an. Und da lächelte Daniela ihm zu. Nein, sie wollte ihm die Freude nicht verderben.
Sie strich Florian über das Haar und fragte: »Brauchst du etwas, Liebling, das ich dir mitbringen könnte?«
»Ach, Mami«, sagte Florian schnell und sah sie glücklich an. »Ich habe alles, was ich mir nur wünsche. Das einzige, was mir jetzt noch große Freude machen würde, ist, wenn du mir sagst, daß du mich mit heimnehmen kannst.«
Ehe Daniela noch etwas sagen konnte, setzte Peter hinzu: »Ich verstehe, daß du ungeduldig bist, Florian. Das verstehe ich sogar besser, als du glaubst. Mir würde es, wäre ich an deiner Stelle, auch nicht anders gehen. Es ist schrecklich für jemanden, der sich im Grunde genommen gesund fühlt, im Bett liegen zu müssen. Und dazu noch in einer Klinik. Aber es hilft nun mal alles nichts. Und der Tag, an dem du heim darfst, kommt schneller, als du jetzt glaubst.«
»Wir wissen doch, daß wir dich Freitag holen können«, fügte Daniela hinzu und sah ihren Jungen liebevoll an. Aber dann eröffnete Peter etwas, was Florian in helles Entzücken versetzte.
»Ich kaufe einen Hund!« erklärte er ganz ruhig. Florian sah ihn an. Und auch Daniela warf ihm einen überraschten Blick zu.
»Was für einen?« wollte Florian wissen. Und auch die anderen Kinder hörten aufmerksam zu.
»Du hast es vielleicht gut. Dir kauft man schon etwas, bevor du weißt, daß du es dir gewünscht hast.«
»Was für einen Hund wollen Sie sich denn kaufen?« wollte Florian wissen. Er schien nichts anderes zu sehen als Peter Michalkes Gesicht, das sich unter seinem intensiven Blick ein wenig rötete.
»Nun«, erwiderte er zögernd, »ich weiß nicht genau. Aber ich dachte, du könntest mir vielleicht dabei helfen. Zuerst überlegen wir gemeinsam, was es für einer sein soll. Und dann könnten wir auch gemeinsam hinfahren und ihn holen. Aber selbstverständlich nur, wenn du magst. Ich will dich natürlich nicht belästigen.«
»Mami! Hast du das gehört? Er kauft einen Hund – und ich soll ihm dabei helfen!« sagte Florian aufgeregt. Daniela spürte wieder diesen plötzlichen sekundenlangen Schmerz, von dem sie genau wußte, daß er nur aus reiner Eifersucht entstand.
»Ja«, sagte sie, »ja, ich habe es gehört. Aber du weißt auch, daß wir keine Tiere in unserem Haus halten dürfen. Höchstens einen Kanarienvogel oder so etwas.«
»Ich wollte den Hund auch nicht in Ihre Wohnung geben, Daniela, sondern für mein Haus haben. Aber ich dachte mir, Florian würde gern mit ihm spielen. Und Platz gibt es dafür bei uns genug. Ich möchte auch gern einen Swimmingpool anlegen und…«
»Wirklich? Einen richtigen Pool, in dem man schwimmen kann und…«, fragte Florian atemlos vor Begeisterung.
»Na klar. Schließlich bin ich doch bei einer großen Baufirma beschäftigt und kann das meiste selbst machen. Mein Haus habe ich doch auch zum größten Teil allein gebaut.«
»Stark!« sagte Florian atemlos. »Das finde ich echt stark. Wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie es ruhig.«
»Ach, über Hilfe würde ich mich selbstverständlich sehr freuen, mein Kleiner. Deshalb habe ich das alles ja auch gesagt. Nicht etwa, um anzugeben. Ich möchte, daß du alles mit mir planst, daß wir beide es hinterher gemeinsam durchführen. Verstehst du?«
»Aber klar doch.« Florian warf sich ordentlich in die Brust. »Auf mich können Sie immer zählen.«
Sie blieben noch etwas länger als eine Stunde bei Florian. Dann sah Peter Michalke Daniela treuherzig an und fragte: »Würden Sie mich unverschämt finden, wenn ich Sie bitte, mich wieder heimzubringen? Es ist das letzte Mal, das verspreche ich Ihnen. Mein Wagen kommt nämlich morgen aus der Inspektion in Lüneburg zurück. Dann bin ich wieder unabhängig.«
Daniela war ziemlich einsilbig, als sie ihn nach Hause fuhr. Sie hielt vor seiner Haustür und machte den Eindruck, als wollte sie sofort nach Hause fahren. Aber damit war er nicht einverstanden. Mit bittenden Augen sah er sie an und fragte leise: »Wollen Sie nicht noch auf einen Kaffee mit mir hineinkommen?«
Sie schwieg immer noch, als er um den Wagen herumging und die Tür auf ihrer Seite öffnete. Klein und zierlich stand sie vor dem großen starken Mann und sah ihn ernsthaft an. Dann nickte er und ging neben ihr zur Haustür, schloß auf und ließ sie an sich vorübergehen.
Sie gingen miteinander in die Küche. Daniela holte die Tassen und den Zucker, stellte alles auf ein Tablett und trug es ins Wohnzimmer. Schon kam er mit der Kaffeekanne und ließ sich nieder. Zufrieden sah er ihr zu, wie sie den Kaffee einschenkte. Dann sagte er bedächtig: »Vielleicht sollten Sie mir sagen, was ich falsch gemacht habe. Ich meine, unter Freunden ist das doch üblich, oder?«
»Ach, Peter!« klagte sie und versuchte ein Lächeln, was ihr aber mißlang. »Ich wollte, ich könnte Ihnen sagen, Sie hätten etwas falsch gemacht. Aber ich könnte es nicht einmal erklären. Ich – ich weiß nicht mal, ob Sie überhaupt etwas falsch gemacht haben, ob ich nicht vielleicht nur dumm und eifersüchtig bin.«
»Dumm sind Sie ganz gewiß nicht. Ob eifersüchtig, weiß ich nicht. Aber ich möchte Ihnen versichern, daß Sie nicht eifersüchtig zu sein brauchen. Ganz bestimmt nicht, Daniela. Wieso denn auch?«
»Also schön, wenigstens das kann ich erklären.« Man sah ihr an, daß sie sich aufraffte und ihren ganzen Mut zusammennahm.
»Also gut, vielleicht ist es besser, wir reden gleich darüber. Ich möchte nicht, daß Sie Florian so sehr verwöhnen, Peter. Der Junge verliert dann vielleicht den Blick für die Realität. Und das möchte ich auf gar keinen Fall riskieren, weil ich weiß, daß das sehr schädlich für ihn wäre.«
»Ich fürchte, das verstehe ich nicht«, gab er zu und ließ sie nicht aus den Augen. Das machte sie unsicher, aber sie nahm sich zusammen.
»Na schön, dann werde ich halt noch deutlicher. Also – meine Witwenrente ist, wie Sie sich denken können, sehr niedrig. Deshalb arbeite ich vormittags, wenn Florian in der Schule ist, ja, auch bei der Gemeindeverwaltung. Wir kommen sehr gut aus, der Florian und ich. Aber große Sprünge können wir natürlich nicht mit dem machen, was ich monatlich zur Verfügung habe. Ich muß schon rechnen und kann auch keine Rücklagen schaffen. Wenn Sie jetzt nun daherkommen und ihm sagen, daß Sie einen Hund kaufen wollen, mit ihm gemeinsam, daß Sie einen Swimmingpool bauen wollen, dann wird er vielleicht in gar nicht allzu langer Zeit unzufrieden sein mit dem, was ich ihm bieten kann. Und ich kann ihm wirklich keinen Swimmingpool bieten, das kann ich Ihnen versichern.«
»Aber – das sollen Sie doch auch gar nicht, Daniela. So habe ich es auch nicht gemeint, wirklich nicht«, beteuerte er und sah sie schuldbewußt an. Dann fuhr er treuherzig fort: »Ich wollte ihm doch nur eine Freude machen, als ich das sagte. Nicht nur ihm, sondern uns allen. Wir sind doch Freunde, und Freunde machen den anderen Freude. So fasse ich jedenfalls Freundschaft auf.«
Daniela ließ sich seufzend nach hinten sinken und stieß dann endlich hervor: »Wenn Sie auf diese Weise mit einem reden, wird man ganz wehrlos, Peter. Florian ist ein echter Junge, der das Abenteuer sucht und sicher auch noch manchen Streich machen wird. Ich möchte aber, daß er trotzdem weiß, daß nicht jeder Wunsch, den ein Junge in seinem Alter hat, erfüllt werden kann.«
»Ich glaube sicher, daß er das schon längst weiß. Aber wenn er einen Freund hat, der einiges von dem, was er sich vielleicht heimlich wünscht, ohne es auszusprechen, wahrmachen kann, dann sollte man ihm diese Freude doch nicht nehmen, nein?«
»Und – was soll werden, wenn er eines Tages einsieht, daß ich ihm viel weniger bieten kann als Sie?« fragte Daniela traurig.
Da erhob er sich, ging ein paarmal auf und ab und sah sie, als er endlich vor ihr stehenblieb, ernsthaft an.
»Das sind Argumente, mit denen wir uns tatsächlich auseinandersetzen müssen. Wir können alle Hindernisse mit einem einzigen Schlag aus der Welt räumen, Daniela.«
Neugierig und mißtrauisch zugleich sah sie ihn an und fragte leise: »Was soll denn das nun schon wieder bedeuten, Peter? Wenn Sie wollen, daß ich Sie begreife, müßten Sie schon ein bißchen deutlicher werden.«
»Oh, es ist etwas, über das ich unausgesetzt nachdenken muß, was immer ich auch gerade tue. Und ich meine, Sie sollten erfahren, um was es sich handelt und zu welchem Entschluß ich gekommen bin.«
Sie sagte kein Wort, sah ihn nur stumm an. Und da fuhr er auch schon entschlossen fort: »Sie sind ebenso einsam wie ich, stimmt’s? Trotz Florian. Ein kleiner Junge kann keinem über die Probleme, die es nun einmal im Leben gibt, helfen. Aber ein ehrlicher Partner, der kann es wohl.«
»Und?« fragte Daniela atemlos.
»Warum tun wir uns nicht zusammen, Daniela?« fragte er da sanft und sah sie aus grundehrlichen Augen an. Sie fühlte sich dahinschmelzen, völlig wehrlos werden.
»Zusammentun?« fragte sie flüsternd. »Wie haben Sie sich das vorgestellt?«
»Wunderschön, Daniela. Ich stelle es mir immer noch wunderschön vor«, gab er zurück und strahlte sie treuherzig an. Sie mußte den Blick abwenden, weil sie fürchtete, in den blauen Augen des großen Mannes zu ertrinken.
»Sie sind ein Kindskopf, Peter«, versuchte sie abzuwehren.
»O nein, das glaube ich nicht«, wehrte er ruhig ab. »Ich glaube, in den letzten drei Jahren ist mir nichts so wichtig gewesen wie das hier. Sie haben keine Ahnung, wie einsam ich war, wie schrecklich das für mich gewesen ist. Und jetzt auf einmal ist da ein kleiner Junge, dem ich den Vater ersetzen möchte. Und eine Frau, die ich verehre, achte und respektiere.«
»Ich achte Sie auch, Peter«, flüsterte sie. »Sogar sehr.«
»Was hindert uns also daran, es miteinander zu versuchen? Geben Sie uns allen eine Chance, ein glückliches Leben zu führen, Daniela.«
Seine Worte klangen eindringlich, fast flehend. Daniela hatte ihren Blick längst aus dem seinen gelöst und starrte auf ihre im Schoß liegenden Hände hinab. Dann sagte sie unsicher: »Achtung und Respekt sind sehr gut, Peter. Manchen Menschen genügen sie auch für ein Leben miteinander. Aber mir nicht. Ich möchte auch geliebt werden, wenn ich…«
»Aber das ist es doch, Daniela!« Er wurde plötzlich lebhaft und beugte sich zu ihr, legte seine große Hand sehr zart auf ihre im Schoß verschlungenen. »Ich habe nur noch nicht darüber sprechen wollen, weil ich mir sagte, es sei viel zu früh dazu. In – in unserem Alter und unserer Situation macht man sich schnell lächerlich. Sie haben eine glückliche Ehe hinter sich. Ich ebenfalls. Wir haben beide geglaubt, als unsere Partner von uns gingen, die Welt müsse einstürzen. Aber wir haben einsehen müssen, daß die Welt durch Einzelschicksale nicht beeinflußt wird, daß sie sich unentwegt weiterdreht. Und das ist auch gut so. Wir werden unsere Partner nie vergessen. Sie Ihren Mann nicht, und ich Carola nicht. Aber das hindert uns doch nicht daran, es noch einmal mit einem anderen Partner zu versuchen, oder? Ich wiederhole – ich verehre, achte und respektiere Sie, Daniela. Aber ich liebe Sie auch. Ich wollte nur noch nicht darüber reden, weil unsere Bekanntschaft ja wirklich erst kurz ist. Aber das Gefühl ist da – jedenfalls auf meiner Seite. Ich habe mich dagegen gewehrt, weil es mir wie ein Betrug an Carola vorkommen wollte. Aber dann sah ich es von einer ganz anderen Seite.«
»Wollen Sie mir sagen, von welcher Seite aus Sie es gesehen haben?« wollte sie mit leiser Stimme wissen und hob den Blick zu ihm auf, wich ihm nicht mehr aus, als er lächelte. Der Druck seiner Hände auf den ihren verstärkte sich, als er fortfuhr: »Nun, eigentlich ist es ganz einfach. Man kann nicht nur einmal in seinem Leben eine feste Bindung eingehen, sondern mehrere Male. Als ich das einsah, war ich zuerst ganz entsetzt. Aber nun freue ich mich darüber. Ich habe mich vom ersten Augenblick an in Sie verliebt, Daniela. In Ihre Zartheit, Ihre Sanftmut, und auch in Ihre Tapferkeit, mit der Sie Ihr gewiß nicht immer leichtes Leben meistern.«
»Oh, Peter!« Das war erst einmal alles, was Daniela dazu sagen konnte. Er sah sie immer noch unverwandt an. Und dann fuhr er in diesem bedächtigen Ton, der seine Wirkung auf sie nicht verfehlte, fort: »Ich war erschüttert, als ich erkannte, wie einfach es ist, eine neue Beziehung anzuknüpfen. Als ich Sie kennenlernte, stand es für mich fest, daß ich Sie nicht so einfach mehr aus meinem Leben verschwinden lassen wollte. Ich wollte Sie und Florian an allem teilhaben lassen. Ich wollte Ihnen beiden begreiflich machen, daß wir uns zusammentun sollten. Nicht, weil das am praktischsten für uns wäre, sondern weil ich Sie liebe, Daniela. Das ist und bleibt der Hauptgrund.«
Es war sehr lange still zwischen ihnen. Dann aber sagte Daniela mit einem kleinen, schüchternen Lächeln: »Ich habe gar nicht gewußt, daß Sie so schöne Worte finden können und so viele, Peter. Ich glaubte bisher immer, daß Sie sehr wortkarg sind.«
»Gewöhnlich bin ich das auch«, gab er ehrlich zu. Und dann, mit einem kurzen Auflachen: »Aber jetzt hat die Liebe mich beredter werden lassen, glaube ich.«
Sie strahlte plötzlich. Und dann sagte sie ehrlich: »Ich hätte auch nicht für möglich gehalten, daß wir, in unserem Alter, noch einmal so verrückt verliebt sein könnten.«
»Was heißt das?« fragte er atemlos. Er war plötzlich ganz schrecklich aufgeregt, und Daniela sah, daß seine großen starken Hände plötzlich nicht nur unsicher waren, sondern sogar zitterten.
»Du bist ein sehr kluger Mann, Peter«, sagte sie lächelnd. »Aber du kannst auch schrecklich begriffsstutzig sein. Warum nimmst du mich nicht einfach in die Arme und gibst mir einen Kuß? Das ist es doch, was wir beide uns wünschen. Und ich weiß nicht einmal, wer es sich mehr wünscht du oder ich.«
Als er aufsprang, gab er einen erstickten Laut von sich. Er zog Daniela aus ihrem Sessel empor und nahm sie ganz fest in seine Arme. Dann küßte er sie. Ganz, ganz langsam neigte er sich ihr zu, und es hatte beinahe den Anschein, als wolle er jede einzelne Bewegung richtig auskosten. Und dann trafen sich ihre Lippen zu einem erst schüchternen, dann aber immer leidenschaftlicheren Kuß.
Es dauerte lange, bis sie sich voneinander lösten. Sie sahen einander in die strahlenden Augen. Peter fragte endlich: »Wirst du mich heiraten, Daniela?«
Statt jeder Antwort legte sie den Kopf gegen seine breite Brust und lauschte auf das Pochen seines Herzens. Es war stark, ebenso wie der ganze Mann. Und dann sagte sie leise: »Es gibt nichts auf der Welt, was ich mir mehr wünsche, Peter. Aber ich bin nicht allein. Da ist auch noch Florian. Wenn Florian mit dir einverstanden ist, sage ich auch ja. Und dann, das weiß ich jetzt schon, werden wir bestimmt eine glückliche Familie werden.«
Es war ganz selbstverständlich, daß Daniela in der Nacht bei Peter blieb. Sie brauchten sich nicht erst darüber zu verständigen. Alles war gut so, wie es war. Und sie waren beide entschlossen, ihre Liebe gegen alles und jeden zu verteidigen, ganz gleich, was auch immer es sein mochte, das sich ihnen in den Weg stellen wollte.
*
Am nächsten Morgen saßen sie in der Küche beim gemeinsamen Frühstück. Dann fuhr Daniela zum Gemeindeamt, und Peter ging zu seiner Arbeit. Am Nachmittag, wenn sie Florian besucht hatten, wollten sie Peters Wagen aus Lüneburg holen.
Nach der Arbeit fuhr Daniela heim. Sie wollte sich umkleiden und frisch machen, ehe sie in die Klinik fuhr. Und – sie wollte einige Sachen zusammenpacken, denn sie würde, solange Florian in der Klinik bleiben mußte, abends bei Peter bleiben. Es war ihr beinahe, als sei sie schon seine Frau. Alles andere war nur noch reine Formsache, fand sie.
So dachte sie noch, als sie Roberta Stender traf, die ganz offensichtlich auf sie gewartet hatte, denn sie öffnete ihre Wohnungstür just in dem Augenblick, da Daniela die ihre aufschließen wollte.
»Ich habe gestern gar nicht gehört, daß der Fernseher bei Ihnen lief, Frau Redlich«, begann sie auch schon. »Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Es ist doch nichts mit dem Buben passiert, nein?«
»Florian? Weshalb sollte etwas mit ihm passiert sein?« fragte Daniela verständnislos.
»Na, weil Sie doch die ganze Nacht nicht daheim gewesen sind, Frau Redlich«, kam es, wie aus der Pistole geschossen. »Es hätte ja sein können, daß Sie die ganze Nacht in der Klinik bleiben mußten, weil Florian einen Rückfall erlitten hatte. Aber Frau Rechmann, die auf dem Amt war, hat mir erzählt, daß Sie heute morgen gearbeitet haben.«
»Natürlich habe ich heute morgen gearbeitet. Ich habe nämlich noch keinen Urlaub, Frau Stender. Und jetzt möchte ich mich zurechtmachen, weil ich gleich in die Klinik möchte.«
»Dieser Peter Michalke, der, der Florian aus dem Baggersee gezogen hat, interessiert sich wohl sehr für Sie beide, wie?« fragte Roberta Stender geradezu.
Daniela hatte ihre Wohnungstür aufgeschlossen und stieß sie nun weiter auf.
»Warum fragen Sie nicht ihn danach, Frau Stender? Meinen Sie nicht, daß Sie bei ihm an der richtigen Adresse wären? Vielleicht gibt er Ihnen bereitwillig Auskunft.«
»Na ja, ich mische mich ja grundsätzlich nicht in anderer Leute Angelegenheiten. Aber Sie wollte ich eigentlich warnen, meine Liebe. Es gibt leider heutzutage viele schlechte Menschen. Solche, die andere, die ohne Arg und Mißtrauen sind, betrügen und hereinlegen. Ich möchte nicht, daß Sie enttäuscht werden.«
»Es ist rührend, wie besorgt Sie doch um Florian und mich sind, Frau Stender. Wirklich, das beeindruckt mich tief. Aber ich glaube auch, daß ich bisher mit meinem Leben und auch mit dem Florians sehr gut fertiggeworden bin. Es ist nicht einzusehen, daß ich das nicht auch weiterhin schaffe, oder sind Sie da anderer Ansicht?«
Sie wartete Frau Stenders Antwort erst gar nicht ab, sondern schlug die Wohnungstür hinter sich zu, lehnte sich von drinnen mit dem Rücken dagegen. Es war ihr, als sei ihr Glück auf eine ganz gemeine Weise beschmutzt worden.
Dann jedoch warf sie den Kopf in den Nacken und sagte sich entschlossen, daß sie mit jedem den Kampf aufnehmen würde, der ihr ihr Glück nicht gönnte. Dazu gehörte ganz offensichtlich Roberta Stender.
Sie hörte, wie drüben die Wohnungstür ging und dann jemand die Treppe hinabging. Da lächelte Daniela schon wieder.
Jetzt würden die Leute aus Ögela erfahren, daß sie die Nacht über nicht daheim gewesen war. Man würde sich die Köpfe zerbrechen. Und vielleicht würde man auch der Wahrheit nahekommen und herausfinden, wo und mit wem sie die letzte Nacht verbracht hatte. Mit einem Wort – der Klatsch hatte angefangen zu blühen. Und es schien, als werde es nicht allzu lange mehr dauern, bis dieser Klatsch immer neue Blüten trieb.
Daniela duschte, kleidete sich um und lächelte immer noch, als sie wenig später in ihren Golf stieg, um zur Klinik zu fahren. Sie wußte, wenn sie an einzelnen Grüppchen vorüberfuhr, daß man ihr nachschaute und sich anschließend wahrscheinlich über sie unterhielt.
Merkwürdigerweise war ihr das nicht unangenehm. Ja, sie ging sogar noch weiter und gestand sich ein, daß es ihr absolut nichts ausmachte.
Sie fand, der Zustand, in dem sie sich augenblicklich befand, war wunderbar. Sie wünschte sich von ganzem Herzen, daß er ewig andauern möge, eben, weil sie sich so unendlich glücklich fühlte. Wenn man liebt und sich wiedergeliebt weiß, dachte sie, ist das Leben viel schöner, dann fühlt man sich wachsen, dann hat man so viel Kraft, wie man es vorher nie für möglich gehalten hätte.
Florian winkte ihr schon entgegen und sagte wenig später, nachdem sie einander liebevoll begrüßt hatten: »Im Radio sagen sie, daß noch mehr Schnee kommt, und daß es weiterhin frieren wird. Ich finde das prima, Mami, denn dann haben wir endlich wieder mal einen schönen Winter und können draußen spielen und rodeln und schlittern und…«
»Und auf den Baggersee hinauslaufen«, vollendete Daniela lachend. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür. Peter Michalke trat ein und sah sie sekundenlang mit leuchtenden Augen an, in denen alle Liebe stand, die er für sie empfand. Dann wandte er sich Florian zu und sagte: »Jetzt sind es nur noch drei Tage, Florian, bis du wieder nach Hause kannst.«
»Ich weiß.« Florian lächelte ihn selbstvergessen an. Aber diesmal spürte Daniela keinen Neid, nicht mal der Anflug eines solchen Gefühls machte sich in ihr bemerkbar. Sie sah mit leuchtenden Augen auf den Mann, den sie von ganzem Herzen liebte, und dankte dem Schicksal, daß alles so gekommen war. In diesem Augenblick wußte sie, was es hieß, wenn man sich vornahm, nicht mehr rückwärts zu schauen, sondern nur vorwärts. Es war ganz natürlich, nach vorn zu schauen, denn die Zukunft war ausschlaggebend. Und die lag in den herrlichsten Farben vor ihr und vor Florian.
Der Junge sah sie kein bißchen enttäuscht an, als sie behutsam erklärte, daß sie mit Peter Michalke nach Lüneburg fahren wollte, weil er seinen Wagen aus der Werkstatt holen mußte.
»Macht nichts, Mami, wirklich nicht«, beteuerte Florian und sah sie treuherzig an. »In ein paar Tagen bin ich ja wieder bei dir. Dann brauchst du dich nicht mehr so abzuhetzen.«
»Du bist ein lieber kleiner Kerl, Florian, ich habe dich sehr lieb«, sagte sie lächelnd und küßte ihn. Auch Peter beugte sich zu ihm hinab, aber er strich ihm nur über den Wuschelkopf.
»Nett von dir, daß du mir heute deine Mami ausleihst, Florian. Da brauche ich nicht mit dem Bus zu fahren. Das dauert immer so schrecklich lange, und man verliert so viel Zeit. Übrigens haben wir, wenn wir dich heimholen können, eine Überraschung für dich.«
Florian schielte ihn von unten herauf an.
»Hat wohl kaum Zweck, zu fragen, um was es sich handelt, oder?« wollte er wissen. Peter lachte und schüttelte den Kopf.
»Das hast du ganz richtig erkannt, mein Freund. Nein, hat keinen Zweck, zu fragen. Ich kann nämlich ebenso gut dichthalten wie deine Mami. Aber wenn wir es dir sagen, wirst du dich sicher freuen.«
»Gut. Ich muß bis Freitag warten, bis ich wieder nach Hause kann. Da kommt es mit der Überraschung wohl auch nicht mehr so genau darauf an. Scheint aber was Schönes zu sein, weil ihr beide so froh ausseht.«
Peter und Daniela sahen einander in die leuchtenden Augen, dann schauten sie Florian an. Daniela sagte leise, aber sehr, sehr froh: »Nur so viel sollst du wissen, Liebling: Wenn du wieder bei mir bist, wird unser Leben sich ganz anders gestalten. Aber mehr wirst du jetzt nicht aus mir herausbekommen.«
Florian gab sich zufrieden und winkte ihnen beiden fröhlich nach, als sie ihn eine halbe Stunde später verließen, mit dem Versprechen, morgen mehr Zeit für ihn zu haben.
Daniela saß ganz still und zufrieden neben Peter, der den Golf fuhr. Es tat so gut, jemanden neben sich zu wissen, der für einen handelte und einem so manches abnahm.
»Wirst du weiterarbeiten, wenn wir verheiratet sind?« wollte Peter endlich wissen und warf ihr einen kurzen Seitenblick zu. Daniela sah auf ihre im Schoß ruhenden Hände und erwidert dann bestimmt: »Ja, ich denke schon. So wird der Tag nicht zu lang, weil ich immerzu auf dich warten muß. Außerdem, so finde ich, können wir das Geld, das ich nebenher verdiene, doch auch gut gebrauchen, meinst du nicht?«
»Ich rede dir da nicht hinein, Daniela«, erwiderte er in seiner bedächtigen Art. Man merkte ihm an, daß er sich jedes Wort genau überlegte, ehe er es aussprach. Aber wenn er das tat, dann konnte man gewiß sein, daß alles Hand und Fuß hatte. »Als meine Frau hättest du es nicht nötig, zu arbeiten. Aber ich kann dich sehr gut verstehen. Du bist daran gewöhnt, und du hast dein eigenes Geld, mit dem du machen kannst, was immer du willst. Das gibt dir ein Gefühl der Unabhängigkeit. Wenn du also weiterarbeiten willst, dann tu es. Aber du sollst nicht glauben, daß es sein muß. Ich verdiene genug, um uns ein schönes Leben zu sichern.«
»Ich weiß.« Sie warf ihm einen zärtlichen Blick zu.
»Ich bin so glücklich, daß du Verständnis für mich hast, Peter. Und es macht mich auch froh, daß du mich nicht zwingen wirst, aufzuhören. Irgendwann werde ich von allein aufhören wollen. Aber noch nicht jetzt.«
Da legte er eine Hand auf die ihren und sagte ruhig: »Eines will ich dir jetzt schon sagen, Daniela: Ich werde niemals versuchen, den geringsten Druck auf dich auszuüben. Du bist ein Mensch, der bewiesen hat, daß er sehr gut mit dem Leben fertig wird. Da wäre es doch dumm von mir, wenn ich dir meinen Willen aufzwingen wollte.«
»Es gibt Männer, die da ganz anders als du denken«, warf sie ein und fuhr dann fort: »Ich weiß zum Beispiel, daß es eine Menge Frauen in Ögela gibt, die unzufrieden mit ihrem Leben sind, weil sie immer nur nachgeben müssen, wenn sie den Frieden wahren wollen. Ihre Männer scheinen zu glauben, daß eine Frau dem Mann Gehorsam schuldet.«
»Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter«, war sein einziger Kommentar. Daniela sagte nichts darauf, sie lächelte nur. Es war ein ausgesprochen glückliches Lächeln, das auf ihrem weichen Gesicht blieb, auch als man Lüneburg schon erreicht hatte und vor der großen Werkstatt vorfuhr.
Sie holten Peters Wagen ab, gingen dann in der Innenstadt in ein hübsches Lokal, in dem sie ungestört sitzen konnten, und aßen zu Abend. Dann brachen sie auf, um heimzufahren. Peter fuhr vor Daniela her. Er war sehr rücksichtsvoll, denn es hatte wieder zu schneien begonnen, und man konnte nicht sehr weit sehen.
Es dauerte nicht allzu lange, bis sie Ögela wieder erreicht hatten. Peter fuhr Danielas Wagen in die Garage, weil er, wie er mit verschmitztem Lächeln erklärte, keinen unbedingt draufstoßen wollte, daß Daniela bei ihm blieb.
Und Daniela war mit allem zufrieden, wenn sie nur in seiner Nähe sein konnte.
*
Roberta Stender sorgte dafür, daß Ögela neuen Gesprächsstoff hatte. Zuerst berichtete sie hinter der vorgehaltenen Hand beim Bäcker, daß Frau Redlich schon drei Tage lang nachts nicht mehr daheim gewesen sei.
»Ich weiß nicht – aber sie muß sich doch selbst denken, daß einem das auffällt, nicht wahr? Der Junge liegt in der Klinik. Das nutzt sie da wohl aus. Ich frage mich, wie sie sich verhalten wird, wenn der Bub erst einmal zurück ist aus der Klinik. Dann kann sie nicht mehr einfach nachts fortbleiben.«
Es gab natürlich einige, die neugierig zuhörten und beifällig nickten. Sie waren auch diejenigen, die den Klatsch weitertrugen, bis ganz Ögela wußte, daß Daniela Redlich schon drei Nächte nicht daheim verbracht hatte.
Es gab die moralisch Empörten, die tönten, man habe es immer schon gewußt. Schließlich könnte man einem Menschen nicht ins Gehirn schauen und sehen, was er gerade dachte. Aber man wisse ja, wohin so etwas führte – immer weiter abwärts. Man bedauerte Florian und flüsterte einander zu, es sei ja wohl auch nur noch eine Frage der Zeit, bis das Jugendamt aufmerksam wurde und dann jemand käme, der Daniela den Jungen fortnahm.
»So geht es den meisten, die ihre Triebe nicht unterdrücken und sich selbst nicht beherrschen können«, sagte Roberta Stender dann wohl und sah sich beifallheischend um.
Es gab aber auch solche, die deutlich zeigten, wie sehr sie den Klatsch verabscheuten. Sie hatten auch keine Angst, Roberta Stender deutlich zu sagen, was sie von ihr hielten.
Die Fleischersfrau stemmte die Hände in ihre beachtlich breiten Hüften und sah Roberta vernichtend an.
»Hören Sie lieber auf, über Frau Redlich herzuziehen«, sagte sie warnend. »Sie ist hier sehr beliebt, und sie hat niemandem etwas zuleide getan. Ich finde es gemein und niederträchtig, über sie herzufallen, wenn sie nicht dabei ist und sich nicht wehren kann.«
»Wie sollte sie denn das wohl machen?« fragte Roberta Stender hämisch. »Tatsachen kann sie auch nicht verdrehen. Sie sind nun mal da, ob man will oder nicht. Und man muß sich mit ihnen auseinandersetzen. Das weiß doch jedes Kind.«
»Kann schon sein. Aber wenn ich Frau Redlich wäre, und mir käme zu Ohren, was da über mich geredet wird, ich glaube nicht, daß ich einfach stillhalten würde.« Die Fleischersfrau warf Roberta einen verächtlichen Blick zu und fuhr dann wütend fort: »Wenn man bedenkt, woher diese Geschichten kommen, weiß man eigentlich auch, was dahintersteckt. Sie können doch nicht abstreiten, Frau Stender, daß jedermann in Ögela genau weiß, was für eine Klatschbase Sie sind.«
»Jetzt machen Sie aber mal ’n Punkt, meine Liebe. Sie scheinen zu vergessen, daß ich Kundin bin.«
»Kundin hin oder her – ich mag es nicht, wenn in meinem Laden über andere, die ich dazu noch sehr mag, hergezogen wird. Ich kann Ihnen das Klatschen nicht verbieten, Frau Stender – leider nicht. Aber wenn Sie glauben, es sich nicht verkneifen zu können, dann tun Sie es anderswo. Hauptsache, Sie tun es nicht hier, in unserem Geschäft.«
Die gute Roberta schnappte sichtlich nach Luft. So etwas war ihr noch niemals vorgekommen, das sah man ihr deutlich an. Aber jetzt lief ihr Gesicht hochrot an. Und sie platzte los: »Ich kann Ihnen jetzt schon versichern, daß Sie mich als Kundin verloren haben.«
»Sie werden sich wundern – aber das nehme ich sogar in Kauf, meine liebe Frau Stender. Mir ist es lieber, ich habe eine Kundin weniger, als daß man sagen kann, daß in meinem Laden die Leute von Ögela durch den Schmutz gezogen werden. Warum lassen Sie Frau Redlich nicht in Ruhe? Sie hätte es doch wirklich verdient, einen netten Mann zu finden. Man könnte ja fast auf den Gedanken kommen, daß Sie ihr das neiden.«
Damit hatte sie den Nagel auf den Kopf, und Roberta Stender bis ins Mark getroffen. Niemand, der über andere herzieht, hört gern die Wahrheit, besonders nicht, wenn sie ihn selbst betrifft. Roberta Stender machte da keine Ausnahme.
Ihr Gesicht färbte sich hochrot vor Wut, Scham und Empörung. Man hatte sie beleidigt. Und dazu noch vor anderen Leuten, die sie, wie unschwer zu erkennen war, alle etwas schadenfroh betrachteten. Da war es schon geboten, einen Rückzug anzutreten und sich einen Abgang zu verschaffen, der einen nicht noch mehr blamierte.
Sie hob den Kopf ganz hoch und sagte spitz: »Ich sehe schon – man hat Sie ganz offensichtlich gegen mich aufgehetzt, meine Gute. Nun, Sie werden es sicher noch einmal bereuen, daß Sie es sich jetzt mit mir verderben. Wer verliert schon gern einen Kunden? Und ich werde nicht die einzige Kundin sein, die wegbleibt, das kann ich Ihnen jetzt schon versichern.«
»Ich kann auf jeden verzichten, der mit Ihnen gemeinsame Sache macht, Frau Stender. Sollte ich aber in Erfahrung bringen, daß Sie versuchen wollen, auch mich in Ihre Klatschereien einzubeziehen, kann ich Ihnen jetzt schon versichern, daß Sie sich an mir Ihre Giftzähne ausbeißen werden. Ich fackele bestimmt nicht lange, und mein Mann ebenfalls nicht. Wenn es sein muß, schrecken wir auch ganz bestimmt nicht davor zurück, Sie wegen übler Nachrede, in Einheit mit Geschäftsschädigung, anzuzeigen. So, und nun nehmen Sie wohl am besten Ihre Einkaufstasche mit und verlassen mein Geschäft.«
Unsicher und wütend zugleich riß Roberta ihre Einkaufstasche an sich und verließ wortlos und mit verkniffenem Mund den Laden. Sie hörte, daß man hinter ihr herlachte. Und das war eigentlich am schlimmsten für sie, denn sie fühlte sich nicht ernst genommen und lächerlich gemacht.
Während sie düstere Rachepläne wälzte, machte sie sich auf den Heimweg. Es gab einige Frauen, die ihr auf ihrem morgendlichen Einkaufsweg begegneten und eigentlich, weil sie das sonst auch immer taten, bei ihr stehenbleiben wollten, um den neuesten Klatsch aus dem Dorf zu erfahren. Einige behaupteten dann und wann lachend, daß Roberta Stender alles wisse. Und niemand hatte bisher trotz intensiver Bemühungen herausbekommen können, was und wo ihre Quellen waren. Wenn ihre Klatschereien auch manchmal sehr boshaft waren – ein gewisses Quantum Wahrheit war überall vorhanden gewesen. Und hieß es nicht, daß dort, wo Rauch ist, auch Feuer sein muß?
Wie gesagt – Roberta war zutiefst getroffen und wälzte düstere Rachepläne, von denen sich keiner, wie sie enttäuscht zugeben mußte, so schnell würde in die Wirklichkeit umsetzen lassen.
Aber, so sagte sie sich zuversichtlich, niemand konnte ihr nachsagen, daß sie nicht ganz besonders erfinderisch wäre. Sie würde auch jetzt etwas finden, mit dem sie allen, die sie beleidigt hatten, beweisen konnte, daß man eine Roberta Stender nicht ungestraft beleidigte.
Nur – was die Angelegenheit erschwerte, sogar ganz erheblich, war die Tatsache, daß ihr eigener Mann ihr schon mehr als einmal in aller Deutlichkeit untersagt hatte, sich den Mund an anderer Leute Angelegenheiten zu verbrennen. Roberta hatte die düstere Ahnung, daß genau das jetzt geschehen war…
*
Daniela hatte sich für den Freitag frei genommen. Sie hatte schon am Vortag Kuchen gebacken, den Peter gleich, ehe sie Florian zusammen abholten, mitnehmen würde. Sie hatten nämlich beschlossen, Florians Heimkehr in Peters schönem Haus zu feiern. Dort konnte man gewiß sein, daß es nicht unversehens an der Wohnungstür läutete, weil es Roberta Stender einfiel, sich etwas Zucker oder Mehl zu borgen und dann das Verabschieden zu vergessen.
»Dann können wir gleich mit Florian einen Gang durch den großen Garten machen. Ich kann mit ihm alle Ecken besuchen, die mir besonders gut gefallen. Und dann habe ich ein herrliches Gesprächsthema, denn ich will wirklich einen Pool anlegen.«
»Ich kann nur hoffen, daß du das nicht allein wegen Florian tun willst. Oh, Peter, ein Swimmingpool ist doch ganz sicher sehr teuer, oder nicht?«
»Jedenfalls nicht so teuer, wie du zu glauben scheinst.« Er lachte sie an und küßte sie. Niemand, der ihn mit Daniela so unbeschwert zusammen hätte sehen können, hätte ihn wiedererkannt, und man hätte sich sicher gefragt, wo denn der wortkarge Sonderling Peter Michalke geblieben war. Dieser Peter Michalke war ein ganz neuer Mensch. Einer, dem man ansah, daß er das Leben wieder schön fand und sich auf jeden neuen Tag freute, den es ihm schenkte.
Auf der Arbeitsstelle hatte man ihn schon gefragt, ob er vielleicht im Lotto gewonnen oder das Große Los gezogen habe, weil er in der letzten Zeit immer nur so strahlte. Er hatte nur gelächelt und genickt.
»Ja«, hatte er einfach zugegeben, »ja, ich habe das Große Los gewonnen. Aber ich möchte nicht darüber reden, wenigstens jetzt noch nicht. Man kann mit Reden so viel zerstören. Ihr werdet es noch früh genug erfahren.«
»Man könnte ja beinahe glauben, du hättest dich verliebt«, sagte einer der Kollegen und sah ihn neugierig an. Peter lächelte nur und wiederholte: »Wartet nur die Zeit ab, bis ihr es erfährt. Ihr werdet euch ganz gestimmt mit mir freuen, denn ihr seid mir immer gute Freunde und Kameraden gewesen.«
Das stimmte sogar, wie er gern zugab. Sie hatten zusammengehalten, als das mit Carola und dem totgeborenen Baby geschah. Einer war immer bei ihm gewesen, und wenn er auch nur wortlos bei ihm gesessen hatte. Peter war ohne Worte dankbar dafür gewesen. Wahrscheinlich hatten sie gefürchtet, der Kummer sei zu groß für ihn gewesen, und er könnte sich am Ende etwas antun.
Vielleicht hätte er das auch versucht, aber er hatte dazu gar keine Gelegenheit gefunden, weil er nie allein gewesen war. Noch nicht einmal nachts, denn da hatten sie einander abgelöst und waren einfach geblieben. Daran mußte er jetzt voller Dankbarkeit und Freude denken. Ja, er konnte sich glücklich preisen, daß er so viele gute Freunde hatte. Er würde sie alle zur Hochzeit einladen, das war jetzt schon sicher.
Auch Peter Michalke hatte sich für den Nachmittag freigenommen, denn er wollte alles mit Daniela und Florian gemeinsam machen.
Pünktlich fuhr er mit seinem großen Wagen vor. Die Kuchen und die schöne Torte hatte er schon am Vorabend abgeholt. Daniela hatte abends noch die Wohnung auf Hochglanz gebracht. Und jetzt saßen sie, Roberta Stender zum Trotz, die hinter der Gardine ihres Wohnzimmerfensters verborgen stand, nebeneinander in seinem Wagen, um zur Kinderklinik Birkenhain zu fahren und Florian, der sicher schon voller Ungeduld auf sie wartete, abzuholen.
»Der Michalke also«, flüsterte Roberta verbissen zwischen den zusammengepreßten Zähnen. »Ich hätte es mir ja denken können. Wahrscheinlich geht das schon lange so, und sie machen es jetzt in aller Öffentlichkeit, weil jedermann versteht, daß sie ihm dankbar ist, weil er ihr Kind aus dem Baggersee geholt hat.«
Daß es sich um eine ganz ehrliche und romantische Liebesbeziehung mit gutem Ausgang handeln könnte, fiel ihr nicht ein. Für Roberta hatte alles immer noch einen Pferdefuß. Sie konnte nicht anders – sie mußte einfach alles hämisch betrachten und glaubte, ersticken zu müssen, wenn sie ihre Gedanken nicht gleich an andere weitergeben konnte. Jedermann fürchtete ihre böse Zunge, aber niemand hatte sich bis jetzt Gedanken darüber gemacht, aus welchem Grunde Roberta Stender so war. Sie war nämlich innerlich eine vereinsamte Frau. Es war bei ihr wie bei einer Katze, die sich in den Schwanz beißt: Zuerst war sie Feuer und Flamme für jemanden. Wenn sie dann nicht so ankam, wie sie sich das wünschte, wandelte sich ihre Sympathie sofort in Abwehr, die sogar manchmal bis zum Haß gehen konnte. Das geschah besonders dann, wenn sie spürte, daß die Person, die ihr wichtig war, sich einem anderen Menschen zugewandt hatte. Niemand hatte sich, wie gesagt, bisher Gedanken darüber gemacht, weshalb Roberta Stender so bösartig war. Es müßte schon ein Wunder kommen, um die Menschen aufzurütteln. Keine Seele ahnte, daß dieses Wunder unmittelbar bevorstand und sehr unangenehm beginnen würde.
Jetzt fuhren Daniela und Peter erst einmal gemeinsam zur Klinik Birkenhain, den gewiß schon ungeduldig wartenden Florian abzuholen.
Sie freuten sich auf diesen Nachmittag und hatten sich vorgenommen, Florian zu sagen, daß sie zusammenbleiben wollten – als richtige Familie mit Vater, Mutter und Kind.
Daniela hatte ein bißchen Angst davor, Florian diese Eröffnung zu machen. Immerhin waren sie schon seit etwas mehr als drei Jahren allein und hatten niemanden vermißt. Insgeheim befürchtete die junge Frau, daß Florian am Ende eifersüchtig auf den Mann sein könnte, den er bis jetzt so offensichtlich anschwärmte. Aber sie wollte sich Peter gegenüber nichts davon anmerken lassen, weil sie fürchtete, er könne am Ende traurig deswegen sein.
Als könne er Gedanken lesen, sagte er in seiner treuherzigen Art: »Ich denke schon die ganze Zeit darüber nach, wie wir es Florian am besten sagen.«
»Ich auch«, gab sie leise zurück und sah unsicher zu ihm hinüber. Da hielt er einfach den Wagen an und neigte sich ihr zu. Er legte den Arm auf die Rücklehne ihres Sitzes und sah sie fest an.
»Ich liebe dich, Daniela. Ganz gleich, was Florian zu uns beiden sagt – ich liebe dich und werde dich immer lieben. Es gibt eine Entscheidung, die wir Florian überlassen müssen, jedenfalls zum größten Teil. Aber ich möchte dir jetzt schon sagen, daß ich um unser beider Glück kämpfen werde, auch, wenn es gegen Florian geht. Zu guter Letzt ist es ja auch für Florian, wenn wir ihm ein geordnetes Zuhause bieten können, wenn wir ihm bewiesen haben, daß er nichts verliert, sondern einen Vater gewinnt. Einen Vater, der ihn liebhaben möchte, wenn Florian es ihm nur erlaubt.«
»Ich weiß, Peter. Ich wünsche mir so sehr, daß Florian sich nicht gegen unser Glück sperrt. Aber selbst, wenn er im Anfang eifersüchtig sein sollte, habe ich nicht die Absicht, dem nachzugeben. Ich weiß, daß unser beider Liebe ausreichen wird für ein ganzes Leben, für ein Leben mit Florian.«
»Ich bin froh, daß du so denkst«, sagte er einfach, schenkte ihr noch einen strahlenden Blick und brachte den Wagen wieder in Gang. Sie sprachen nicht mehr miteinander, bis Peter den Wagen auf den Parkplatz der Klinik gebracht und abgestellt hatte. Er ging um den Wagen herum, Daniela herauszuhelfen. Und als sie so klein und zierlich und zerbrechlich vor ihm stand, da lächelte er auf sie hinab und nickte.
»Wir werden es schon meistern, Daniela. Und nicht nur wir beide, sondern wir alle drei.«
»Ich bin sehr froh, daß du mir das sagst, Peter. Ich danke dir für diese Worte. Sie geben mir Kraft und Zuversicht.« Mehr brauchte Daniela nicht zu sagen. Alles andere konnte Peter in ihren Augen lesen. Und das machte ihn sehr glücklich.
So standen sie endlich beide strahlend vor Florian, der fertig angekleidet war und augenscheinlich schon ungeduldig auf sie gewartet hatte. Er sah sie strahlend an und sagte dann zufrieden: »Ich habe mir so sehr gewünscht, ihr solltet beide kommen. Und nun seid ihr beide da.«
Daniela schloß ihren Florian glücklich in die Arme. Dann sah sie zu, wie er sich kameradschaftlich von den anderen verabschiedete und ihnen wünschte, daß auch sie bald nach Hause zurückkonnten. Danach aber konnte ihn nichts mehr halten. Ungeduldig zerrte er am Arm seiner Mutter und sagte drängend: »Komm schon, Mami, ich kann es kaum erwarten! Jetzt sollten wir so schnell wie möglich die Klinik verlassen.«
Sie verabschiedeten sich von Schwester Dorte und standen dann vor Hanna, die Florian lächelnd ansah und ihm die Hand schüttelte.
»Ich mag es gar nicht, meinen kleinen Patienten allerhand mit auf den Weg zu geben, wenn sie entlassen werden können.« Freundlich nickte sie Florian zu. »Das meiste, was ich sage, haben sie schon vergessen, wenn sie durch den Ausgang marschiert sind. Dir aber möchte ich doch anraten, nächstens auf das zu hören, was deine Mutter dir sagt. Sie meint es nämlich nur gut mit dir.«
Florian erwiderte ihren ernsten Blick auf die gleiche Weise und gab zurück: »Mami meint es immer gut mit mir, das weiß ich doch. Ich werde auch nie wieder glauben, daß sie es mit ihrer Sorgen um mich übertreibt.«
»Na, wenn das so ist, mein Sohn, brauche ich mir ja wohl kaum Sorgen um dich zu machen. Dann wirst du in Zukunft der folgsamste Junge sein, den wir in Ögela auftreiben können, was?«
»Nun ja, was die Folgsamkeit betrifft, da möchte ich nichts dazu sagen. Aber wenn du meinst, Dr. Hanna, ob ich noch einmal aufs Eis gehe, dann kann ich dazu nur ganz klar und deutlich nein sagen.«
»Schön, damit haben wir ja auch eine Menge gewonnen, oder?« sagte Hanna und gab ihm einen kleinen Klaps auf die Schulter.
Sie drückte Daniela fest die Hand und sagte, indem sie sich Peter Michalke zuwandte: »Sie werden Frau Redlich sicher helfen, Herr Michalke, nicht wahr? Für eine alleinerziehende Mutter ist es manchmal nicht so leicht, wie man sich das vorstellen mag.«
»Es ist eine wunderschöne Aufgabe, ein Kind großzuziehen, Frau Dr. Martens«, sagte Peter in seiner bedächtigen Weise. »Ich werde Daniela dabei helfen, wenn Florian uns beiden dazu eine Chance gibt.«
Der Junge sah aufmerksam und fragend von einem zum anderen. Man merkte ihm deutlich an, daß er das alles nicht so recht begreifen konnte und sicher noch viele, viele Fragen hatte. Aber das ging Hanna nichts mehr an. Das mußten sie untereinander aushandeln. Aber sie ahnte, daß diese drei Menschen, denen sie lächelnd nachschaute, bald eine sehr glückliche kleine Familie sein würden, die wie Pech und Schwefel zusammenhalten würde.
*
»Menschenskind, hier entlang geht es doch gar nicht nach Hause!« wollte Florian gerade eben sagen, aber da hielt Peter Michalke seinen großen, schönen Wagen schon vor dem hübschen Haus an. Er ließ Daniela und Florian aussteigen und sah lächelnd auf den Buben hinab.
»Bei mir ist so viel Platz, daß wir dachten, wir halten hier eine kleine Feier miteinander ab«, erklärte er und setzte noch betont hinzu: »Und hier sind auch keine neugierigen Leute, die uns nur stören würden. Hier sind wir drei ganz ungestört. Ich dachte, das würde dir auch besser gefallen.«
»Oh, ich finde das großartig. Jetzt kann ich es Ihnen ja sagen – ich habe mir so sehr gewünscht, Ihr Haus kennenzulernen. Es scheint viel größer zu sein, als ich geglaubt habe.«
Florian sah beinahe andächtig auf das schöne Haus, in den großen, verschneiten Garten. Unwillkürlich suchte er die Hand seiner Mutter und hielt sie fest. Es war, als spürte der Junge, daß seine Mutter und Peter Michalke ihm etwas ganz Wichtiges sagen wollten.
Mit großen Augen folgte Florian Daniela in die herrlich modern eingerichtete Küche und sagte endlich, nachdem er sich von seiner Überraschung ein wenig erholt hatte: »Oh, Mami, es ist ja beinahe, als gehörtest du hierher!«
Da nahm Daniela ihren Jungen fest in die Arme und sagte ernsthaft: »Nicht nur ich, Florian, wir beide werden sehr bald schon hierhergehören. Herr Michalke und ich haben nämlich beschlossen zu heiraten. Und ich finde, du solltest das jetzt erfahren, damit du uns fragen kannst, was du wissen willst.«
Florian blieb erst einmal eine ganze Weile still. Dann legte er beide Arme um den Nacken seiner Mutter und sagte ernsthaft: »Jetzt kann ich es dir ja sagen, Mami – ich habe mir gewünscht, daß du und Herr Michalke heiratet. Dann brauchen wir uns nicht mehr von ihm zu trennen. Und wir könnten dann mit ihm zusammen in diesem schönen Haus wohnen. Du weißt doch, daß er einen richtigen Swimmingpool anlegen will, nicht?«
Florian folgte seiner Mami ins große Wohnzimmer, sah sich bewundernd um und lief dann auf Peter zu. Er drückte sich an ihn und fragte aufgeregt: »Sind Sie dann mein Vater?«
Peter lachte leise auf und zog den Jungen zu sich auf die breite Couch. Er ließ seinen Arm um seine Schulter liegen, als er erklärte: »Nur, wenn du es auch möchtest, Florian. Weder deine Mami noch ich wollen dich zu irgend etwas zwingen.«
»Aber das tut ihr doch auch gar nicht.« Florian lachte und weinte zugleich. »Ich möchte, daß Sie mein Vater werden, Herr Michalke. Nein, Vati. Ich muß doch dann Vati zu dir sagen, nicht?«
»Du mußt gar nichts, Florian. Das einzige, worum Mami und auch ich dich bitten, ist, daß du dir Gedanken darüber machst, ob du es willst.«
»Wie könnt ihr mich so etwas fragen?« rief der Junge aufgeregt aus und sah von Peter zu Daniela und wieder zurück zu Peter. »Ich habe es mir gewünscht. Ich habe mir, seit ich dich kenne, gewünscht, du solltest mein Vater sein. Ich finde dich prima. Und ich glaube, mit dir könnte ich alles besprechen. Das kann man mit Mami auch. Sie ist einsame Spitze. Aber manchmal habe ich mir doch sehr gewünscht, wieder einen Vater zu haben.«
»Dann – darf ich das so verstehen, daß du einverstanden bist, daß Mami und ich heiraten und…«
»Es ist herrlich«, sagte Florian, als Peter eine Pause machte und ihn fragend ansah. »Ich finde es herrlich. Ich kann kaum glauben, daß es wirklich und wahrhaftig wahr sein soll.«
»Du wirst dich schon daran gewöhnen, wart’s nur ab. Morgen zeige ich dir den Garten. Manche Leute sagen, er sei so groß wie ein Park. Und ich zeige dir auch die Stelle, wo der Pool hin soll. Du kannst, wenn es so weit ist, gern dabei helfen. Aber zuerst machen wir eine Zeichnung. Dann kannst du von Anfang an miterleben, wie der Pool entsteht.«
»Ach, ihr wißt ja gar nicht, wie glücklich ich bin. Eigentlich ist es doch ganz gut, daß ich ins Eis eingebrochen bin, oder? Ohne meinen Unfall hätten wir dich gar nicht kennengelernt.«
Zuerst sahen Peter und Daniela ihren Jungen sprachlos an.
Dann aber lachten sie beide, und Peter fand: »Es heißt immer, daß man alles von zwei Seiten aus betrachten kann. Du bist der lebende Beweis dafür, Florian.«
»Wie meinst du das?« fragte Florian unsicher. Aber Peter strich ihm nur kameradschaftlich über die Schulter und sagte abschließend: »Ach, ich glaube, das erkläre ich dir später. Jetzt kann ich das nicht, denn dazu bin ich viel zu glücklich.«
»Ich auch«, sagte Florian einfach. Aber er brauchte auch nicht viel mehr zu sagen, denn man sah ihm an, daß er sich rundherum glücklich und wohl fühlte.
Sie blieben bis nach dem Abendbrot. Dann brachte Peter seine kleine Familie, wie er sie schon lächelnd nannte, heim. Und dort erlebten sie eine völlig aufgelöste Roberta Stender, die jammerte und weinte und ganz augenscheinlich völlig verzweifelt war und den Kopf verloren hatte.
Während Daniela und Peter versuchten aus ihr herauszubekommen, was geschehen war, schlich sich Florian in die offenstehende Wohnung, kam aber schon nach einigen Minuten wieder zum Vorschein und zupfte seine Mutter am Ärmel.
»Es ist Bärbel«, sagte er erschreckt und wies mit dem Finger in die Wohnung, deren Tür nun weit offen stand. »Sie liegt da und gibt keinen Mucks mehr von sich.«
»Sie ist ausgerutscht und mit dem Kopf auf die Tischkante gefallen. Und nun rührt sie sich nicht mehr. Oh, Frau Redlich, was soll ich nur tun?«
»Haben Sie nach dem Notarzt telefoniert?« fragte Daniela und versuchte, so beherrscht wie möglich zu klingen, während Peter schon hineingegangen war, um nach Bärbel zu schauen.
»Notarzt? O Gott, nein, auf diesen Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen.« Roberta weinte bitterlich und verzweifelt auf. »Ich weiß ja gar nicht, wo mir der Kopf steht. Wieso eigentlich Notarzt? Bärbel muß doch wieder aufwachen. So schlimm kann es doch gar nicht sein.«
Sie betraten die Küche, in der Peter Michalke eben die immer noch bewußtlose Bärbel aufhob und ins Wohnzimmer trug, wo er sie auf die Couch legte. Daniela warf nur einen Blick auf das leblose Mädchen, ging zum Telefon und wählte den Notruf. Sie sprach einige Worte, und dann legte sie auch schon wieder auf.
»Der Notarztwagen wird gleich hier sein«, sagte Daniela tröstend. »Wollen Sie nicht ein paar Sachen für Bärbel zusammenpacken, Frau Stender? Es wird nicht lange dauern, bis man Bärbel abholen kommt.«
Sie zog die lamentierende Frau aus der Küche ins Kinderzimmer und fragte: »Wo hat Bärbel ihre Sachen? Ich werde sie herauslegen, damit Sie sie einpacken können. Bitte, Frau Stender, nehmen Sie sich zusammen, damit wir alles für Bärbel fertig haben, wenn der Notarzt kommt.«
Roberta ging schluchzend im Kinderzimmer hin und her. Und drüben, im Wohnzimmer, fragte Florian seinen neuen Vater ängstlich: »Lebt sie eigentlich noch? Sie sieht aus, als sei sie schon tot.«
»Das sieht nur so aus. Ohnmächtige Leute machen immer einen solchen Eindruck. Aber Bärbel ist nicht tot. Sie hat nur durch den Sturz das Bewußtsein verloren. Vielleicht hat sie eine Gehirnerschütterung. Ich bin mir da eigentlich ganz sicher. Aber das müssen die Ärzte feststellen.«
»Ich finde dich ganz toll, Vati«, sagte Florian und sah Peter schwärmerisch an. Peter wollte gerade eben etwas antworten, als man in der Ferne das Heulen des Martinhorns hören konnte. Aufatmend sah er auf Florian hinab und sagte erleichtert: »Da kommen sie schon. Jetzt kann man Bärbel sicher bald helfen.«
Es dauerte wirklich auch nur Bruchteile von Sekunden, bis Dr. Frerichs und Martin Schriewers erschienen. Dr. Frerichs brauchte Bärbel erst gar nicht ausgiebig zu untersuchen. Er sah sie nur kurz an, hob ihre Augenlider und nickte Martin kurz zu. Sie hoben Bärbel gemeinsam auf die mitgebrachte Trage. Dann erst wandte sich Dr. Frerichs der immer noch schluchzenden Roberta zu.
»Scheint eine Gehirnerschütterung zu sein. Gottlob hat sie keinen Schädelbruch. Das können wir als sicher ausschließen, denn sie blutet nicht aus der Nase, aus dem Mund oder sogar aus den Ohren. In spätestens zehn Tagen haben Sie Ihre kleine Tochter wieder hier, Frau Stender. Wollen Sie mit in die Klinik Birkenhain kommen?«
»Natürlich will ich das!« Roberta warf dem jungen Arzt einen fast empörten Blick zu. Dann sah sie Daniela an und nickte ihr zu. Sie legte ihr die Hand auf die Schulter und sagte: »Danke, Frau Redlich. Vielen, vielen Dank. Sie kümmern sich um alles, ja? Ich – ich fahre mit Bärbel in die Klinik.«
»Natürlich. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich mache das schon«, beruhigte Daniela die aufgeregte Frau, aber Roberta hastete schon die Stufen hinab. Sie hörte gar nicht mehr auf das, was Daniela ihr sagen wollte.
»Ich bin unendlich froh, wenn ihr, du und Florian, zu mir ziehen könnt«, sagte Peter endlich, nachdem sie Danielas Wohnung betreten hatten. »Dort haben wir alle unsere Ruhe und können uns unseres Lebens freuen.«
»Ich weiß nicht, wer mir mehr leid tut – Frau Stender oder die kleine Bärbel, die so unglücklich gestürzt ist.«
»Manchmal greift das Schicksal zu ziemlich drastischen Mitteln, findest du nicht auch?« fragte Peter endlich mit feinem Lächeln. Und Florian ergänzte altklug: »Vielleicht klatscht sie jetzt nicht mehr so viel wie sonst.«
Als sie sahen, daß Florian müde wurde, brachten sie ihn gemeinsam zu Bett. Peter meinte, als sie dicht nebeneinander auf der Couch im Wohnzimmer saßen: »Du willst doch auch nicht, daß wir lange mit der Hochzeit warten, oder? Ich finde, wir sollten gleich am Montag zum Standesamt gehen. Heiraten tun wir dann in Celle und fahren anschließend gleich in den Bayerischen Wald. Dort verbringen wir Weihnachten und Silvester, nehmen Florian mit und haben eine herrliche Hochzeitsreise in den Schnee, wenn du einverstanden bist.«
»Ich bin nicht nur einverstanden, Peter – ich bin ganz begeistert und kann es nicht mehr erwarten.« Sie errötete, als sie erkannte, wie es in seinen Augen aufblitzte.
»Dazu kann ich nur sagen, daß ich ebenso ungeduldig bin wie du«, sagte er nur und küßte sie auf den Mund.
Peter blieb noch, bis Roberta Stender aus der Klinik Birkenhain nach Hause kam. Da gingen sie hinüber und sahen sie fragend an. Roberta ließ sich seufzend am Küchentisch nieder und sagte aufatmend: »Bärbel hat wirklich nur eine Gehirnerschütterung erlitten. Sie ist auch schon wieder aus der Bewußtlosigkeit aufgewacht. Man will sie ungefähr zehn Tage in der Kinderklinik behalten. Sie muß ruhig liegen, damit sie nicht ihr Leben lang unter Kopfschmerzen leiden muß.«
»Wie kam es eigentlich zu diesem Unfall?« wollte Peter endlich wissen. Roberta sah durch ihn hindurch und murmelte: »Ich hatte es ihr gesagt. Sie hatte sich Wurst aus dem Kühlschrank genommen und eine Scheibe fallen lassen. Ich sagte ihr, sie solle sie aufheben, damit niemand auf ihr ausgleitet. Aber Bärbel hörte nicht. Und ehe ich mich bücken und die Wurst aufheben konnte, passierte es auch schon. Sie selbst glitt aus, konnte sich nicht mehr halten und fiel mit dem Kopf auf die Tischkante. Ich war wie gelähmt vor Entsetzen und konnte ihr nicht helfen. Kennen Sie das? Man will vorspringen und jemanden, der zu stürzen droht, auffangen, und die Beine machen nicht mit. Das war einfach gräßlich, das kann ich Ihnen sagen.«
»Denken Sie nicht mehr daran, Frau Stender«, sagte Daniela tröstend. »Bärbel ist bei den Ärzten in der Kinderklinik Birkenhain wirklich in den allerbesten Händen.«
»Sie sind alle beide so nett zu mir.« Robertas Lippen zitterten bedenklich, als sie fortfuhr: »Und dabei habe ich das wahrlich nicht verdient, denn ich habe doch ausgiebig über Sie beide geklatscht.«
»Ach, das.« Daniela winkte freundlich ab. »Es hat uns nichts ausgemacht, denn im Grunde genommen haben Sie ja recht behalten. Herr Michalke und ich werden nämlich bald heiraten. Und dann ziehe ich mit Florian natürlich aus.«
»Schade!« Man sah der guten Roberta deutlich an, daß sie es so meinte, wie es klang. »Ich habe Sie trotz allem doch sehr gern gemocht.«
»Nun, wenn wir auch hier ausziehen werden, so bedeutet das noch lange nicht, daß wir uns nicht gegenseitig besuchen können.« Daniela lachte sie freundlich an. Und da schien Roberta ihren größten Kummer schon fast überwunden zu haben, denn sie fragte eifrig: »Wirklich? Herrn Michalkes Haus ist eines der schönsten in Ögela. Ich war immer schon schrecklich neugierig darauf, zu erfahren, wie es von innen ist. Ich möchte zu gern wissen, ob es drinnen auch so schön ist wie draußen.«
»Davon werden Sie sich sicher eines Tages überzeugen können, Frau Stender. Jetzt aber sollten Sie sich zu Bett legen. Morgen haben Sie Ihre größte Angst um Bärbel schon besser überwunden und freuen sich, daß sie bald wieder bei Ihnen sein kann.«
»Danke«, stieß Roberta hervor, »danke Ihnen beiden. Das werde ich Ihnen nicht vergessen.«
»Schon gut, Frau Stender. Wir haben nur getan, was selbstverständlich war.« Daniela strich ihr noch einmal über die Schultern, Peter nickte ihr zu, und dann ließen sie sie allein.
*
Für Florian war es herrlich, daß Wochenende war. Nicht, daß er nicht gern in die Schule gegangen wäre aber die bevorstehende Hochzeit seiner Mutter mit Peter Michalke war doch in den Mittelpunkt seines Lebens gerückt.
Was konnte es auch im Leben eines Jungen wie Florian Wichtigeres geben als eben diese Heirat, die nicht nur das Leben seiner Mutter, sondern auch das seine völlig ändern würde?
Er freute sich auf das neue Haus, das er übers Wochenende mit Peter gemeinsam betrachten würde. Sie würden ein Zimmer aussuchen, das das seine werden sollte. Und sie würden durch den großen Garten wandern und den Platz aussuchen, an dem der Swimmingpool entstehen sollte. Sie hatten sich für dieses Wochenende eine ganze Menge vorgenommen. Und alles war schrecklich wichtig für den Jungen.
Dann und wann behauptete Daniela, halb lachend, halb ernsthaft, daß sie sich im Leben ihres Jungen zurückgesetzt fühlte. Aber dann sah Florian seine Mutter immer ganz entsetzt an. Und dann warf er sich förmlich gegen sie und sagte ernsthaft: »Du weißt ganz genau, Mami, daß es für mich nichts Lieberes gibt als dich. Du darfst aber nicht böse oder traurig sein, wenn ich auch Vati mag und mich freue, daß ich endlich jemanden habe, mit dem ich alles mögliche bereden kann, was Frauen nicht so interessiert und worüber sie auch nicht so gut Bescheid wissen.«
Dann küßte sie Florian lachend und sagte schnell: »Ich hab’s ja gar nicht so ernst gemeint, mein Kleiner. Ich bin auch froh, daß wir Vati gefunden haben. Unser Leben wird sich sehr verändern durch ihn, aber es wird ein schöneres Leben sein als das, das wir bisher hatten.«
»Und das war auch schön, Mami. Ich habe Vati nicht vermißt, weil ich ihn noch gar nicht gekannt habe. Aber jetzt, da ich ihn kenne, möchte ich auch, daß wir ihn behalten können.«
Dann strahlten sie einander an und wußten, daß sie beide neugierig waren auf das Leben, das vor ihnen lag.
Das Aufgebot war bestellt. Daniela und Peter »hingen im Kästchen«, wovon die Leute aus Ögela sich selbst überzeugen konnten. Außerdem sorgte Roberta Stender auch dafür, daß bekannt wurde, wie das Unglück mit Florian sich doch noch in ein herrliches Glück verwandelt hatte.
Roberta war eigentlich nie sonderlich beliebt in Ögela gewesen, weil sie mit nachtwandlerischer Sicherheit immer das herausbekommen hatte, was die meisten gern geheimgehalten hätten. Roberta hatte sich nicht nur nicht gescheut, unvorteilhafte Sachen zu erzählen – sie hatte sogar auch noch spürbare Freude daran gehabt, andere in schlechtes Licht zu versetzen.
Und genau das war es, was man ihr in Ögela immer sehr verübelt hatte. Jetzt, da Bärbel in der Klinik Birkenhain lag, jetzt, da Roberta Zeit hatte, über alles mögliche nachzudenken, jetzt spürte sie, daß sich mit und in ihr eine allmähliche Wandlung vollzog.
Mit einem Wort gesagt – die gute Roberta Stender hatte gelernt, auch das Gute in den Menschen zu sehen und hervorzuheben. Es kam immer öfter vor, daß sie nur positive Dinge erzählte. Und nun hörten ihr die Leute aus Ögela auch sehr gern zu.
Als Bärbel nach etwa zehn Tagen aus der Klinik entlassen werden konnte, holten Peter und Daniela sie gemeinsam mit Florian ab. Roberta wollte ihre kleine Tochter lieber daheim begrüßen und alles für die Willkommensfeier vorbereiten, bis sie mit ihr zurückkamen.
Es wurde ein wunderschöner Nachmittag bei Roberta Stender, und sie lernten nun einen völlig neuen Menschen kennen.
Florian hatte das Mädchen mit zu sich hinübergenommen und spielte mit Bärbel hingegeben Kaufladen. Er fand zwar, es sei ein reines Mädchen spiel, aber da Bärbel gerade eben erst aus der Klinik gekommen war, hatte er sich bereiterklärt, zu spielen, was sie sich wünschte. Niemals hätte er zugegeben, daß es ihm selbst auch Spaß machte.
Weil sie allein waren und keine Rücksicht auf die Kinder zu nehmen brauchten, sagte Roberta plötzlich, nachdem sie den Wein eingeschenkt hatte: »Finden Sie nicht auch, daß ich ein fürchterliches Scheusal gewesen bin?«
Daniela sah erst einmal zu Peter hinüber, aber er schaute sehr unsicher drein. Ehe Daniela etwas sagen konnte, fuhr Roberta schon fort: »Sie brauchen gar keine Rücksicht auf mich zu nehmen. Geben Sie es nur zu – ich bin wirklich ein Scheusal gewesen bisher, oder?«
»Nun«, zwang Daniela sich eine vorsichtige Antwort ab. »Ich gebe zu, daß der eine oder andere aus Ögela sicher schon manchmal recht wütend auf Sie gewesen ist, Frau Stender.«
»Das glaube ich auch. Nein, ich weiß es sogar. Und Sie können mir glauben, wenn ich Ihnen jetzt versichere, daß das anders wird. Ich habe eingesehen, wie schrecklich es ist, wenn man klatscht. Ich kann mich selbst nicht mehr verstehen. Wie kann ein Mensch nur Freude empfinden, wenn er andere kränkt und verletzt mit seinem Gerede? Aber es ist wie ein Zwang für mich gewesen, das kann ich Ihnen versichern. Ich weiß nicht, wieso – aber ich habe einfach nicht anders gekonnt. Ich habe auch über Sie und Herrn Michalke geredet, Frau Redlich. Es hat mir einfach Freude gemacht, schlecht von Ihnen beiden zu denken und es auch auszusprechen. Ich bin sogar aus dem Fleischerladen geflogen, weil ich nicht begreifen wollte, daß die Fleischersfrau recht hatte, als sie mich zurechtwies. Nein, nein, ich habe mich wirklich nicht von meiner besten Seite gezeigt.«
»Wozu reden wir überhaupt noch darüber? Es ist doch vorbei«, machte Daniela noch einen Versuch, Robertas Redefluß zu bremsen. Aber das war nicht möglich. Roberta sah sie und Peter ernsthaft an und sagte endlich: »Können Sie mir verzeihen? Ich meine – ich habe nachgedacht. Sie haben mir selbstlos geholfen, als ich wegen Bärbel total kopflos war. Da haben Sie nicht eine einzige Sekunde lang gezögert und sofort geholfen, Sie haben sich nicht zurückgezogen und mir vorgeworfen, daß derjenige, der andere durch sein Gerede kränkt, keine Hilfe und kein Mitgefühl erwarten kann.«
»Aber so ist es doch gar nicht, Frau Stender.« Peter sah sie ernsthaft an. »Sie waren in Not, Ihre kleine Bärbel war in Not, und wir, wir konnten nun eben mal helfen. Es wäre doch ganz schlimm von uns gewesen, wenn wir das nicht auch getan hätten, nicht wahr?«
»Ich weiß nicht – ich weiß wirklich nicht, wie ich mich verhalten hätte, wäre ich an Ihrer Stelle gewesen.«
»Da machen Sie sich mal keine Sorgen, Frau Stender. Sie hätten nämlich genau das gleiche getan wie wir. Und nun sollten wir besser gar nicht mehr davon reden, sondern zur Tagesordnung übergehen. Wir hoffen doch sehr, daß Sie uns bei unserem Umzug helfen.«
»Na, darauf können Sie sich aber fest verlassen. Dazu bin ich viel zu erpicht darauf, das Haus Herrn Michalkes auch von innen kennenzulernen.« Roberta sah sie beide an, und dann lachten sie plötzlich. Sie wußten, daß sie einander auch in Zukunft gut verstehen würden. Und – was noch wichtiger war – jeder von ihnen wußte, daß Roberta jetzt ihre Worte erst überlegen würde, ehe sie sie aussprach.
Die Kinder waren noch in ihr Spiel vertieft, als Daniela und Peter aus der Nachbarwohnung zurückkamen. Sie ließen sie noch ein Weilchen spielen, ehe sie fanden, es sei genug, weil Bärbel noch Ruhe brauchte und sich lieber hinlegen sollte. Florian brachte Bärbel nach drüben und versprach ihr, am nächsten Tag zu kommen und wieder mit ihr zu spielen.
Roberta strich ihm über das immer ein wenig wirre Haar und sagte freundlich: »Ich finde es großartig, daß du mit Bärbel spielst. Sie würde sich doch sehr langweilen, denn ich möchte nicht, daß sie in den Schnee hinausgeht. Wie leicht könnte sie fallen und mit dem Kopf irgendwo anstoßen. Man soll das Schicksal nicht herausfordern.«
Florian fand das zwar ziemlich übertrieben, aber er sagte nichts, denn gegen Erwachsene kommt man schlecht an, fand er, besonders dann, wenn sie sich Sorgen machen.
*
Peter Michalke erschien auf dem nächsten Elternsprechtag in der Schule. Jedermann wußte, daß er Daniela Redlich heiraten würde, nächste Woche schon. Sie fanden es völlig in Ordnung, daß er jetzt schon erschien. Und ganz begeistert waren sie, als Peter Michalke in seiner bedächtigen Art einen Vorschlag machte, der so einfach war, daß man sich hinterher fragte, warum man nicht schon längst auf die Idee gekommen war.
»Die Kinder von Ögela könnten einen richtigen Spielplatz brauchen. Um die Schule herum ist so viel Land, das brach liegt. Man könnte mit Hilfe der Kinder dort eine Anlage schaffen, die allen gerecht wird. Wir haben so viel Land, daß wir einen Platz einrichten können, auf dem ein winziges Biotop entsteht. Das würde unserer geplagten Umwelt zugutekommen. Wir können ein paar Klettergerüste anbringen, Wippen, Schaukeln und ein kleines Kinderkarussell. Unsere Jugend braucht etwas, wo sie spielen kann, ohne gleich in Lebensgefahr zu geraten.«
»Das wird nicht billig sein«, warf der Bürgermeister skeptisch ein. Er hatte einen Buben in Florians Klasse. »Die Idee ist, wie ich gern zugeben will, ausgezeichnet. Aber wer soll das bezahlen?«
»So teuer wird das alles gar nicht. Wir sammeln für das Baumaterial. Da kommt bestimmt was zusammen, wenn wir auch die anderen Eltern ansprechen. Ich meine, wenn wir alle zusammenarbeiten, sollte alles bis Ostern fertig sein.«
Es gab, wie bei allen einschneidenden Neuerungen, eine heftige Diskussion. Das mußte sein, denn viele fanden, daß das dazugehörte. Und Ordnung mußte nun einmal sein. Am Ende beschloß man, in Zusammenarbeit mit den Eltern der Schüler anderer Klassen die Sache in Angriff zu nehmen. Die Oberaufsicht sollte Peter Michalke haben, denn er war schließlich der Fachmann. Ihm und seinen Anweisungen sollte unbedingt Folge geleistet werden.
Als sie am nächsten Tag in Danielas Wohnung darüber sprachen, sagte Florian, während er Peter strahlend ansah: »Mensch, Vati, du bist echt stark. Das ist genau das, was wir brauchen. Wie bist du nur darauf gekommen?«
»Ob du es mir nun glaubst oder nicht, mein Sohn – ich bin auch einmal ein Junge gewesen und zur Schule gegangen. Wir hatten nur den Schulhof, und da konnte man eigentlich kaum etwas Vernünftiges unternehmen. Schon als Junge habe ich gedacht, daß man aus einem Schulgelände doch viel mehr machen könnte als nur einen gepflasterten Schulhof.«
»Wenn ich das den anderen sage, sie werden genauso begeistert sein wie ich!« sagte Florian und warf Peter wieder einmal einen seiner schwärmerischen Blicke zu, die Peter jedesmal das Herz erwärmten.
*
Der Hochzeitstag war gekommen. Sie hatten versucht, ihn geheimzuhalten. Sogar Roberta Stender hatte dichtgehalten, obwohl man sie immer wieder gefragt hatte, ob sie denn gar nichts Genaueres wußte. Sie hatte es genossen, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen, aber sie hatte dichtgehalten.
Sie war stolz auf sich selbst und berichtete immer wieder von den neugierigen und drängenden Fragen.
Sie konnten in aller Stille in Lüneburg heiraten, so, wie sie es sich vorgenommen hatten. Und es dauerte auch nicht lange, bis sie in Peters Wagen saßen und zur Hochzeitsreise aufbrachen.
Während sie fröhlich und singend in ihren Urlaub fuhren, rätselte man noch in Ögela. Und am späten Nachmittag, als Roberta Stender noch einmal zum Bäcker ging – sie hatte zwar alles daheim, aber sie wäre geplatzt, wenn sie jetzt nicht hätte reden dürfen – und dort prompt auch auf einige Frauen traf, die sie gleich umringten und wissen wollten, wann das freudige Ereignis stattfinden sollte.
Die gute Roberta schien ordentlich zu wachsen, als sie sich emporrichtete und dann ruhig erklärte: »Aber die Hochzeit hat heute stattgefunden.« Sie machte eine großartige Geste, als sie auf ihre Armbanduhr schaute. »Sie werden jetzt sicher schon auf Hochzeitsreise sein.«
»Du hast es also die ganze Zeit über gewußt, Berta«, sagte die Bäckersfrau empört. Roberta warf ihr einen vernichtenden Blick zu, denn sie mochte es gar nicht, wenn man sie Berta nannte.
»Ja«, sagte sie spitz, »ich hab es die ganze Zeit über gewußt. Aber die Brautleute hatten mich gebeten, nichts zu verraten, weil sie in aller Stille heiraten wollten.«
»Und ich wollte eine Torte schicken!« murrte die Bäckersfrau. Roberta hob die Schultern und schlug vor: »Die kannst du auch noch schicken, wenn sie zurückkehren. Ich glaube, dann sind sie dir auch noch sehr dankbar. Übrigens werde ich die drei Wochen, die sie fortbleiben wollen, dazu benutzen, den Umzug zu organisieren. Die jetzige Frau Michalke hat mir nämlich den Schlüssel zu ihrer Wohnung deswegen dagelassen, und ihr Mann den Schlüssel zu seinem hübschen Haus. Ich werde alles organisieren.«
»So was aber auch!« staunte eine andere. »Ich hätte nie gedacht, daß du mal so dichthalten könntest, Roberta.«
»Tja, so kann man sich in einem Menschen irren, was? Man ist schnell mit dem Urteil bei der Hand und findet es hinterher ziemlich peinlich, wenn man öffentlich zugeben muß, daß man sich geirrt hat, oder?«
Sie verlangte zehn Hefeteilchen, obwohl sie die gar nicht brauchte. Aber man hatte ja eine modern eingerichtete Küche und konnte alles einfrieren.
Zufrieden marschierte Roberta Stender nach Hause. Sie hatte ihren Triumph gehabt und ihn weidlich ausgekostet. Das macht unendlich zufrieden, fand sie und schloß mit einem fröhlichen Seufzer ihre Wohnungstür auf.
*
Später würden sie einmal sagen, daß ihre Hochzeitsreise das Schönste war, was sie sich hatten vorstellen können. Auch Florian war begeistert und fand seinen Vati einfach umwerfend.
Wenn sie einmal nicht in den Schnee mochten, weil der Wind zu eisig war, saßen sie in der Gaststube der kleinen Pension, in der sie gelandet waren, und machten eifrig Pläne für den Kinderspielplatz.
»Das ist schon kein Spielplatz mehr, Vati, das ist ja eine riesige Anlage mit Mini-Golf und so.«
»Es ist ja auch genug Platz vorhanden. Sollst mal sehen, Florian, was wir daraus alles machen. Im nächsten Jahr haben wir viele Tiere da, die sonst kaum noch zu sehen sind.«
»Aber – woher kommen sie, wenn sie doch schon verschwunden sind?« wollte Florian wissen. Peter stützte den Kopf nachdenklich in die Hände und erwiderte: »Tja, so genau kann ich mir das auch nicht erklären. Ich weiß nur, daß es so ist. Manche behaupten, daß Tiere, die nicht den richtigen Lebensraum haben, einfach keine Jungen mehr aufziehen. Und dann verschwindet die Art natürlich. Aber sie haben sich noch ihre Instinkte bewahrt und scheinen zu spüren, wo es den richtigen Lebensraum für sie gibt. Jedenfalls sind sie plötzlich da und bleiben, wenn sie sich wohl fühlen.«
»Und was kann man tun, damit sie sich wohl fühlen?« wollte Florian wissen. Da lachte Peter auf, klopfte ihm auf die Schulter und gab zurück: »Ach, da braucht man nicht viel zu tun, Florian. Man muß nur den richtigen Lebensraum schaffen und abwarten. Das ist alles.«
»Bist du ganz sicher, daß du dich nicht irrst, Vati?« fragte Florian beinahe ängstlich.
»Ganz sicher«, bekräftigte Peter und lächelte Florian aufmunternd an. Tag reihte sich an Tag, und einer war schöner und beglückender als der andere. Aber die Tage vergingen auch wie im Fluge, und ehe sie es sich versahen, war der Urlaub vorbei. Sie hatten Weihnachten gefeiert und Silvester Hand in Hand dagestanden und dem Feuerwerk zugeschaut, bis Florian beinahe im Stehen eingeschlafen war.
Es war schon dunkel, als der große Wagen in Ögela ankam und wenig später vor dem hübschen Haus Peters stehenblieb. Über der Haustür brannte Licht, und als sie eintreten wollten, wurde die Tür weit aufgerissen, und eine strahlende Roberta erschien in ihrem Rahmen.
»Herzlich willkommen«, sagte sie fröhlich. »Ich bin eigens hiergeblieben, damit ich Ihnen noch Kaffee oder Tee machen kann. Ich habe auch etwas kalten Braten angerichtet. Leider wußte ich nicht, ob Sie unterwegs gegessen haben oder nicht.«
»Ach, wie schön, so herzlich willkommen geheißen zu werden«, sagte Daniela warm. »Sie haben alles großartig gemacht, Frau Stender. Dafür schulden wir Ihnen Dank.«
»Aber das habe ich doch gern gemacht. Bärbel hat mir übrigens sehr geholfen. Vor einer Stunde habe ich sie heimgeschickt, weil ich so gern auf Sie warten wollte und nicht wußte, wann Sie kommen.«
Sie verschwand in der Küche und holte das Abendbrot, das sie vorbereitet hatte. Dann deckte sie im Wohnzimmer den Tisch und war überglücklich, als sie aufgefordert wurde, ebenfalls mit an den Tisch zu kommen und mit ihnen gemeinsam zu essen.
»Sie können das alles gar nicht allein schaffen, Frau Michalke«, sagte Roberta endlich entschlossen. »Ich weiß, daß Sie weiterarbeiten wollen. Da schaffen Sie es gar nicht, dieses große Haus und den wunderschönen Garten in Ordnung zu halten. Und deshalb habe ich mir überlegt, ob ich Ihnen nicht regelmäßig helfen sollte. Sie wissen, daß ich mit meiner kleinen Wohnung nicht viel Arbeit habe. Und wenn ich mir dann noch etwas hinzuverdienen kann, wäre das auch nicht zu verachten.«
Daniela war zuerst ein bißchen unschlüssig. Darüber hatte sie bisher noch nicht nachgedacht. Peter nahm ihr die Entscheidung ab. Er sah Roberta dankbar an und erklärte energisch: »Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag, Frau Stender. Wenn Sie mögen, können Sie gleich morgen bei uns anfangen. Meine Frau braucht erst in zwei Tagen zu arbeiten, und ich auch. So können wir alles noch miteinander besprechen, damit Sie wissen, wie wir es uns vorgestellt haben.«
Als Florian am nächsten Mittag aus der Schule kam und seine Mutter am Bürgermeisteramt abholte, sagte er aufgeregt: »Alle haben mich gefragt, wann wir anfangen mit dem Kindergelände. Ja, so heißt es in der Schule schon. Und ich habe gesagt, daß Vati und ich ihnen morgen Bescheid sagen werden.«
Eine Woche später hatte es den Anschein, als habe der Winter ein Einsehen mit den Plänen der Kinder von Ögela. Über Nacht war der Schnee fort, der Baggersee war abgetaut, es gab keine einzige noch so kleine Eisscholle mehr auf seiner ruhigen Oberfläche. Und der Boden war nicht mehr hartgefroren, sondern wurde mit jedem Tage weicher. Peter hatte mit dem Chef gesprochen, der ihm zugesagt hatte, ihm die Baumaschinen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Es arbeiteten bei dieser Firma mehrere Männer, deren Kinder in Ögela zur Schule gingen. Für die war es natürlich Ehrensache, sich dieser guten Sache kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Beinahe ganz Ögela war auf den Beinen, als die Arbeiten begannen. Und da war so mancher, der in die Hände spuckte und mit zupackte.
»Wenn es so weitergeht, wie es heute angefangen hat, werden wir ganz bestimmt pünktlich zu Ostern mit allem fertig sein«, sagte Peter am Abend zufrieden. Und Florian erzählte, wie begeistert seine Mitschüler waren, und daß sie alle etwas dazu beitragen wollten, damit das Gelände auch wirklich so schön wurde, daß sogar die Erwachsenen sich dort gern aufhielten. Sie hatten vorgeschlagen, Bänke aufzustellen. Jedermann hatte diesen Vorschlag begeistert aufgegriffen. Es meldeten sich in den nächsten Tagen Geschäftsleute aus Ögela, die sich alle darum bewarben, eine Bank aufzustellen. Am schwarzen Brett in der Gemeindeverwaltung hing nämlich eine Information, aus der hervorging, daß auf jeder Bank, die gestiftet wurde, auch ein Schild angebracht werden sollte, auf dem stand, wer die Bank gestiftet hatte. Konnte man sich eine bessere Reklame wünschen, die dazu nicht einmal allzuviel kostete und von der Steuer abgesetzt werden konnte?
Den Skeptikern zum Trotz, die vorhergesagt hatten, daß alles doch nur ein Strohfeuer war, blieb die Begeisterung bestehen. Sie kamen viel besser voran, als sie geglaubt hatten. Man konnte bald schon merken, daß auf dem sich weithin streckenden Gelände gearbeitet wurde. Büsche wurden gepflanzt. Schließlich war es jetzt die beste Jahreszeit dazu. Natürlich wurde auch Rasen eingesät, aber jedermann war sich klar darüber, daß das ganz bestimmt nicht der berühmte englische Rasen wurde, sondern eine Fläche, die man verwildern lassen wollte. Peter Michalke, den alle als Berater anerkannt hatten, wälzte Bücher, um sich darüber zu informieren, welche Umgebung zum Beispiel Rebhühner bevorzugten oder Teichhühnchen. Und unter seiner Anleitung entstanden mehrere Teiche, die nicht nur für Tiere sein sollten, sondern an denen sich die Kinder und alle Leute aus Ögela freuen konnten.
Es kamen die ersten Frühjahrstürme, aber keiner ließ sich davon abhalten, weiterzumachen. Je mehr Zeit verging, desto mehr merkte man, was man hier vorhatte. Die Kinder konnten schon ihre Klettergerüste benutzen, und auch die Wippen und Schaukeln waren geliefert worden. Viele Firmen hatten sogar nur einen kleinen Unkostenbeitrag verlangt, wenn sie nur ihre Firmenschilder leicht lesbar anbringen konnten. Und dagegen hatte niemand in Ögela etwas.
Daniela, Peter und Florian waren eine glückliche kleine Familie geworden. Peters Antrag, Florian adoptieren zu können, so daß der Bub auch seinen Namen trägen konnte, lief, und man hatte große Aussichten, daß er auch sehr bald genehmigt wurde. Der Einfachheit halber nannte ihn jedermann schon Florian Michalke, ganz gleich, ob Lehrer oder Schulkameraden. Florian war jedesmal wieder von neuem stolz, denn er verehrte Peter so sehr, daß er nur einen Wunsch kannte, nämlich den, ihm immer ähnlicher zu werden. Und dazu gehörte natürlich auch, daß er seinen Namen tragen konnte.
Das Frühjahr kam mit warmer Sonne und Vogelgezwitscher. Jedermann hoffte, daß auf dem Gelände der Kinder viele Vögel nisten würden, daß vielleicht auch einmal ein Pärchen darunter war, das man nicht alle Tage beim Brüten sehen konnte.
Überall blühten Krokusse und Primeln, die Tulpen und Narzissen hatten schon ihre ersten Spitzen aus der Erde gestreckt und würden sicher pünktlich zum Osterfest blühen. Ostern…!
Jedermann hatte das Gefühl, als sei es in diesem Jahr ein ganz besonderes Fest. Die Erwartung lag förmlich in der Luft, ohne daß man hätte sagen können, was man eigentlich erwartete. Vielleicht war das genau das, was man gemeinhin als Frühlingsgefühle bezeichnet und wobei man manchmal sogar ein bißchen mitleidig lächelt, weil nicht jeder Mensch das Glück hat, wahre Frühlingsgefühle zu entwickeln.
Peter Michalke arbeitete unermüdlich. Wenn er einmal nicht auf dem »Gelände« war, konnte man ihn ganz sicher in seinem eigenen großen Garten finden. Er hatte einen eifrigen Helfer an Florian gefunden und einen guten Freund, den er eigentlich normalerweise nicht beachtet hätte.
Dabei war alles so selbstverständlich, wenn man hinterher darüber nachdachte.
Begonnen hatte es damit, daß Heinrich Stender eines Abends vor dem Haus Peters gestanden und auf seine Frau gewartet hatte.
Zufällig war Daniela hinausgegangen und hatte ihn entdeckt. Sie ging sofort auf ihn zu und streckte ihm unbefangen und freundlich die Hand entgegen.
»Sie wollen Ihre Frau abholen, nicht wahr?« fragte sie und zog ihn einfach mit sich. Peter kam hinzu, und man unterhielt sich über Gartenarbeit, stellte fest, daß man den gleichen Geschmack hatte und fand einander besonders sympathisch. Heinrich Stender war öfter gekommen und nun regelmäßig da. Roberta behauptete manchmal halb gerührt, halb spöttisch: »Wer hätte das gedacht! Mein Heinrich, der immer ein wenig mürrisch war, der lieber ins Wirtshaus ging, als mit mir zusammen zu sein, arbeitet jetzt voller Begeisterung hier im Garten mit. Es geschehen wirklich Zeichen und Wunder.«
So kam es, daß die Stenders sich oft bei den Michalkes trafen, einander viel besser verstanden als früher und sogar ihre Liebe neu entdeckten. Darüber sprachen sie nicht. Nicht miteinander und nicht mit anderen. Aber sie selbst spürten, daß eine Wandlung mit ihnen vorgegangen war, die sie glücklich machte. Und andere spürten das ebenfalls und freuten sich mit ihnen.
Karsamstag war das »Gelände« fertig. Am ersten Osterfeiertag sollte die offizielle Einweihung sein.
Die Blumen blühten, die Bäume hatten dicke grüne Blätter, die Tannen grüne Spitzen, und es zwitscherte beinahe aus jedem Baum. Kein einziger Baum war gefällt worden. Im Gegenteil – man hatte noch neue, junge, dazugepflanzt und hoffte, daß bald noch mehr Nistplätze für alle möglichen Vogelarten geschaffen werden konnten.
Auf den breiten, bequemen, flachen Wegen, die sich wie natürlich in die Landschaft einfügten, standen in regelmäßigen Abständen Bänke. Nicht alle gleich oder ähnlich, sondern immer andere. Jeder, der eine Bank stiftete, hatte sie nach seinem eigenen Geschmack fertigen lassen. So gab es welche mit dicken, rauhen Lehnen und Armstützen aus Birkenholz, wieder andere aus Kunststoff und solche, die man gemeinhin als Parkbänke kannte.
Auf dem großen Schulhof, dem gepflasterten, sollte das Kinderfest stattfinden. Man hatte Würstchenbuden aufgestellt und solche, an denen man Brötchen und Kuchen kaufen konnte. Es gab zwei Bierstände und einen Eisstand.
Es gab sogar ein richtiges Festzelt, das die Freiwillige Feuerwehr von Ögela besorgt hatte, in dem am Abend, wenn die Kinder zu Bett gebracht worden waren, noch getanzt werden konnte.
Nicht nur die Bevölkerung von Ögela feierte, sondern auch die Leute aus der Kinderklinik Birkenhain nahmen teil, jedenfalls stundenweise. Hanna wechselte sich mit ihrem Bruder Kay ab, dann kamen Dr. Frerichs und Schwester Dorte, Martin Schriewers und Marike. Sie kamen immer paarweise, verschwanden wieder und machten Platz für die anderen, die auch am Fest teilnehmen wollten. Die Leute von Ögela waren stolz auf das, was sie da gebaut und gegraben und gepflanzt hatten. Aber der Held des Tages war zweifellos Peter Michalke, der schließlich die Idee zu allem gehabt hatte. Man klopfte ihm auf die Schulter, bis es ihn schmerzte. Aber am schönsten war, daß er und die strahlende Daniela erfuhren, daß Peter Florian nun adoptieren konnte. Seinem Antrag war stattgegeben worden.
Über diese Nachricht waren sie so glücklich, daß sie einander bei den Händen faßten und in die laue Frühlingsluft wanderten. Sie wollten jetzt erst einmal miteinander allein sein.
Sie wanderten durch das stille Ögela zu ihrem hübschen Haus. Und dort, im großen Garten, blieb Daniela stehen und lehnte sich an ihren Mann. Sofort schlossen sich seine Arme um ihre zarte Gestalt. Sie hob ihm das Gesicht entgegen, das er nur noch verschwommen in der Dunkelheit erkennen konnte. Aber er erkannte, daß sie selig lächelte.
»Du bist glücklich mit mir geworden, nicht wahr? Sag, daß du mit mir glücklich bist, Daniela«, flüsterte er ihr zu. Sie hob sich ihm entgegen. Sie küßten einander, lange, zärtlich und voller Sehnsucht. Aber dann drückte sie ihn ein wenig von sich fort und sagte leise: »Ich habe es mir für diese Stunde aufgehoben, Peter. Ich wollte es dir sagen, wenn wir beide ganz allein miteinander sind. Es ist nämlich – nun, wir werden noch ein Baby haben.«
Zuerst stand er ganz still da. Es war, als müsse er erst richtig begreifen, was sie ihm da gesagt hatte. Und dann nahm er sie wieder an sein Herz und flüsterte: »Wenn ich doch nur in die Zukunft sehen könnte!«
»So neugierig bist du darauf, zu erfahren, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?« fragte sie neckend. Aber da erwiderte er nur besorgt: »Nein, o nein, es ist mir völlig gleich, was es wird, Daniela, ob Junge oder Mädchen. Ich werde schreckliche Monate durchmachen, weil ich um dich Angst haben muß.«
Da erst begriff sie, was in ihm vorging. Sie hob die Arme, legte sie um seinen Hals und sagte beruhigend: »Du darfst keine Angst um mich haben, Peter. Schau, ich habe Florian doch auch gesund zur Welt gebracht und selbst keinen Schaden dabei genommen. Ich bitte dich, nicht daran zu denken, Peter. Es wird mir nichts geschehen und unserem Baby auch nicht. Ich weiß es.«
»Woher nimmst du nur diese Sicherheit, Daniela?« fragte er, und man merkte ihm deutlich an, daß er sich nur zu gern beruhigen lassen wollte.
Sie lächelte ihn an und sagte einfach: »Ich weiß es eben. Ich habe auch keine Angst. Du sollst auch keine haben, Peter. Angst, die nicht begründet ist, kann das Leben vergiften.«
»Ich will mich bemühen, sie zu unterdrücken.« Er sagte es schwer, als glaubte er selbst nicht daran, daß es ihm gelingen würde. Aber sie lachte nur und sagte, während sie ihm zärtlich über die Augen strich: »Sei ganz ruhig, Peter. So gemein und hinterhältig kann das Schicksal gar nicht sein, daß es dich zweimal so treffen will.«
Er verharrte in verblüfftem Schweigen, ehe er antwortete: »So habe ich es noch nicht betrachtet. Wenn ich es aber tue, kann ich nur sagen, daß du völlig recht hast. Nein, es kann mich nicht zweimal so treffen.«
Er holte tief Luft, so daß es beinahe wie ein Stöhnen klang, und sagte glücklich: »Manchmal frage ich mich, womit ich das alles eigentlich verdient habe. Ich habe die Frau gefunden, die ich über alles liebe, ich habe einen Sohn, der mich stolz und froh macht. Und ich werde noch ein Kind haben, auf das ich mich freuen kann. Ach, Daniela, ist das Leben nicht wunderschön? Aber um das erkennen zu können, muß man auch die Fähigkeit haben, das Schicksal anzunehmen und es nicht zu bekämpfen. Ich danke dir, Daniela. Du hast mich das Leben neu gelehrt.«
Eng umschlungen gingen sie zum Haus, das still und dunkel zwischen den Bäumen stand und augenscheinlich nur darauf wartete, daß sie eintraten.
Als sie nebeneinander im Bett lagen, schob Peter seinen Arm unter Danielas Kopf und zog sie an sich, so daß sie ihren Kopf auf seine Brust legen konnte. Zu reden brauchten sie nicht miteinander. Sie wußten auch so ganz genau, was der eine oder der andere dachte und empfand.
Noch als sie schon schliefen, lag ein Abglanz des seligen Lächelns auf beider Gesicht…