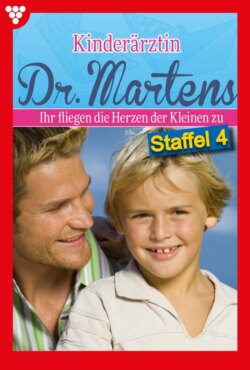Читать книгу Kinderärztin Dr. Martens Staffel 4 – Arztroman - Britta Frey - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Ich habe eine Überraschung für dich, über die du dich bestimmt freuen wirst, Mona«, sagte Alexander Bischoff an einem sonnigen Freitag, ein paar Tage nach dem Beginn der Schulferien, zu seiner Frau.
Die Blicke des großen breitschultrigen Mannes waren bei seinen Worten ebenso kühl wie das Lächeln, das dabei um seine Lippen spielte.
Überhaupt lag in der Gestik des schwarzhaarigen Mannes etwas Herrisches, Beherrschendes.
Mona Bischoff, eine hübsche junge Frau von sechsunddreißig Jahren, warf mit einer für sie typischen Kopfbewegung das lange hellblonde Haar in den Nacken und fragte mit gleichgültiger Stimme: »Eine Überraschung, über die ich mich freuen würde? Was sollte das wohl sein? Mach es nicht so spannend, ich möchte mit Manuela zum Arzt fahren. Du weißt ja, daß ich mir schon seit längerem große Sorgen um sie mache.«
»Du solltest deine Tochter nicht zu sehr verhätscheln, dann brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen.«
»Meine Tochter, du brauchst es nicht immer zu betonen, Alexander. Ich weiß schon lange genug, daß du das Mädel im Inneren deines Herzens, wenn du überhaupt ein Herz hast, ablehnst. Ich war nur zu dumm und naiv, diesen Umstand früh genug zu erkennen. Ich möchte mich aber nicht schon wieder darüber mit dir streiten. Sag, welche Überraschung du für mich bereithältst.«
»Gut, also hör zu. Ich muß zu Beginn der kommenden Woche in die Lüneburger Heide. Genauer gesagt, nach Celle, zu einer geschäftlichen Besprechung mit einem neuen Kunden. Ich habe mich dazu entschlossen, diese Geschäftsreise mit einem kurzen Urlaub zu verbinden. Du bekommst dadurch die Gelegenheit, außer deiner Mutter auch deine alte Heimat wiederzusehen. Vielleicht bekommt dieser Urlaub auch Manuela. So, das war es, was ich dir sagen wollte. Jetzt entschuldige mich bitte, ich muß noch einmal in die Firma fahren.«
Abrupt wandte sich Alexander Bischoff ab, und er verließ mit langen Schritten den großen Wohnraum. Hätte er auch nur noch einen einzigen Blick in das Gesicht seiner jungen Frau geworfen, ihm wäre der Schreck in ihrem schmalen Gesicht nicht verborgen geblieben.
Mona war nach seiner Eröffnung einige Sekunden wie erstarrt. Sie nahm noch nicht einmal bewußt wahr, daß er einen Augenblick später mit seinem Wagen davonfuhr. Hinter ihrer Stirn begannen die Gedanken zu arbeiten. Was hatte Alexander da gerade gesagt? Urlaub in der Heide wollte er mit ihr und Manuela machen?
Mona schloß die Augen, und ihre Finger krallten sich in die Lehne des Sessels, suchten daran Halt. Bilder aus ihrer Vergangenheit tauchten vor ihr auf. Sie war damals vierundzwanzig Jahre alt gewesen, als sie sich zum ersten Mal richtig verliebt hatte. Es war ihre erste große Liebe gewesen, als sie Gernot kennen- und liebengelernt hatte. All seinen Versprechungen und Liebesschwüren hatte sie blindlings vertraut. Gernot war als Montagearbeiter einer Schweißfirma nach Celle gekommen, wo er über einen Zeitraum von einem Monat einen Auftrag durchzuführen hatte. Es wurde ein herrlicher, unvergessener Monat für ihn und für Mona. Ein Abschied voller Tränen war gefolgt, bei dem Gernot ihr versprochen hatte, zu ihr zurückzukommen und dann auch mit ihren Eltern über eine Heirat zu sprechen. Alles hatte sie geglaubt.
Nach weiteren vier Wochen, die sie voller Ungeduld auf ihn gewartet hatte, um ihm ein süßes Geheimnis anzuvertrauen, war für sie der Sturz aus dem Himmel der Liebe in die Hölle der Schmach und Enttäuschung gekommen. Da Gernot sich nicht wie versprochen bei ihr gemeldet hatte, hatte sie über seine Firma seine Telefonnummer erfahren und versucht, ihn anzurufen. Doch nicht er hatte sich am Telefon gemeldet, sondern eine Frau, seine Frau. Damit war für sie alles zu Ende gewesen, ein Traum war zerbrochen. Nein, die durfte nicht an die Zeit denken, die danach gefolgt war.
»Mutti, du sagst ja gar nichts, was ist denn mit dir? Du wolltest doch heute noch mit mir zum Doktor fahren«, holte eine helle Mädchenstimme Mona jäh aus ihren Gedanken heraus.
Wie aus einem Traum erwachend sah Mona erst jetzt ihre Tochter vor sich stehen.
»Manuela, Liebling, ich habe gar nicht gehört, daß du ins Haus gekommen bist. Wolltest du etwas?« Mit einer liebevollen Geste fuhr Mona der Elfjährigen über die blonden, kurzgeschnittenen Locken.
»Ich hatte gesagt, daß du doch heute noch mit mir zum Doktor wolltest. Wann fahren wir denn endlich? Oder hast du es schon wieder vergessen?« Mit ihren hellen blauen Augen sah Manuela ihre Mutter an.
»Ich habe es ganz gewiß nicht vergessen, Liebling. Wir fahren in einer halben Stunden zu Dr. Hilbig, damit er dich noch einmal untersucht. Komm, setz dich zu mir, ich möchte dir zuerst etwas sagen.«
»Was denn, Mutti?« Neugierig sah Manuela sie an.
»Was würdest du denn dazu sagen, wenn wir mit Vati in den Urlaub fahren würden?«
»Mit Vati, Mutti? Warum denn nicht wir zwei allein? Vati ist immer so schlecht gelaunt, mit ihm macht es keinen Spaß. Ich habe längst schon gemerkt, daß er mich gar nicht leiden kann.« Die blauen Augen sahen Mona voller Traurigkeit an.
»Geh, Liebling, so etwas darfst du nicht denken. Vati hat dich bestimmt lieb. Er kann es nur nicht so zeigen. Außerdem wollen wir auch zur Oma in die Lüneburger Heide fahren. Die Oma magst du doch, oder?«
»Ja, die Oma hab ich sehr lieb, Mutti. Sie war schon so lange nicht mehr bei uns.«
»Na, siehst du, dann sehen wir sie bestimmt bald wieder. Es wird ganz bestimmt sehr schön werden. Jetzt gehst du zu Nina in die Küche und läßt dir von ihr ein Glas Milch geben. Danach fahren wir zu Dr. Hilbig. Einverstanden?«
»Ja, Mutti, mir ist auch wieder ganz komisch.«
Sorgenvoll sah Mona ihrer Tochter nach, die mit müden Schritten den Raum verließ. Manuela war sehr sensibel. Mit sicherem Instinkt fühlte ihr Mädchen, daß es von Alexander abgelehnt wurde, daß er ihm keine warmen Gefühle entgegenbrachte. Es war auch etwas, was sie selbst sich einmal anders vorgestellt hatte. Alexander hatte sie vor ungefähr elf Jahren geheiratet, obwohl er von Manuela wußte. Er hatte ihr versprochen, ihr ein guter Vater zu werden. Doch schon bald nach ihrer Heirat mit Alexander Bischoff, dem wohlsituierten Schuhfabrikant aus Nürnberg, war alles anders geworden. Sie hatte erkannt, wie kalt und gefühllos er in Wirklichkeit war. Doch da war es schon zu spät gewesen. Was einst Glück sein sollte, war wie eine Seifenblase zerplatzt. Um Manuela kümmerte er sich überhaupt nicht, und das traf sie tief. Mona sah es all die vergangenen Jahre als Strafe für etwas, was vor ihrer Heirat geschehen war und was sie seitdem Nacht für Nacht quälte und nicht mehr zur Ruhe kommen ließ.
*
Wie schon einige Male zuvor konnte Dr. Hilbig bei Manuela keine organische Erkrankung feststellen.
»Ich verstehe das aber nicht, Herr Dr. Hilbig: Warum fühlt sich Manuela denn immer so müde und schlapp? Es muß doch dafür einen Grund geben?« fragte Mona nach der Untersuchung.
»Ich würde Ihnen gern eine andere Auskunft geben, Frau Bischoff. Manuela ist nun mal ein sehr zartes Mädchen. Sie ist ein wenig blutarm, doch das kann man mit gewissen Aufbaupräparaten ausgleichen. Ich schreibe Ihnen da verschiedenes auf, was das Mädel regelmäßig einnehmen sollte. Kommen Sie am Montagmorgen noch einmal mit dem Mädel zu mir, damit ich eine Blutprobe entnehmen kann. Nach Möglichkeit sollte sie jedoch nüchtern sein. Wenn Sie schon vor acht Uhr kommen, braucht Manuela nicht zu warten. Mehr kann ich im Augenblick nicht tun.«
»Ich hätte noch eine Frage, Herr Doktor.«
»Ja, fragen Sie, Frau Bischoff.«
»Kann es schaden, wenn wir mit Manuela für ein paar Tage in die Heide fahren? Mein Mann möchte dort Urlaub machen.«
»Warum sollte es schaden, Frau Bischoff? Wann wollen Sie denn fahren?«
»Schon zu Beginn der kommenden Woche. Möglicherweise gleich am Montag.«
»Kommen Sie trotzdem vor Beginn Ihrer Reise kurz für die Blutentnahme vorbei. Das Ergebnis erfahren Sie, wenn Sie zurück sind. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein paar erholsame Tage. Und du, Manuela, freust du dich denn schon auf die Reise in die Heide?« wandte sich der grauhaarige Arzt mit einem gutmütigen Lächeln an die Elfjährige.
»Ja, wir fahren zu meiner Oma. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen.«
»Schön, Manuela, dann erhole dich recht gut, damit du wieder rote Wangen bekommst.«
Mona verabschiedete sich mit Manuela von Dr. Hilbig und verließ die Praxis.
*
Mona schaffte es wirklich übers Wochenende, sich auf die Urlaubsreise einzustellen. Die Koffer für Alexander, Manuela und für sich waren gepackt, als sie um sechs Uhr ins Erdgeschoß hinunterging. Zu Monas großem Erstaunen war auch Alexander schon unten und wartete auf sie.
»Ist das Mädel auch schon auf? Können wir gleich frühstücken, Mona?«
»Manuela schläft noch, und ich lasse sie auch noch eine Stunde schlafen. Dr. Hilbig hat gesagt, daß sie für die Blutentnahme nüchtern bleiben soll. Wir können also allein frühstücken. Ich mache für Manuela etwas zurecht und fülle eine Thermosflasche mit warmer Milch. Sie kann dann nach unserem Arztbesuch im Wagen frühstücken. Hat Nina den Kaffee schon fertig, oder soll ich mich darum kümmern?«
»Nina weiß Bescheid und wird den Kaffee sofort bringen. Ich muß gleich noch einmal kurz in die Firma. Ich hole euch aber pünktlich um halb acht hier ab. Sieh zu, daß du dann mit Manuela bereitstehst.«
»Guten Morgen, Frau Bischoff. Dann kann ja der Urlaub bald beginnen«, sagte in diesem Augenblick von der Tür her Nina, eine füllige Frau um die fünfzig herum, die zugleich Köchin und Mädchen für alles im Hause Bischoff war.
»Guten Morgen, Nina«, erwiderte Mona freundlich und fügte hinzu: »Ja, der Urlaub kann beginnen. Ich weiß ja, daß Sie auf alles achten werden und ich mich auf Sie verlassen kann. Setzen Sie sich zu uns und trinken Sie einen Kaffee mit uns. Manuela schläft noch, und mein Mann muß noch einmal in die Firma. Wenn Sie noch Fragen haben, können wir darüber reden.«
»Eigentlich ist ja alles klar, Frau Bischoff«, sagte Nina, nachdem sie auch für sich eine Kaffeetasse gefüllt und sich Mona gegenüber an den Tisch gesetzt hatte.
Kurz nach sieben Uhr ging Mona hinauf ins Kinderzimmer, um ihre Tochter zu wecken. Es tat ihr fast leid, Manuela in ihrem Schlaf zu stören, doch es mußte ja sein. Sie weckte ihr Mädel mit einem zärtlichen Kuß auf die Stirn.
»Manuela, Liebling, aufwachen, es wird Zeit zum Aufstehen.«
Verschlafen öffnete die Elfjährige die Augen. »Schon, Mutti? Ich bin doch noch müde.«
»Es tut mir leid, Liebling, aber du weißt doch, daß wir noch zu Dr. Hilbig müssen, bevor wir zur Oma fahren. Du darfst nachher im Auto weiterschlafen, wenn du möchtest. Ich packe extra für dich noch eine mollige Decke und ein Kissen in den Wagen. Nun aber rasch aus den Federn, damit wir fertig sind, wenn Vati uns abholt. Soll ich dir rasch helfen?«
»Ich kann das schon allein, Mutti. Du kannst ja noch meinen Kuschelbären in meine Tasche packen. Ich darf ihn doch mitnehmen, nicht wahr?«
»Natürlich, mein Liebling, ich habe nichts dagegen. Nimm nur nicht zuviel mit, denn so lange bleiben wir nicht in der Lüneburger Heide.«
»Darf ich noch etwas essen und trinken, Mutti?«
»Erst wenn Dr. Hilbig dir Blut abgenommen hat. Es muß sein, damit er genaue Untersuchungen durchführen kann. Ein knappes Stündchen kannst du es ja sicher noch aushalten, oder was meinst du?«
»Klar doch, Mutti, das geht schon.«
»Fein, ich bringe inzwischen die Sachen hinunter, und du beeilst dich mit dem Ankleiden. Waschen und Zähneputzen nicht vergessen, hörst du?«
»Vergesse ich doch nie, Mutti«, versicherte Manuela treuherzig.
»Dann bis gleich, ich warte unten auf dich. Du siehst ja, ich habe dir schon alles zurechtgelegt, was du anziehst.«
Ein zärtlicher Nasenstüber, und Mona ließ Manuela allein, damit sie ja pünktlich fertig wurde.
Es war ein hübsches Bild, als Manuela, fünf Minuten bevor Alexander kommen würde, die Treppe hinunterkam. Das pinkfarbene, duftige Sommerkleid mit dem breiten weißen Spitzenkragen paßte gut zu den hellblonden Locken.
Weiße Söckchen, dazu gleichfalls pinkfarbene Ballerinas vervollständigten das hübsche Bild, das die zierliche Person bot.
»Weiß Oma denn, daß wir kommen, Mutti?«
»Nein, es soll für Oma eine Überraschung werden.«
»Und was bringen wir Oma mit?«
»Wir besorgen in Celle einen großen Blumenstrauß. Während der langen Fahrt würden die Blumen nur verwelken.«
»Ach so, daran habe ich nicht gedacht, Mutti.«
Nina kam aus der Küche und brachte die Verpflegung für Manuela.
»Mein lieber Schwan, Manuela, du siehst heute wieder hübsch aus. Da wird sich deine Oma aber freuen.«
»Soll sie auch, Nina. Ich freue mich schon riesig, daß wir zu ihr fahren.«
»Das glaube ich dir. Bestell ihr von mir auch einen schönen Gruß. Machst du das?«
»Na, klar, Nina, das mach ich doch gerne.«
Bevor Nina noch etwas sagen konnte, rief Manuela: »Da kommt Vati ja schon. Ich habe sein Auto gehört.«
Sie hatte richtig gehört, denn einen Augenblick später betrat Alexander das Haus und fragte: »Alles bereit? Können wir?«
»Guten Morgen, Vati, wir warten doch schon auf dich.«
»Guten Morgen, Manuela, dann komm, wir müssen ja noch bei Dr. Hilbig vorbei.«
Kaum fünf Minuten später sah Nina winkend dem Wagen Alexander Bischoffs nach, bis er um die nächste Straßenecke bog und ihren Blicken entschwand.
*
Regine Hauser war mittelgroß und vollschlank und neunundfünfzig Jahre alt. Das noch immer volle dunkle Haar wies schon etliche silbergraue Strähnen auf. Die Mutter von Mona Bischoff war eine liebe, verständnisvolle Frau.
Mittags, nach dem Essen, unternahm sie fast jeden Tag einen Spaziergang, oder sie ging ein wenig in die Stadt zum Bummeln. Sie hatte sich nach dem Tod ihres Mannes vor über fünf Jahren an das Alleinsein gewöhnt. Nur manchmal, in stillen Stunden, hatte sie doch große Sehnsucht nach ihrer einzigen Tochter und nach ihrer kleinen Enkelin.
Es war Montag nachmittag, gegen siebzehn Uhr. Regine Hauser war in der Stadt gewesen, um neue Wolle für eine Handarbeit zu besorgen. Sie hatte vor, für Manuela eine hübsche Strickjacke anzufertigen. Sie bewohnte im Außenbezirk von Celle noch immer das kleine Einfamilienhaus, das ihr Mann in jungen Jahren mit seinen Eltern gebaut hatte.
Gerade hatte sie es sich mit einer Erfrischung im Garten unter einem Sonnenschirm bequem gemacht und ihr Strickzeug zur Hand genommen, als sie hörte, daß vor dem Haus ein Wagen hielt. Zuerst störte sie sich nicht daran, denn wer sollte schon den Weg zu ihr finden? Sie hörte eine helle Mädchenstimme lauf rufen: »Oma, Oma!« Da sprang sie wie elektrisiert hoch und eilte ins Haus, um die Haustür zu öffnen. Das war doch Manuelas Stimme gewesen! Voll freudiger Erwartung öffnete sie die Haustür, und im nächsten Augenblick sah sie das Mädchen auf sich zukommen.
»Oma, Oma, freust du dich, daß wir dich besuchen kommen? Wir bleiben ganz lange hier.«
Mit ihren Armen fing Regine Hauser ihre Enkeltochter auf und antwortete gerührt: »Das ist aber eine Überraschung, mein Schätzchen. Natürlich freue ich mich sehr, daß du deine Oma nicht ganz vergessen hast. Komm, laß dich mal genauer anschauen. Du bist ja ordentlich im letzten Jahr gewachsen. Bist aber ein bißchen blaß. Kommst wohl nicht genug an die frische Luft, oder?«
»Hallo, Mutti, grüß dich. Haben wir dich nun überrascht?«
Mona war nun bei der Mutter angelangt, gab ihr einen sanften Kuß auf die Wange und nahm sie liebevoll in den Arm.
»Wie schön, Mona, daß ihr endlich einmal den Weg zu deiner alten Mutter gefunden habt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber freue.«
Verstohlen wischte sie sich eine Träne aus den Augenwinkeln.
»Guten Tag, Mutter.« Kühl und distanziert begrüßte nun auch Alexander seine Schwiegermutter, mit der er sich nicht gut verstand.
»Kommt doch ins Haus, ich sorge sofort für Kaffee«, bat Regine.
»Es tut mir leid, aber ich kann nicht, ich muß mich sofort um die Hotelzimmer kümmern. Ich hole Mona und Manuela später ab.«
»Zimmer im Hotel, Alexander? Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Hier im Haus ist doch Platz genug für euch.«
»Ja, Vati, bitte, laß uns doch hier bei Oma wohnen.«
»Das geht nicht, denn ich habe jeden Vormittag geschäftliche Dinge zu erledigen. Das wird für Oma zu hektisch. Wenn du gern bei der Oma bleiben möchtest, gut, damit bin ich einverstanden. Mutti kommt dann jeden Morgen zu euch. Wenn ich Zeit habe, auch ich. So und nicht anders wird es gemacht.«
»Ja, ich will bei meiner Oma bleiben.«
Mona wußte, daß es sowieso keinen Sinn haben würde, Alexander zu widersprechen. Um eine Auseinandersetzung vor ihrer Mutter und Manuela zu vermeiden, gab sie auch dieses Mal wieder nach.
Regine Hauser war zwar sichtbar enttäuscht, sie sagte jedoch nur: »Du mußt es selbst wissen, Alexander. Ich freue mich jedoch darüber, daß Manuela bei mir bleiben darf.«
»Wann soll ich dich abholen, Mona?«
»Nach zwanzig Uhr, denn du kannst dir sicher vorstellen, daß Mutter und ich uns viel zu erzählen haben.«
»Einverstanden, dann fahre ich jetzt los, damit ich für uns noch vernünftige Zimmer bekomme.«
»Die Blumen, Vati, ich habe die Blumen für Oma im Wagen vergessen.«
»Dann komm mit zum Wagen und hole sie dir.«
Während Mona und ihre Mutter auf Manuela warteten, fragte Regine leise: »Es hat sich also seit meinem Besuch vor einem Jahr zwischen dir und Alexander nichts geändert, Mona?«
»Nein, Mutti. Laß uns darüber aber bitte reden, wenn Manuela schläft.«
»Es ist gut, Mona. Auf jeden Fall noch einmal herzlich willkommen daheim. Es hat lange genug gedauert.«
»Oma, Oma, schau nur, die Blumen sind für dich. Ich habe sie ganz allein aussuchen dürfen. Gefallen sie dir?«
Mit glänzenden Augen überreichte Manuela ihre Oma einen wunderschönen Strauß dunkelroter Nelken.
»Für mich? Die sind ja wunderschön, mein Schätzchen. Du hast genau meine Lieblingsblumen ausgesucht. Vielen Dank. Dafür bekommst du auch einen ganz dicken Kuß von mir.«
Liebevoll zog Regine das zierliche Mädchen in ihre Arme.
»Ich habe dich auch sehr lieb, Oma.«
»Ich dich doch auch, Manuela. Jetzt gehen wir erst einmal hinein. Wir schlagen sonst hier draußen noch Wurzeln. Du schaust mir auch ziemlich erschöpft aus. Es war sicher eine anstrengende Fahrt für euch.«
»Ich bin auch ganz müde, Oma.«
Als sie in dem kleinen, aber sehr gemütlich eingerichteten Wohnzimmer waren, ließ Regine Hauser Mona und das Mädel für ein paar Minuten allein, um sich in der Küche um den Kaffee und einen kleinen Imbiß zu kümmern. Für Manuela füllte sie ein Glas mit Limonade. Sie machte sich dabei so ihre Gedanken um Manuela, deren Aussehen ihr nicht recht gefiel. Sie mußte darüber unbedingt mit Mona reden. Es konnte ja immerhin möglich sein, daß das Mädel erst eine Erkrankung hinter sich hatte und aus diesem Grund so angegriffen aussah.
*
»Was ist mit der Kleinen los, Mona? War sie krank? Sie ist so blaß und hat dunkle Schatten unter den Augen. Es ist doch nicht normal.«
Mona erkannte die Besorgnis in den Augen ihrer Mutter und erwiderte: »Manuela war nicht krank, wenn du das meinst. Sie hat sich erst in der letzten Zeit so verändert. Ich habe schon ein paarmal einen Arzt aufgesucht, doch er hat bis jetzt nichts feststellen können. Erst gestern war ich bei Dr. Hilbig, unserem alten Kinderarzt. Zart und blutarm sei Manuela, mehr konnte er auch nicht sagen. Bevor wir heute die Fahrt hierher angetreten haben, waren wir noch zu einer Blutentnahme bei Dr. Hilbig. Er möchte einige Tests durchführen. Sofort, wenn wir wieder daheim sind, soll ich die Ergebnisse abholen. Glaube mir, ich mache mir Sorgen um mein Kind.«
»Und Alexander?«
»Für Alexander besteht kein Grund zur Sorge. Er sagt, daß ich Manuela zu sehr verhätscheln würde, sie zu einem Stubenhocker erziehe. Es stimmt aber nicht. Ich kann sie doch nicht an die Luft zwingen, wenn sie sich zu schlapp und müde fühlt. Dr. Hilbig hat mir Aufbaupräparate aufgeschrieben. Er sagte, daß es bei regelmäßiger Einnahme besser mit Manuela wird. Ich habe schreckliche Angst um sie. Ich würde es nicht ertragen, sie zu verlieren. Verstehst du mich?«
»Natürlich kann ich dich verstehen, Mona. Ich liebe das Mädel doch auch über alles. Du mußt daran glauben, daß sich Manuela recht bald wieder erholt. Was ich nicht verstehen kann, ist, daß du dich nicht von Alexander trennst. Wenn zwischen euch keine Liebe ist, dann möchte ich wissen, was euch noch aneinander bindet. Zumal er dir gegenüber ja auch sein Wort, Manuela ein guter Vater zu werden, nicht gehalten hat. Ich habe es vorhin bemerkt. Nicht ein Fünkchen Wärme war in seiner Stimme, als er mit ihr sprach. Was ist es also, Mona?«
»Ich weiß nicht, Mutter. Wenn ich mich von ihm trennen würde, hätte ich nicht mehr viel Zeit für meine Kleine, weil ich dann wieder arbeiten müßte. Wenn wir uns auch nicht lieben, so achten wir einander.«
»Das ist für mich kein Argument, Mona. Schließlich bin ich ja auch noch da. Hier in deinem Elternhaus wird immer Platz für euch sein. Ich mag Alexander nicht. Er ist sehr herrisch, hochtrabend und egoistisch. Alles Attribute, die ich bei einem Mann völlig ablehne. Ich würde in seiner Nähe frieren.«
»Ach, Mutti, ich weiß nicht, ob ich noch einmal auf die Dauer hier leben könnte. Die Erinnerungen an die Vergangenheit würden mich nur noch mehr quälen. Es ist auch so alles schon schlimm genug.«
»Du mußt die Vergangenheit endlich überwinden. Es läßt sich nun einmal nichts mehr ändern. Du hast elf Jahre Zeit gehabt, um dich mit den Konsequenzen deines großen Fehlers abzufinden.«
»Ich weiß, Mutti, aber ich schaffe es nicht, werde es niemals schaffen, solange ich lebe. Vielleicht bleibe ich auch aus diesem Grund bei Alexander. Es ist die Strafe für meine Vergangenheit. Ich werde sie auch weiter geduldig auf mich nehmen.«
»Das ist aber nun wirklich Unsinn, den du da redest, Mona, ich bitte dich. Ich glaube, daß du da oben in Nürnberg viel zuviel allein bist. Wenn ich nur nicht so ungern reisen würde, würde ich mich ja öfter bei dir sehen lassen. Es ist nur so, daß ich vor einem Jahr, als ich das letzte Mal in Nürnberg bei euch war, sofort gefühlt habe, daß ich von deinem Mann nicht gern gesehen war. Vielleicht kannst du dich überwinden und kommst jetzt öfter heim in dein Elternhaus.«
»Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Mutti.«
»Du mußt es versuchen. Ich werde im kommende Monat schon sechzig, und wer weiß, wie lange ich noch da bin. Obwohl ich mich an das Alleinsein gewöhnt habe, ist es nicht immer leicht für mich.«
»Du wirst uns noch lange erhalten bleiben, Mutti. Und was das andere betrifft, das wird uns die Zukunft zeigen. Jetzt bin ich ja mindestens eine lange Woche hier. Ich werde dafür sorgen, daß wir, so oft es eben möglich ist, zusammen sind. Und jetzt wollen wir nicht mehr von mir reden. Ich bin unwichtig. Wichtig ist für mich vor allen Dingen, daß Manuela sich recht schnell erholt. Ich sehe gleich mal nach oben und schaue nach, ob sie noch schläft. So matt wie heute war sie noch nie.«
»Es war bestimmt die lange Fahrt, die die Ursache für Manuelas Erschöpfung war.«
»Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, Mutti. Manuela hat doch fast die ganze Fahrt hinten im Fond des Wagens geschlafen. Ich fühle, daß es etwas anderes sein muß. Es geistert in meinem Kopf herum, aber ich kann es nicht in Worte fassen.«
»Warte die kommenden Tage noch ab, Mona. Wenn sich Manuelas Befinden verschlechtert, würde ich dir raten, mit ihr einmal in die Kinderklinik Birkenhain zu fahren. Das ist eine Kinderklinik nicht weit von hier entfernt, die erst vor ein paar Jahren eröffnet worden ist. Man hört über diese Klinik nur das Allerbeste. Jetzt geh und schau nach, denn eher bist du ja sowieso nicht beruhigt.«
Nachdenklich sah Regine Hauser hinter Mona her, die nun mit raschen Schritten die Wohnstube verließ. Sie war nicht sicher, ob sie ihre Tochter mit ihren Worten hatte beruhigen können. Sie selbst war ja auch in großer Sorge um ihre Enkeltochter. Sie mochte ebenfalls nicht so recht daran glauben, daß Manuela nur blutarm sein sollte. Dafür sah das Mädel zu schlecht aus. Irgendetwas stimmte da hundertprozentig bei dem Kind nicht. Man konnte eben nur abwarten.
Mona war schnell zurück.
»Nun, was ist, schläft Manuela noch?«
»Nein, Mutti, sie ist wach, will aber nicht aufstehen. Mir kommt es so vor, als ob die dunklen Schatten unter ihren Augen noch schlimmer geworden sind. Ich bringe ihr nachher eine Kleinigkeit zum Essen hinauf. Es ist kein besonders guter Beginn unseres Urlaubs.«
»Ich werde mich schon um Manuela kümmern, Mona, mach dir darum keine Sorgen. Du kannst ja noch einmal mit Alexander reden. Vielleicht ist er doch damit einverstanden, daß ihr bei mir wohnt.«
*
Regine Hauser bereitete für Manuela eine Hühnerbrühe, belegte eine Scheibe leichtes Weißbrot und ging damit hinauf in Monas altes Mädchenzimmer.
»So, Schätzchen, jetzt wird erst einmal etwas gegessen. Es wird dir ganz bestimmt gut schmecken«, sagte sie liebevoll zu der Elfjährigen, die ihr aus trüben Augen entgegensah.
»Ich mag aber nicht, Oma, ich habe überhaupt keinen Hunger.«
»Trink wenigstens die Hühnerbrühe, damit du wieder zu Kräften kommen kannst. Wir wollen doch morgen mit Mutti spazieren gehen.«
»Ich habe doch gesagt, daß ich nicht mag, Oma. Du tust gerade so, als ob ich ein Baby wäre. Laß mich doch«, entgegnete Manuela mit schwacher, aber gereizter Stimme.
»Ich meine es doch nur gut mit dir, Mädel. Du willst doch bestimmt nicht nur im Bett liegen, oder?«
»Ich kann doch nichts dafür. Meine Knie, meine Handgelenke, alles tut mir weh«, jammerte Manuela. »Mir ist überhaupt heute so komisch. Am liebsten möchte ich immerzu schlafen. Was ist das nur, Oma?«
»Ich weiß es nicht, Manuela. Sollst sehen, wenn du die ganze Nacht durchschläfst, fühlst du dich morgen früh bestimmt besser. Übrigens hat Vati eben deine Sachen mitgebracht. Willst du dir jetzt nicht deinen Schlafanzug anziehen? Ich hole deinen Koffer herauf und pack ihn aus. Das Essen lasse ich hier oben, vielleicht bekommst du später doch noch Appetit.«
»Nein, nimm es mit, Oma. Ich möchte wirklich nichts essen.«
»Wie du willst. Dann geh schon mal hinüber ins Bad, ich bin in wenigen Minuten wieder zurück.«
Mit leichtem Kopfschütteln nahm Regine Hauser die Tasse mit der Brühe und den Teller mit dem Schnittchen und verließ das Zimmer. Sie war betroffen von Manuelas Reizbarkeit. So kannte sie das immer liebe und anschmiegsame Mädel überhaupt nicht. Das war auch etwas, worüber sie mit Mona reden mußte.
Als sie nach wenigen Minuten mit Manuelas Koffer das Zimmer erneut betrat, saß die Elfjährige auf der Bettkante und hielt ein Handtuch vor ihr Gesicht gepreßt.
Regine Hauser stellte rasch den Koffer ab und fragte bestürzt: »Was hast du Schätzchen, was ist los mit dir?«
»Ich weiß es nicht, Oma. Ich wollte gerade aufstehen, da bekam ich wieder dieses verflixte Nasenbluten. Es hört aber schon langsam auf. Richtig blöd ist das.«
»Du sagst wieder, Mädel? Ja, sag mal, hast du das denn schon öfter gehabt?«
»Schon ein paarmal in der letzten Zeit.«
»Weiß die Mutti denn davon? Sie hat mir nichts davon gesagt.«
»Ich habe es Mutti noch nicht gesagt, weil es doch nie lange dauert. Ist das denn schlimm, wenn die Nase immer blutet?«
»Auf jeden Fall muß Mutti es wissen, Mädel. Komm, laß mich mal sehen. Du mußt deinen Kopf in den Nacken legen, dann hört es schneller wieder auf.«
Regine stützte mit einer Hand Manuelas Kopf und nahm das Handtuch fort. Wie das Mädel schon sagte, hörte das Bluten auf. Sie tupfte das verschmierte Gesicht ab und sagte: »Versuch bitte, den Kopf ein paar Minuten so zu halten. Ich hole rasch aus dem Bad einen Waschlappen, damit ich dein Gesicht richtig säubern kann. Ich helfe dir, deinen Schlafanzug anzuziehen, und danach legst du dich sofort wieder hin. Einverstanden?«
»Ja, Oma, meine Beine sind auch richtig zittrig. Als wenn da Pudding drin wäre.«
»Es wird schon wieder, sollst sehen«, sagte Regine beruhigend, obwohl ihre Sorgen größer wurden. Das mehrfache Nasenbluten kam ihr recht alarmierend vor.
Keine Viertelstunde später war Manuela eingeschlafen.
Ein paar Minuten blieb Regine noch im Zimmer und ordnete die Kleidung der Enkelin ein, erst danach ging sie wieder hinunter. Sie überlegte, ob sie noch mit Mona telefonieren sollte, als ihr einfiel, daß sie noch nicht einmal wußte, in welchem Hotel Alexander Zimmer bekommen hatte. Es war irgendwie untergegangen, als er Mona abgeholt hatte. Nachfragen in den Hotels war ihr zu dumm, also blieb ihr nur abzuwarten, bis Mona am nächsten Morgen kommen würde.
Für Regine Hauser verlief die Nacht unruhig, denn immer wieder erwachte sie voller Sorge um Manuela und ging zu ihr ins Zimmer, um nachzuschauen, ob mit dem Mädel alles in Ordnung war. Zum Glück schlief es jedoch die ganze Nacht durch.
Müde und abgespannt befand sich Regine schon kurz vor sieben wieder in ihrer Küche, um sich einen starken Kaffee aufzubrühen. Sie war gerade damit fertig, als es an der Haustür läutete.
Nanu, so früh? Wer mag das wohl sein? dachte Regine und ging zur Haustür, um zu öffnen.
»Mona, du? So früh habe ich dich eigentlich noch nicht erwartet. Bist du aus dem Bett gefallen?«
»So ähnlich, Mutti, doch zuerst einmal wünsche ich dir einen guten Morgen. Ich habe gleich frische Brötchen mitgebracht. Willst du mich nicht reinlassen?«
»Guten Morgen, Mona. Sicher, komm herein. Ich habe mir gerade einen starken Kaffee aufgebrüht.«
Während Mona ihrer Mutter ins Haus folgte, entgegnete sie: »Ich habe schon mit Alexander Kaffee getrunken. Er hat heute sehr früh eine geschäftliche Besprechung. Er holt uns alle drei zum Mittagessen ab. Was macht Manuela?«
»Sie schläft noch und hat auch die ganze Nacht durchgeschlafen. Trotzdem muß ich ernsthaft mit dir über das Mädel sprechen.«
»Warum, Mutti, was ist? Du siehst irgendwie müde aus.«
»Ich habe auch nicht gut geschlafen, Mona. Ich war unruhig und habe immer wieder nach Manuela gesehen. Da ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Setz dich zuerst, dann reden wir.«
Mona legte achtlos die Brötchentüte auf den Tisch und setzte sich ihrer Mutter gegenüber. Beunruhigt sah sie sie an.
»Eine Frage, Mona. Wußtest du etwas davon, daß Manuela in der vergangenen Zeit öfter Nasenbluten hatte?«
»Manuela hat Nasenbluten? Wie kommst du denn darauf?«
»Gestern abend hatte sie starkes Nasenbluten, und sie hat mir auch gesagt, daß das in der letzten Zeit schon ein paarmal passiert sei. Was mir in dem Zusammenhang auch ein wenig eigenartig vorkam, war, daß sie über schmerzende Knie- und Handgelenke klagte. Wer weiß, was Manuela bis jetzt noch alles verschwiegen hat. Weißt du, Mona, ich bin nicht mehr so zuversichtlich wie gestern abend. Was sagst du dazu?«
Monas Augen hatten sich während des Berichts ihrer Mutter entsetzt geweitet. »Ich bin schockiert, Mutti, ich hatte keine Ahnung davon. Wenn wir wieder daheim sind, werde ich das sofort Dr. Hilbig sagen. Vielleicht hilft ihm das weiter. Eine Woche ist ja schnell vorbei.«
»Du willst wirklich so lange warten, Mona? Ich an deiner Stelle könnte das nicht.«
»Und, Mutti, was sollte ich denn deiner Meinung nach jetzt tun?«
»Ich habe dir gestern abend von der Kinderklinik Birkenhain erzählt. Ruf an, mach einen Termin aus und lasse Manuela da untersuchen. In der Klinik hat man Fachärzte, die mit modernen Geräten mehr herausfinden können als nur ein älterer Kinderarzt.«
»Ich werde mit Alexander darüber reden, denn ich will ihn nicht übergehen. Danach sehen wir weiter. Bist du beruhigt?«
»Nur etwas, aber schieb es nicht auf.«
»Werde ich schon nicht. Und jetzt fort mit den trüben Gedanken. Jetzt wird der Frühstückstisch gedeckt, damit wir drei gemütlich frühstücken können. Hat Manuela gestern abend noch etwas gegessen?«
»Nein, ich habe es zwar versucht, doch sie wollte nicht. Sie ist sogar mir gegenüber ziemlich pampig geworden.«
»Wie soll ich das nun wieder verstehen?«
»Nun, wie ich es gesagt habe. Das Mädel hat ziemlich gereizt reagiert. Wir müssen die Augen offenhalten.«
»Hast du Milch im Haus, Mutti?« übersprang Mona eine Antwort für ihre Mutter.
»Ja, ein halber Liter ist noch im Kühlschrank. Ich muß später erst einkaufen. Wozu brauchst du die Milch?«
»Für Manuela, sie mag morgens gern Kakao. Machst du ihn, oder soll ich?«
»Ich mach schon, deck du inzwischen den Tisch. Anschließend kannst du nach oben gehen. Manuela fühlt sich nach dem ausgiebigen Schlaf heute morgen bestimmt wohler.«
»Wir werden sehen, Mutti.«
*
Als Mona das Zimmer betrat, war Manuela schon wach.
»Guten Morgen, Schatz, hast du gut geschlafen?« Liebevoll beugte sich Mona zu ihrer Tochter und hauchte einen zärtlichen Kuß auf Manuelas Stirn, dabei beobachtete sie sie sehr aufmerksam.
»Guten Morgen, Mutti, du bist aber schon früh gekommen. Ist Vati auch hier?«
»Nein, Vati hat heute schon sehr früh eine Besprechung. Aber er holt uns und Oma zum Mittagessen ab, und anschließend fahren wir gemeinsam hinaus in die Heide. Jetzt sag mir, ob du gut geschlafen hast und wie du dich heute fühlst.«
»Ich habe gut geschlafen, aber müde bin ich immer noch.«
»Wenn du erst richtig gefrühstückt hast, wirst du schon munter. Oma hat mir schon gesagt, daß du gestern abend nichts mehr gegessen hast. Ich habe auch frische Brötchen und für dich ein Rosinenbrötchen mitgebracht. Kakao gibt es auch. Wir warten schon auf dich. Soll ich dir helfen?«
»Nein, das kann ich doch wohl allein. Du kannst mich gleich nur kämmen.«
»Fein, dann aber jetzt raus aus den Federn und ab ins Bad. Ich lege dir in der Zwischenzeit ein Kleid heraus, denn wir wollen nach dem Frühstück mit der Oma zum Einkaufen gehen.«
»Ich will aber kein Kleid anziehen, Mutti. Wir haben doch meine Jeans und Pullis mitgenommen.«
»Meinetwegen, wenn du unbedingt willst. Heute mittag ziehst du aber ein Kleid an, denn du weißt ja, daß Vati mit uns essen will.«
»Immer Kleider find ich doof, Mutti«, maulte Manuela, die nun aufstand und ins Bad ging.
Mona legte die gewünschten Kleidungsstücke heraus und mußte dabei unwillkürlich an ihren Mann denken. Was Manuelas Kleidung betraf, war er sehr konservativ. Hosen für Mädchen mochte er nicht besonders gern, und dabei war das Mädchen ganz vernarrt darin. So, wie andere Mädchen in ihrem Alter. So hatten sie einen kleinen Kompromiß geschlossen. An Sonntagen und zu bestimmten Anlässen mußte Manuela sich fügen und Kleider tragen, ansonsten durfte sie in ihren geliebten Hosen herumlaufen.
Als Manuela ins Zimmer zurückkam, wirkte sie überhaupt nicht wie ein ausgeruhtes elfjähriges Mädchen. Sie schlich förmlich ins Zimmer, und sofort fragte Mona besorgt: »Was hast du, Manuela?«
»Nichts, Mutti.«
»Wirklich nicht? Sag mir ruhig, wenn du dich nicht wohl fühlst. Du hast mir ja auch nichts davon gesagt, daß du immer Nasenbluten hast. Ich möchte in Zukunft alles wissen, hörst du? Es ist wichtig.«
»Ja, Mutti.«
Mona fragte nicht weiter, sondern beobachtete ihre Tochter, die sich nun ankleidete. Manuelas Bewegungen waren langsam und träge. Und wie blaß das schmale Gesicht schon am frühen Morgen wieder war. Mona hoffte, daß sich das später an der frischen Luft etwas bessern würde. Beim Einkaufen würde sie auch die Präparate kaufen, die Dr. Hilbig aufgeschrieben hatte. Manuela mußte dann sofort mit der Einnahme beginnen.
»Kämmst du mich jetzt, Mutti? Du darfst aber nicht ziepen, sonst bekomme ich wieder Kopfweh.«
»Keine Bange, ich passe schon auf.«
Ein paar Minuten später war Manuela fertig, und Mona ging mit ihr zu ihrer Mutter hinunter, die schon ungeduldig wartete.
Eine Tasse Kakao und ein halbes Rosinenbrötchen mit Butter waren alles, was Manuela zum Frühstück zu sich nahm. Doch Mona war schon froh über das bißchen, das Manuela gegessen hatte.
»Du kannst dich ja mit Manuela hinten in den Garten setzen, Mona. Ich habe noch etwas zu tun, bis wir zum Einkaufen fahren. Es wird heute ein wunderbarer Tag, und die Luft wird dem Mädel guttun«, sagte Regine nach dem Frühstück und begann den Tisch abzuräumen.
»Soll ich dir nicht helfen?«
»Nicht nötig, das ist doch nicht viel. Wir nehmen den Bus um zehn nach neun, dann braucht Manuela nicht so viel zu laufen.«
Punkt zehn nach neun stiegen Mona und ihre Mutter mit Manuela in den Bus, der sie zur Stadtmitte brachte. Während Mona sich zuerst bei einem Autoverleiher um einen Wagen kümmerte, nahm Regine Hauser Manuela mit ins erste Geschäft, wo sie sich auch mit Mona treffen wollte.
Als Mona endlich kam, stand ihre Mutter schon mit gefüllten Taschen mit Manuela am Eingang und wartete.
Mona sah sofort, daß ihre Tochter schon wieder so erschöpft und abgespannt wirkte, als wäre sie den ganzen Tag auf den Beinen gewesen.
Sie tauschte mit ihrer Mutter einen ernsten Blick und sagte: »Ich bringe die Einkäufe zum Wagen, er steht um die nächste Ecke. Wie wäre es, wenn du inzwischen mit Manuela drüben in die Eisdiele gehst? Sie braucht eine kleine Pause.«
»Ich möchte aber wieder zu Oma nach Hause, Mutti.«
»Später, Schatz, wir müssen erst noch etwas besorgen. Oma bestellt dir inzwischen ein großes Eis. Die paar Schritte zur Eisdiele wirst du wohl schaffen.«
Mona wartete keine Antwort ab, sondern nahm ihre Mutter die Einkaufstaschen ab und ging mit raschen Schritten davon.
»Warum fahren wir nicht nach Hause, Oma? Ich bin schon wieder so müde, und alles tut mir weh«, klagte Manuela, während sie an Regines Seite die kleine Eisdiele betrat.
»Was tut dir weh, Schätzchen?«
»Alles, Oma. Meine Arme und meine Beine, und mir ist irgendwie schwindelig.«
»Komm, setz dich erst einmal, und wir essen ein Eis. Wenn Mutti gleich kommt, sagen wir ihr, daß sie den Rest allein einkaufen muß, und wir beide warten hier solange auf sie. Mutti beeilt sich sicher, und wir fahren dann schnell wieder nach Hause.«
»Ja, Oma. Ich darf mich zu Hause auch wieder hinlegen, nicht wahr?«
Regine nickte und gab ihre Bestellung auf. Sie hatten gerade ihre Eisportionen vor sich stehen, als Mona kam.
Ein Blick auf Manuela, die mit wachsbleichem Gesicht und geschlossenen Augen in einem Sessel saß, und Mona beeilte sich zu tun, was die Mutter gesagt hatte.
*
Eine strahlende Morgensonne spiegelte sich in den blitzenden Scheiben der Fenster der Kinderklinik Birkenhain. Dr. Hanna Martens war mit der Oberschwester und dem Assistenzarzt Dr. Michael Küsters damit beschäftigt, die leicht verspätete Visite durchzuführen.
»So, noch ein Zimmer, dann hätten wir es wieder einmal geschafft, Frau Dr. Martens«, sagte Schwester Elli lächelnd, als sie vor der letzten Tür anlangten.
»Stimmt, Schwester Elli, und ich freue mich ehrlich, wenn ich gleich der Maike sagen kann, daß sie morgen wieder nach Hause zu ihrer Mutti darf. Es besteht kein Grund mehr, das Mädel noch länger hierzubehalten. Wenn ich dann bitten darf?«
Schwester Elli öffnete die Tür des Krankenzimmers und ließ Hanna und Michael Küsters an sich vorbei das Zimmer betreten.
»Guten Morgen, Maike.« Lächelnd trat Hanna an das Bett, in dem ein etwa siebenjähriges Mädchen saß und mit einer Puppe spielte.
»Ich habe eine feine Überraschung für dich. Möchtest du sie hören?«
Das dunkelhaarige Mädchen legte seine Puppe zur Seite und sah Hanna mit großen Augen an.
»Ist meine Mutti gekommen?«
»Nein, deine Mutti kommt doch erst heute nachmittag. Möchtest du gern wieder nach Hause zu deiner Mutti?«
Ein sehnsüchtiger Ausdruck trat in die Kinderaugen, und leise sagte die Kleine: »Ja, ich möchte gern nach Hause. Meine Mutti ist doch ganz allein. Mutti hat aber gesagt, daß ich erst wieder ganz gesund werden muß.«
»Du bist wieder gesund, Maike, und du darfst heute nachmittag deiner Mutti sagen, daß sie dich morgen abholen darf. Nun, freust du dich über diese Überraschung?«
»Ist das wahr, ich darf wirklich?«
»Ja, du darfst. Du warst ein ganz braves Mädchen, darum bist du auch rasch wieder gesund geworden. Du mußt nur mit dem Herumspringen etwas warten und sehr aufpassen, hörst du?«
»Ich darf nach Hause, ich darf zu meiner Mutti?« Selig leuchtete es in den Augen der Siebenjährigen auf.
Hanna wollte noch etwas sagen, doch in diesem Moment klopfte es an die Tür, und Schwester Laurie kam ins Zimmer.
»Ein Telefongespräch für Sie, Frau Dr. Martens. Es scheint sehr dringend zu sein, und Herr Schriewers hat es schon nach oben gelegt.«
»Danke, Schwester Laurie, ich komme sofort. Bitte, erneuern Sie das Pflaster auf der Operationsnarbe, Herr Dr. Küsters.«
»In Ordnung, Frau Doktor, lassen Sie sich nicht aufhalten.«
Mit raschen Schritten verließ Hanna hinter Schwester Laurie das Krankenzimmer und nahm einen Moment später im kleinen Ärztezimmer der Krankenstation den Hörer ab.
»Dr. Martens«, meldete sie sich. Eine aufgeregte Frauenstimme antwortete: »Mein Name ist Bischoff, und ich rufe von Celle aus an. Ich bin hier mit meiner Tochter bei meiner Mutter zu Besuch. Ich möchte gern wissen, ob es möglich ist, mit meiner Tochter zu einer Untersuchung zu Ihnen in die Kinderklinik zu kommen. Meine Tochter ist elf Jahre alt, mit ihr stimmt etwas nicht. Ich bin in großer Sorge.«
»Bitte, ganz ruhig, Frau Bischoff. Sagen Sie mir doch bitte, welche Beschwerden Ihre Tochter hat. Sind sie plötzlich aufgetreten?«
»Nein, meine Tochter ist schon seit einiger Zeit verändert, und ich habe auch schon mehrere Male einen Arzt aufgesucht. Ich bekam jedoch immer nur die Auskunft, daß Manuela sehr zart und blutarm sei. Ich glaube es nicht mehr, denn meine Tochter verändert sich in erschreckender Weise. Sie ist immer müde und erschöpft, zeigt keinen rechten Appetit. Nasenbluten tritt auch auf, und ihr tun Arme und Beine weh. Hauptsächlich die Gelenke.«
»Wann können Sie mit Ihrer Tochter kommen, Frau Bischoff?« fragte Hanna sofort, denn in ihr tauchte ein jäher Verdacht auf.
»Ich darf also mit ihr kommen? Auch wenn mein Wohnsitz Nürnberg ist?«
»Der Wohnsitz spielt keine Rolle, wenn ein Kind erkrankt ist. Kommen Sie, sobald Sie können. Ich bitte Sie nur, richten Sie sich darauf ein, daß Ihre Tochter zunächst für ein paar Tage bei uns bleiben muß. Wann kann ich also mit Ihnen rechnen?«
»Noch heute, Frau Dr. Martens. Mein Mann wird in einer Stunde von einer Besprechung zurückkommen, danach kommen wir sofort.«
»Gut, Frau Bischoff, ich erwarte Sie noch in der Mittagszeit. Die Fragen, die noch offenstehen, können Sie mir ja hier in der Klinik beantworten.«
»Ich danke Ihnen, daß ich kommen darf. Ich habe solche Angst um meine Tochter.«
»Sie müssen mir nicht danken, Frau Bischoff. Wir sind ja schließlich dazu da, kranken Kindern zu helfen. Also, Kopf hoch und beruhigen Sie sich, ich erwarte Sie in der Klinik.«
Hanna legte nachdenklich den Hörer auf. Was sie da gerade erfahren hatte, war mehr als beunruhigend. Die Symptome, die diese Frau Bischoff ihr aufgezählt hatte, waren ihr nur zu gut bekannt. Hanna war so in ihre Gedanken vertieft, daß sie überhörte, daß jemand das Zimmer betrat.
»Hallo, Schwesterherz, träumst du am hellen Tag?«
Hanna zuckte leicht zusammen und drehte sich um.
»Du, Kay, ich war wirklich einen Moment ganz in Gedanken. Ich hatte gerade ein Telefongespräch, eine Sache, die mich beunruhigt.«
Das Lächeln verschwand von Kays Gesicht, als er Hanna ansah, und er fragte: »Um was geht es, Hanna?«
»Um ein elfjähriges Mädchen, wahrscheinlich Leukämie.«
»Bist du sicher.«
»Was heißt sicher? Soweit man sicher sein kann, wenn man die Symptome kennt, die diese Erkrankung begleiten. Ein Mädchen, das sich verändert, immer müde und erschöpft ist. Schmerzen in den Armen und Beinen und dazu das Auftreten von Nasenbluten. Was würdest du dazu sagen? Hinzu kommt noch, daß die Mutter schon andere Ärzte aufgesucht hat, die ihr jedoch nur die Zartheit des Kindes sowie Blutarmut bestätigten.«
»Da gibt es in der Tat kaum Zweifel, Hanna.«
»Genau, und es wird sich bestätigen, wenn die Mutter heute in der Mittagszeit mit dem Mädel zu uns in die Klinik kommt. Ich hoffe nur, daß es sich um eine Form von Leukämie handelt, bei der wir helfen können. Ziemlich akut scheint es zu sein, denn die Stimme der Mutter klang aufgeregt.«
»Wo wohnt die Familie?«
»Soviel ich dem Gespräch entnehmen konnte, ist die Familie wohl hier in Celle nur zu Besuch. Der Wohnsitz ist Nürnberg. Doch das spielt ja nur eine untergeordnete Rolle, denke ich.«
»Warten wir es also ab, Hanna. Sicher willst du das Mädchen behandeln, nicht wahr?«
»Richtig, Kay, zumal du ja in Kürze für einige Tage fortfahren mußt. Im Übrigen müßte heute mit der Post Bescheid kommen, wann unsere neue Mitarbeiterin hier eintrifft. Ich denke, daß Frau Dr. Wilde morgen oder übermorgen hier ankommt.«
»Werde gleich noch die heutige Post durchsehen, Hanna. Hoffentlich bekommen wir für Frau Dr. Dirksen Andergast einen gleichwertigen Ersatz.«
»Da bin ich sicher. Du hast ja die Referenzen gesehen. Ich denke doch, daß ich die richtige Wahl getroffen habe.«
*
Es war schon kurz vor zwölf, als Alexander mit seinem Wagen vor dem Häuschen seiner Schwiegermutter vorfuhr.
Als ihm Mona die Tür öffnete, sagte er ungehalten: »Du bist noch nicht fertig, Mona. Hatten wir nicht fest vereinbart, daß ich euch um diese Zeit zum Essen abhole?« Verärgert runzelte er die Stirn.
»Komm erst einmal ins Haus, Alexander. Ich muß dir sagen, daß aus dem gemeinsamen Mittagessen wohl nichts wird.«
»Wie bitte? Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein?« Zornig folgte Alexander Mona ins Haus.
Als er ins Wohnzimmer trat und Manuela auf der Couch liegen sah, fragte er: »Was hat das zu bedeuten, Mona? Möchtest du mich nicht aufklären? Warum liegt das Mädel?«
»Tut mir leid, aber ich kann es nicht ändern, Alexander. Manuela ist krank, und ich habe mich schon mit der Kinderklinik Birkenhain in Verbindung gesetzt. Sieh dir Manuela genau an, dann erkennst du auch, daß es ihr nicht gutgeht. Das Kind muß unbedingt zu einem Arzt. Ich bitte dich, mich nach dem Essen nach Ögela in die Kinderklinik zu bringen. Außerdem hat Mutti für uns alle gekocht, wir können also hier zu Mittag essen.«
»Du warst doch erst bei Dr. Hilbig, Mona. Machst du nicht schon wieder aus einer Mücke einen Elefanten? So viel Getue um ein verzogenes Kind.«
»Manuela ist ernsthaft krank, Alexander. Wenn du mich nicht mit Manuela nach Ögela bringst, fahre ich eben allein. Ich habe mir heute morgen in der Stadt einen Leihwagen besorgt.«
»Ich fahre schon, wenn es unbedingt sein muß. In Zukunft möchte ich jedoch nicht mehr vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Ich habe ja wohl das Recht, vorher informiert zu werden.«
»Und ich habe Angst um meine Tochter. Du mußt uns ja nicht fahren, wenn du nicht willst.«
»Hallo, Alexander. Ich hoffe doch, daß es dir recht ist, wenn wir heute bei mir zu Mittag essen. Ich habe alles fertig.« Regine kam ins Wohnzimmer und begrüßte den Schwiegersohn.
»Ich wollte dir zwar mit meiner Einladung zum Essen Arbeit ersparen, doch da du dir so viel Mühe gemacht hast, will ich es dir auch nicht abschlagen.«
»Es macht mir keine Mühe, Alexander. Ich freue mich doch über euren Besuch. Und das mit der Kinderklinik war mein Vorschlag. Mit Manuela scheint wirklich etwas nicht zu stimmen.«
Mit kurzen Worten berichtete Regine ihrem erstaunt zuhörenden Schwiegersohn über den vergangenen Abend und den Vormittag in der Stadt.
Erst nach der Mahlzeit sagte Alexander mit kühler Freundlichkeit: »Es hat ausgezeichnet geschmeckt, Mutter. Ich werde mich dafür revanchieren.«
»Das ist nicht notwendig. Denkt ihr jetzt lieber daran, das Kind zur Klinik zu bringen?«
»Ich schau rasch nach, ob sie schon wach ist, Mutti«, entgegnete Mona und eilte ins Wohnzimmer hinüber.
Manuela schlief nicht mehr. Sie richtete sich auf, als Mona ins Zimmer kam, und sagte leise: »Nicht böse sein, Mutti, ich kann doch nichts dafür. Ich möchte so gern wissen, warum ich immer so müde bin.«
»Ich bin nicht böse, Manuela, ich mache mir nur große Sorgen. Vati und ich fahren gleich mit dir in eine Klinik, damit du dort einmal ganz gründlich untersucht wirst. Du bist mit deinen elf Jahren ja schon ein großes und vernünftiges Mädchen und verstehst es sicher, daß du ein paar Tage in der Klinik bleiben mußt. Auch ich will endlich wissen, was dir fehlt, damit man dir helfen kann.«
Erschreckt sah Manuela ihre Mutter an.
»Ich muß im Krankenhaus bleiben, Mutti? Ich habe Angst davor. Muß das denn sein?«
Tränen kamen ihr in die Augen, und sie schluckte schwer.
Mona setzte sich neben sie und faßte nach ihren Händen.
»Ja«, sagte sie fest, »es muß sein. Es ist besser so. Die Urlaubstage holen wir später nach. Wenn Vati nicht länger als diese Woche Zeit hat, muß er eben schon allein nach Hause fahren. Nun, was sagst du dazu?«
Manuela hatte sich wieder etwas gefangen.
»Das wäre schon klasse, Mutti. Nur du, die Oma und ich. Vati soll ruhig nach Hause fahren, er fehlt mir nicht.«
»Das darfst du nicht sagen, Mädel. Ich habe dir ja schon einmal gesagt, daß er dir nicht so zeigen kann, daß er dich liebhat.«
»Du sollst mich nicht anschwindeln, Mutti. Ich fühle es doch selbst, denn ein so kleines Kind bin ich ja wirklich nicht mehr. Manchmal macht es mich ganz traurig. Aber ich habe ja noch dich.«
»Mich wirst du auch immer haben, mein großes Mädchen. Doch jetzt reden wir nicht mehr davon. Du sollst überhaupt nicht so viel reden, denn auch das strengt dich an. Möchtest du noch etwas essen, bevor wir losfahren?«
»Nein, Mutti, ich habe nur schon wieder sehr großen Durst. Am liebsten möchte ich etwas Kaltes trinken, aber keine Milch.«
»Eine Limonade oder kalten Tee?«
»Eine Limonade, Mutti.«
Während Mona für Manuela ein großes Glas Limonade holte und Alexander Bescheid sagte, mußte sie an die Worte denken, die ihr Mädel kurz zuvor gesagt hatte. Du sollst mich nicht anschwindeln, Mutti, ich fühle es doch selbst. Es war schmerzhaft für sie zu erkennen, daß sie wieder einmal versagt hatte. Eine glückliche Kindheit hatte sie sich für Manuela gewünscht, als sie damals Alexander geheiratet hatte. Sie hätte sich mehr Zeit nehmen müssen, ihn besser kennenzulernen, dann wäre ihr und Manuela vielleicht vieles erspart geblieben. Jetzt konnte sie nur versuchen, durch ihre Liebe zu ihrem Mädchen etwas auszugleichen.
»Können wir endlich fahren, Mona?«
Die kühle, herrische Stimme ihres Mannes holte Mona aus ihren Gedanken heraus.
»Ja, ja, natürlich, Alexander, wann immer du willst.«
*
»Wann, sagtest du, wollte diese Frau Bischoff mit ihrer Tochter nach Birkenhain kommen, Hanna?« Fragend sah Kay seine Schwester an.
»Sie sagte am Telefon, in der Mittagszeit. Ich gehe noch mal rasch hinauf auf die Station und überzeuge mich, ob auch alles für unsere neue Patientin vorbereitet ist. Ich habe die Anweisung gegeben, erst einmal ein Einzelzimmer freizumachen. Du weißt ja selbst, daß wir im Augenblick ziemlich belegt sind. Ich bin bald wieder hier unten.«
»Laß dir ruhig Zeit, Hanna. Sollte Frau Bischoff eher kommen, lasse ich dir sofort Bescheid geben.«
»In Ordnung, Kay.«
Leise ging Hanna oben auf der Krankenstation über den langen Gang, denn die meisten der jungen Patienten hielten um diese Zeit ihr Mittagsschläfchen.
Im Schwesternzimmer saßen außer Schwester Elli, der Oberschwester, noch Schwester Laurie und Schwester Jenny und machten eine Kaffeepause, als Hanna eintrat.
»Möchten Sie auch eine Tasse Kaffee? Er ist noch ganz frisch«, fragte Schwester Elli.
»Nein, danke, Schwester Elli, ich habe erst vor einer Viertelstunde Kaffee getrunken. Ich wollte eigentlich nur hören, ob für unseren Neuzugang schon alles bereit ist.«
»Ja, selbstverständlich, Frau Dr. Martens. Hinten am Fenster Zimmer vierzehn ist klar. Ich habe den Klausi nach acht verlegt. Er ist bei Thomas und beim Markus bestens aufgehoben. Die drei sind ja ungefähr in einem Alter und werden sich bestimmt gut vertragen. Haben Sie sonst noch einen Wunsch?«
»Nein, das war es für den Augenblick, Schwester Elli. Noch ist die Patientin nicht hier. Ich muß auch gleich wieder hinunter. Wenn etwas sein sollte, wissen Sie ja, wo mein Bruder und ich zu erreichen sind.«
»Alles klar, Frau Dr. Martens, noch ist hier oben alles sehr ruhig und in Ordnung.«
»Dann wollen wir nur wünschen, daß es auch so ruhig bleibt. Also bis später, meine Damen.«
Hanna nickte den drei Schwestern noch einmal freundlich zu und verließ das Schwesternzimmer.
Draußen auf dem Gang kam ihr ihre Mutter entgegen.
»Na, hast du Julia zum Schlafen gebracht, Mutti? Sie ist schon ein kleiner Quälgeist, nicht wahr?«
»Schon, aber lieb ist die Kleine auch, Hanna. Hoffentlich kommt die Mutter heute, wie zugesagt. Wenn man so ein kleines Mädchen in einer Klinik liegen hat, sollte man sich darum kümmern. Die allerbeste Behandlung ersetzt nicht die Liebe und zärtliche Zuwendung einer Mutter.«
»Ich weiß, Mutti, und Julias Mutter wird es auch wissen. Du darfst nicht vergessen, daß sie mit ihrem Kind allein ist und für den Unterhalt hart arbeiten muß. Du wirst ja sehen, ob sie heute wirklich kommt. Ich muß jetzt wieder hinunter. Ich habe dir ja beim Mittagessen davon erzählt, daß heute in der Mittagspause eine neue Patientin gebracht wird. Ich möchte zur Stelle sein, wenn sie eintrifft.«
Bevor Hanna zur Aufnahme ging, gab sie Schwester Dorte einen Wink und sagte: »Halten Sie sich bitte mit einem Rollstuhl bereit, Schwester Dorte. Ich denke, daß wir ihn in gut fünf Minuten benötigen.«
»Wird gemacht, Frau Dr. Martens. Werden Sie das Kind zuerst untersuchen, oder soll es hinauf auf die Station gebracht werden?«
»Bringen Sie das Mädchen zunächst nach oben, damit auch den Eltern Gelegenheit gegeben wird zu sehen, wie ihre Tochter untergebracht ist. Die ersten Untersuchungen folgen etwas später. Das Kind kommt in Zimmer vierzehn.«
»Alles klar, Frau Doktor.«
Als Hanna einen Augenblick später die Eingangshalle betrat, fiel ihr erster Blick auf das elfjährige Mädchen, das kraftlos und erschöpft in einem Besuchersessel saß. Das Mädel sieht wirklich zum Erbarmen aus, dachte sie mitleidig. Sie ließ sich jedoch nichts anmerken, und freundlich lächelnd ging sie auf das Ehepaar zu, das sich jetzt erhob.
»Guten Tag. Ich bin Dr. Martens. Sie sind Herr und Frau Bischoff, nicht wahr?«
»Ja, Frau Dr. Martens, ich hatte mit Ihnen telefoniert«, antwortete Mona nach der Begrüßung.
»Du bist dann also die Manuela, die nun ein paar Tage hier in Birkenhain bleiben wird? Es wird dir bei uns ganz bestimmt gefallen.« Sanft fuhr Hanna der Elfjährigen über das lockige blonde Haar.
Manuela, die Hanna unentwegt angesehen hatte, lächelte nun zaghaft und erwiderte: »Meine Mutti hat gesagt, daß man mir hier helfen wird.«
»Wir werden unser Bestes tun, Manuela. Jetzt kommt gleich eine Schwester, die dich hinauf auf unsere Krankenstation in ein hübsches Zimmer bringen wird. Ich muß noch mit deinem Vati und deiner Mutti reden. Danach kommen sie zu dir hinauf, damit sie sehen können, in welchem Zimmer du schläfst. Einverstanden?«
»Ja, Frau Doktor.«
Wie vorher verabredet, betrat in diesem Augenblick Schwester Dorte nach kurzem Anklopfen mit einem Rollstuhl den Raum.
Hanna deutete den ängstlichen Blick der Elfjährigen richtig und sagte beruhigend: »Du mußt dich nicht fürchten, Manuela. Die Untersuchungen tun wirklich nicht weh. Und der Rollstuhl ist nur dafür da, daß du dich nicht durch unnötiges Laufen anstrengen mußt.«
»Manuela heißt du? Ich bin Schwester Dorte«, sagte die junge Schwester nun fröhlich zu Manuela und fügte hinzu: »Dann wollen wir zwei jetzt mal nach oben fahren, Manuela.«
Nachdem sich die Tür hinter Schwester Dorte und Manuela geschlossen hatte, wollte Alexander Bischoff wissen: »Wie lange werden die Untersuchungen denn dauern, Frau Dr. Martens?«
»So genau kann ich Ihnen das jetzt noch nicht sagen, Herr Bischoff. Es kommt ganz darauf an, ob wir etwas feststellen. Ich kann Ihnen jedoch sagen, daß Sie und auch Ihre Frau zu jeder Zeit Zutritt zur Klinik haben. Wir haben es von Beginn an so gehalten, daß wir keine starren Besuchszeiten eingerichtet haben. Es liegt also immer an den Eltern, wann und wie lange sie jeweils Zeit für ihre kranken Kinder aufbringen können. Ihre Manuela befindet sich, wie ich feststellen konnte, in einer körperlichen sehr schlechten Verfassung. Ich kann Ihnen beiden nicht verhehlen, daß ich besorgt bin.«
»Wann werden Sie die ersten Ergebnisse vorliegen haben, Frau Dr. Martens?« fragte nun Mona.
»Schon morgen vormittag, denke ich. Sobald ich etwas Definitives sagen kann, gebe ich Ihnen sofort Bescheid.«
»Ich darf also morgen vormittag schon kommen?«
»Natürlich. Ich wüßte nun noch gern von Ihnen, seit wann sich Ihre Tochter in dieser miserablen Verfassung befindet. Können Sie mir da nähere Angaben machen?«
»Es geht ihr schon seit einiger Zeit nicht besonders gut. Wie ich Ihnen schon am Telefon gesagt habe, habe ich auch schon mehrfach einen Arzt mit Manuela aufgesucht. Erst gestern morgen, kurz vor Beginn unserer Fahrt hierher, hat unser Kinderarzt noch eine Blutprobe entnommen. Dieser körperliche Verfall ist fast von einem auf den anderen Tag gekommen. Hätte sich das schon vorher angezeigt, wäre ich wohl kaum hierher in die Heide gekommen. Ich habe furchtbare Angst um meine Tochter. Werden Sie ihr hier wirklich helfen können?«
»Wenn wir herausfinden, was ihr fehlt, werden wir alles versuchen. Doch schon heute darüber zu sprechen, wäre verfrüht. Warten wir also die anstehenden Untersuchungen ab. Wenn Sie mir nun noch die genauen Daten des Kindes, dazu Ihre momentane Adresse und Telefonnummer angeben würden, können Sie beide noch auf die Krankenstation zu Ihrem Mädel gehen.«
»Geh du allein, Mona, ich erledige das hier mit den Papieren. Ich warte dann im Wagen auf dich.«
»Ich bleibe noch hier, Alexander. Wenn du nicht mit zu Manuela möchtest, fahr ruhig schon nach Celle zurück. Ich werde schon eine Fahrgelegenheit zurück finden. Morgen komme ich dann mit meinem Leihwagen hierher zur Klinik. Fahr bitte noch bei Mutti vorbei und sage ihr Bescheid, daß ich später zurückkomme.«
Befremdet hatte Hanna diesem kurzen Gespräch zwischen dem Ehepaar zugehört, und sie machte sich so ihre eigenen Gedanken darüber, doch sie stellte keinerlei Fragen. Es blieb auch keine Zeit dafür, denn die Mutter der kleinen Patientin verließ den Raum, während der Vater die Angaben für die Krankenkartei ergänzte.
Erst als Hanna allein war, wurde sie sehr nachdenklich. Zwischen diesem Ehepaar schien wohl nicht alles Glück und Sonnenschein zu sein. Ein liebevoller Vater war er schon gar nicht, denn sonst wäre er noch einmal zu dem Mädel auf die Station gegangen und hätte sich zumindest von seiner Tochter verabschiedet. Hanna kannte ja zu diesem Zeitpunkt die wahren Zusammenhänge noch nicht.
*
Regine Hauser war mehr als überrascht, als es schon am nächsten Morgen früh an ihrer Tür schellte und Mona vor ihr stand.
»Mona, wie schaust du denn aus? Hast wohl nicht viel geschlafen? Hat es gestern abend noch Ärger mit Alexander gegeben?«
»Guten Morgen, Mutti. Du stellst viele Fragen auf einmal. Ich habe wirklich kaum geschlafen. Ich brauche jetzt erst einmal einen starken Kaffee, dann erzähle ich dir alles.«
»Sollst du haben, komm mit in die Küche. Es dauert ja nur ein paar Minuten. Möchtest du auch schon frühstücken?«
»Nein, Appetit habe ich noch nicht, ich möchte nur Kaffee, Mutti.«
Als der aromatisch duftende Kaffee vor ihnen stand, sah Regine ihre Tochter fragend an und sagte: »Nun erzähl mal, was ist los mit dir?«
»Ich bin gestern abend noch mit Alexander aneinandergeraten. Er hat ernsthaft vorgeschlagen, Manuela für immer hier bei dir zu lassen. Er meinte, sie könne ja in den Ferien nach Nürnberg kommen Er geht auch davon aus, daß ich mit ihm zurückfahre, falls Manuela länger in der Kinderklinik bleiben muß. Ich habe ihm klar und deutlich zu verstehen gegeben, daß das für mich überhaupt nicht in Frage kommt. Was sagst du dazu?«
»Was soll ich dazu noch sagen, Mona? Es ist wieder einmal bezeichnend für deinen Mann. Du willst ja nicht auf mich hören, wenn ich dir sage, daß du dich von ihm trennen sollst. Ich fühle, daß es auf die Dauer mit euch beiden nicht gutgehen kann. Und wenn er erst alles weiß, und einmal mußt du ihm alles sagen, sehe ich sowieso keine gemeinsame Zukunft für euch. Alexander ist nicht der Richtige für dich. Ich habe es dir schon damals gesagt. Du hattest es zu eilig, dir nach all den Vorfällen ein neues Leben aufzubauen. Warte ab, wie jetzt alles ausgeht. Trenne dich von deinem Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, daß du ihn noch liebst, wenn es überhaupt Liebe war, die dich bewogen hat, ihn damals zu heiraten. Soll ich dir noch einmal Kaffee nachgießen?«
»Gerne, Mutti.«
Regine füllte Monas Tasse und fragte: »Um welche Zeit wolltest du heute vormittag nach Ögela zur Kinderklinik fahren?«
»Wenn wir nach neun Uhr hier abfahren, reicht es, Mutti. Ich möchte ja ein Untersuchungsergebnis wissen. Wenn wir zu früh fahren, ist es sicher noch nicht vorhanden.«
»Und Alexander?«
»Er kommt natürlich nicht mit. Er sagte, daß er ab Mittag im Hotel zu erreichen wäre, sollte etwas mit Manuela sein. Mir ist es ganz lieb, daß er nicht mitkommt. Gestern hat er sich ja nicht einmal von Manuela verabschiedet. Ich habe den befremdeten Blick von Frau Dr. Martens nicht übersehen. Es war für mich kein sehr schönes Gefühl.«
»Denk nicht mehr daran, Mona. Im Augenblick ist doch nur unser Mädel wichtig. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren, daß unserem Kind nichts Ernsthaftes fehlt.«
»Es wäre schon wunderbar, Mutti, aber ich glaube nicht daran. In mir ist ein komisches Gefühl. Es macht mir große Angst. Das Gesicht von Frau Dr. Martens war gestern so ernst, als sie mir ihre Fragen stellte.«
»Sie weiß ja noch nicht, daß Manuela nur Alexanders Stieftochter ist. Auch das darfst du nicht überbewerten, Mona. Darf ich dir jetzt noch einen Vorschlag machen?«
»Bitte, Mutti.«
»Du solltest dich noch für ein bis zwei Stunden hinlegen, damit du dich besser fühlst. Du weißt ja noch nicht, wie lang unser Tag in der Klinik werden kann. Ich wecke dich so rechtzeitig, daß wir noch frühstücken können, bevor wir nach Ögela fahren.«
»Ein guter Vorschlag, Mutti, ich fühle mich auch ziemlich zerschlagen. Ich gehe dann nach oben und lege mich hin. Vielleicht kann ich schlafen.«
»Wenn nicht, ruhst du wenigstens, und das ist auch etwas wert.«
»Gut, Mutti, bis später.«
Regines Gesicht trug doch einen besorgten Ausdruck, als sie Mona nachblickte, die mit müden Schritten nach oben ging.
*
Gegen neun Uhr kam Hanna aus dem Labor, wo sie die letzten Untersuchungsergebnisse abgeholt hatte. Ihr Gesicht war sehr ernst, als sie mit Kay zusammentraf.
»Wie schaut es aus, Hanna?« fragte er mit forschendem Blick.
»Nicht gut, Kay. Mein Verdacht hat sich zu meinem eigenen Bedauern bestätigt. Hier, schau dir die Ergebnisse an, die ich mir gerade abgeholt habe. Es steht jetzt nur noch die Untersuchung des Knochenmarkes aus, die jedoch auch kein besseres Ergebnis bringen kann. Für mich steht fest, daß es sich um eine akute Leukämie handelt. Das bedeutet im Endeffekt, daß es nur eine Chance gibt, das Leben der Patientin zu retten: eine Knochenmarksübertragung. Doch auch dabei darf keine wertvolle Zeit verloren gehen.«
»Du bist dir ziemlich sicher, nicht wahr?«
»Ja, Kay.«
»So weit in Ordnung, Hanna. Weißt du denn schon, ob das Mädchen überhaupt Geschwister hat, die dafür in Frage kommen würden?«
»Nein, natürlich noch nicht. Wie sollte ich auch? Ich konnte ja schließlich nicht gestern schon danach fragen, ob es sich bei dem Mädel um ein Einzelkind handelt oder nicht.«
»Wann erwartest du denn die Eltern der Patientin?«
»Ich vermute, daß sie noch im Laufe des Vormittags kommen. Obwohl ich mir in Bezug auf den Vater da nicht so sicher bin.«
»Wie soll ich das verstehen?«
»Der Vater scheint nicht sonderlich interessiert«, entgegnete Hanna und schilderte Kay den Eindruck, den der Vater der jungen Patientin am vergangenen Tag auf sie gemacht hatte. Sie schloß: »Wie auch immer, die Mutter wird auf jeden Fall kommen. Sie war gestern noch Stunden in der Klinik.«
»Wann wirst du die Knochenmarkpunktion vornehmen? Soll ich das für dich machen?«
»Ist schon erledigt, Kay. Nur die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Weißt du, dieses elfjährige Mädchen hat großes Vertrauen zu mir. Ich werde es nicht enttäuschen. Wenn Geschwister vorhanden sind, werden wir es auch dieses Mal wieder schaffen.«
»Wenn, Hanna, immer vorausgesetzt, wenn.«
»So ist es, Kay. Über die zusätzliche Behandlung werden wir uns etwas später unterhalten, wenn auch das ausstehende Ergebnis vorliegt.«
»Ich nehme doch an, daß du auch selbst mit den Eltern beziehungsweise mit der Mutter reden wirst, nicht wahr?«
»Natürlich Kay.«
»Gut, dann werde ich mich nachher um unsere neue Anästhesistin kümmern. Sie trifft ja heute im Laufe des Vormittags in der Klinik ein.«
»Ach ja, richtig, daran habe ich nicht gedacht. Dr. Wilde wird ja hier im Haus wohnen. Der Schlüssel zur Turmgiebelwohnung liegt bei Martin in der Aufnahme. Ich hoffe, daß sie sich hier wohl fühlen wird, bis sie etwas eigenes gefunden hat. Als ich ihr beim Einstellungsgespräch die kleine Wohnung zeigte, war sie davon sehr begeistert. Eigentlich schade, daß du sie noch nicht kennengelernt hast.«
»Ich werde es ja heute nachholen, Hanna. Du hast bisher bei allen Neueinstellungen die richtige Hand gehabt, und was die Referenzen unserer neuen Mitarbeiterin betreffen, bin ich sehr zuversichtlich.«
»War ich auch sofort. So, und nun habe ich noch zu tun, Kay. Ich würde sagen, du führst heute allein die Visite durch. Ich sage dir später, was mein Gespräch mit den Angehörigen der Patientin ergeben hat.«
Hanna suchte ihr Sprechzimmer auf und ging noch einmal alle vorliegenden Untersuchungsergebnisse durch, um auf jeden Fall später nichts Falsches zu sagen. Es würde sowieso eine schwere Aufgabe werden, den Angehörigen der Elfjährigen die volle Wahrheit über die Erkrankung und über den Ernst der Situation beizubringen. Eine Aufgabe, der sie sich stellen mußte und die ihr, wie immer in solchen Fällen, nicht leichtfallen würde.
Als Hanna die Unterlagen zur Seite legte, bestand für sie nicht mehr der geringste Zweifel. Schon die Röntgenaufnahme zeigte deutlich die Veränderung des Knochenmarks. Die Untersuchung der herauspunktierten Flüssigkeit würde also mit Sicherheit kein anderes Ergebnis bringen. Hanna überlegte gerade, ob sie noch einmal ins Labor hinuntergehen sollte, als das Telefon auf ihrem Schreibtisch läutete. Es war Martin Schriewers, der ihr Bescheid gab, daß Manuelas Mutter gekommen sei.
»Schicken Sie Frau Bischoff zu mir ins Sprechzimmer, Martin«, bat Hanna.
»In Ordnung, Hanna, aber sie ist nicht allein gekommen. In ihrer Begleitung befindet sich eine ältere Dame«, sagte Martin Schriewers.
»Das wird wohl die Mutter der jungen Frau sein, Martin. Ich erwarte sie beide«, antwortete Hanna und legte den Hörer auf.
Nachdenklich wartete Hanna. Es war ihr unverständlich, daß der Vater des Mädchens nicht mit zur Klinik gekommen war. So wichtig konnten doch seine geschäftlichen Verpflichtungen nicht sein. Ein krankes Kind ging normalerweise immer vor.
Sie kam jedoch in ihren Überlegungen nicht weiter, denn es klopfte an der Tür, und im nächsten Augenblick betrat Mona Bischoff, gefolgt von einer älteren Frau, das Sprechzimmer.
»Guten Morgen, Frau Dr. Martens, wir kommen doch nicht zu früh? Ich habe meine Mutter mitgebracht.«
»Guten Morgen, Frau Bischoff, guten Morgen, Frau…?« Fragend sah Hanna auf die Begleiterin der jungen Frau.
»Hauser ist mein Name, Frau Dr. Martens. Ich hoffe, daß Sie keine Einwände haben. Da mein Schwiegersohn verhindert ist, wollte ich meine Tochter nicht allein fahren lassen.«
»Ich habe keine Einwände, Frau Hauser. Es freut mich, auch die Oma von Manuela kennenzulernen. Bitte, nehmen Sie beide Platz. Es redet sich dann leichter.« Mit einer einladenden Handbewegung wies Hanna auf eine kleine Sesselgruppe und nahm dann den beiden Frauen gegenüber Platz.
Mona konnte nicht mehr länger an sich halten. Mit bebender Stimme fragte sie Hanna: »Wie geht es meinem Mädel heute morgen, Frau Dr. Martens? Liegen Ihnen schon erste Untersuchungsergebnisse vor?«
»Ja, es liegen Untersuchungsergebnisse vor, Frau Bischoff. Sie müssen jetzt sehr tapfer sein und dürfen den Kopf nicht verlieren, denn es ist, so leid es mir tut, keine gute Nachricht, die ich für Sie habe. Es wäre mir lieb gewesen, wenn auch der Vater heute morgen mit zur Klinik gekommen wäre.«
»Mein Mann ist nicht Manuelas Vater, Frau Dr. Martens. Bitte, sagen Sie, was mit meinem Mädel ist. Sagen Sie mir die volle Wahrheit.«
»Selbstverständlich, Sie haben ein Recht darauf. Mein Verdacht bestand schon gestern, als Sie mir am Telefon die Symptome schilderten, die bei Ihrer Tochter vorhanden sind, doch ich wollte den Untersuchungsergebnissen nicht vorgreifen. Um es klar und verständlich auszudrücken, Frau Bischoff, Ihre Tochter leidet an einer akuten myeloischen Leukämie. Es tut mir unendlich leid, aber wir müssen uns mit dieser Tatsache abfinden.«
»Nein, das ist nicht wahr, ich glaube es nicht! Sie müssen sich ganz einfach irren!« kam es fassungslos über Monas Lippen. Sie sprang auf und starrte Hanna mit brennenden Augen an.
»Mona, bitte, du mußt dich zusammennehmen«, bat Regine, aus deren Gesicht jeder Tropfen Blut gewichen war. Sie drückte Mona wieder in den Sessel zurück.
Hanna sagte ernst: »Ich weiß, es ist ein harter Schock für Sie beide, doch es hat keinen Sinn, die Sache zu beschönigen. Sie, Frau Bischoff, brauchen Ihre Kräfte jetzt für Ihr Mädel.«
»Ich, ich kann es gar nicht fassen, ich weiß, was das Wort Leukämie bedeutet. Bitte helfen Sie meinem Kind. Ich werde es nicht ertragen, mein kleines Mädchen zu verlieren. Es gibt noch eine Rettung für mein Kind, nicht wahr? Sie sind doch Ärztin, Sie müssen Manuela helfen.«
Die letzten Worten waren flüsternd über Monas Lippen gekommen, und nun verlor sie den letzten Rest ihrer mühsam bewahrten Fassung. Aufschluchzend preßte sie beide Hände vor das Gesicht.
»Bitte, Mona, du darfst nicht verzweifeln. Was soll Manuela denn denken, wenn du ihr so gegenübertrittst?«
Regine legte einen Arm um Mona und sprach weiter beruhigend auf sie ein. Doch Mona hörte nicht auf zu weinen, und Regine fragte mit brüchiger Stimme: »Gibt es wirklich keine Hilfe für Manuela, Frau Dr. Martens? Man kann heutzutage doch auch schon andere Krebsformen erfolgreich behandeln. Was bedeutet überhaupt das Wort myeloisch?«
»Die Myelose ist eine bestimmte Form der Leukämie, Frau Hauser. Sie geht vom Knochenmark aus, das normalerweise ja die Granulozyten bildet. Es würde jetzt zu weit führen, wenn ich Ihnen alles erklären würde. Nur eines sollten Sie wissen. Bei Ihrer Enkelin wuchert das Knochenmark krankhaft. Es gäbe da nur eine einzige Rettung. Dazu muß ich jedoch eine wichtige Frage stellen.«
»Fragen Sie, Frau Doktor. Was wollen Sie von uns wissen?«
»Hat Manuela noch Geschwister?«
»Nein, Manuela hat keine Geschwister, sie ist allein. Warum fragen Sie?« antwortete Mona eine Spur zu hastig, und Hanna entging nicht, daß die Augen der jungen Frau unruhig flackerten.
»Es ist keine Neugierde, die mich diese Frage stellen ließ, Frau Bischoff. Es geht darum, daß nur die Knochenmarksübertragung eines Geschwisterkindes Ihre Manuela retten kann. Bei Fremdübertragungen wäre es aussichtslos.«
Mona starrte mit entsetzt geweiteten Augen auf Hanna.
»Oh, mein Gott, nein«, kam es dann über ihre Lippen, und dann sank sie lautlos in sich zusammen.
»Einen Moment bitte, ich bin sofort zurück, ich hole nur etwas, was die Lebensgeister Ihrer Tochter wieder weckt«, sagte Hanna, als es ihr nicht sofort gelang, Mona aus ihrer Ohnmacht zu holen, und ging eilig aus dem Raum.
Kurz nachdem Hanna den Raum verlassen hatte, schlug Mona die Augen auf. »Mutti, hilf mir! Mutti, was soll ich denn jetzt bloß machen?«
Verzweifelt aufweinend fiel Mona ihrer Mutter um den Hals.
»Diese Entwicklung konnte niemand vorausahnen, Mona. Wenn du Manuela wirklich liebst, mußt du nun endlich dein Schweigen brechen. Du darfst nicht länger still sein. Du mußt…«
In diesem Augenblick kam Hanna zurück, und sie hatte Regines letzte Worte noch gehört. Sie ließ sich jedoch nichts anmerken, sondern sie sagte mit ruhiger Stimme: »Gott sei Dank, da sind Sie ja wieder. Es tut mir leid, daß ich Sie so erschreckt habe. Können wir noch einmal zum letzten Punkt zurückkehren?«
»Meine Tochter möchte Ihnen etwas sagen, Frau Dr. Martens. Bitte, Mona, es muß sein.«
Regines letzte Worte waren an Mona gerichtet, und ihre Blicke waren eindringlich und flehend.
Interessiert sah Hanna auf die junge Frau und wartete.
Mona zögerte noch ein paar Sekunden, dann fuhr sie sich energisch über die Augen und sagte stockend: »Meine Mutter hat recht, Frau Doktor. Ich kann nun, da es um das Leben meines Kindes geht, nicht länger schweigen. Zuerst einmal hat Manuela noch eine Zwillingsschwester, doch deren Aufenthaltsort ist mir nicht bekannt. Bitte, lassen Sie mich von Anfang an erzählen. Vielleicht können Sie mich dann verstehen.«
»Bitte, Frau Bischoff, lassen Sie sich ruhig Zeit mit allem.«
»Zeit, ich glaube die habe ich nicht. Es ist so, daß ich vor ungefähr zwölf Jahren einen Mann kennen- und liebenlernte. Er war nicht von hier. Ich habe erst, als es schon zu spät war, erfahren, daß dieser Mann schon verheiratet war. Aus Scham über diese Demütigung konnte ich überhaupt nicht mehr klar denken. Ich wollte dieses Kind, das ich unter dem Herzen trug, nicht. Es gelang mir sogar, meine Schwangerschaft vor meinen Eltern zu verheimlichen. Zwischenzeitlich setzte ich mich mit dem Jugendamt in Verbindung, um alles für eine Adoption in die Wege zu leiten. Ich bekam dann Zwillinge, bekam jedoch nur eines der Mädchen zu sehen. Bevor ich auch dieses Kind, Manuela, verlor, erfuhr es meine Mutter. Sie konnte zwar die erste Adoption nicht mehr rückgängig machen, aber die zweite verhindern. Ich weiß, ich habe damit etwas getan, was ich mir selbst niemals im Leben verzeihen werde. Tag und Nacht habe ich seitdem daran gedacht, haben mich Alpträume gequält. Zum ersten Mal fühle ich mich etwas besser, weil ich endlich darüber reden kann. Nur meine Mutter und ich wissen davon. Ich werde nun alles tun, um mein Kind zu finden.«
»Das wird nicht so einfach sein, Frau Bischoff. Sie dürfen dabei nicht vergessen, daß dieses Kind als das Kind anderer Eltern aufgewachsen ist. Es hat sicher eine behütete Kindheit. Wollen Sie es wirklich da herausreißen?«
»Nein, o nein, daß will ich nicht. Es soll durch mich nicht unglücklich werden. Was soll ich denn sonst tun? Sie sagten doch selbst, daß es nur die eine Rettung für Manuela gibt. Ich wäre schon glücklich, wenn ich mein Kind nur einmal sehen und mich davon überzeugen könnte, daß es glücklich ist und geliebt wird. Bitte, helfen Sie mir.«
»Ich werde es versuchen, Frau Bischoff. Vielleicht gelingt es mir in diesem besonderen Fall, in dem es um das Leben eines Kindes geht, etwas herauszufinden. Ich muß Sie jedoch bitten, keine eigenmächtigen Schritte zu unternehmen, die alles nur in Frage stellen würden. Kann ich mich darauf verlassen, daß Sie jetzt einen klaren Kopf behalten und vernünftig sind?«
»Ich gebe Ihnen mein Wort, daß ich nichts tun werde, was Sie nicht billigen, Frau Dr. Martens.«
»Und Ihr Mann, weiß er davon?«
»Nein, nur meine Mutter und ich. Zuerst hatte ich Angst, meinem Mann alles zu sagen, und später, als ich ihn richtig erkannte, war es zu spät. Doch jetzt muß er es auch wissen, denn es führt kein Weg mehr daran vorbei.«
»Es wird sich bestimmt alles zum Guten wenden, Frau Bischoff. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie mir in dieser Angelegenheit entgegenbringen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Ihnen zu helfen. Ich verspreche es Ihnen.«
»Tausend Dank, Frau Doktor. Dürfen wir jetzt zu meiner Tochter?«
»Ja, gewiß, doch zeigen Sie Ihrem Mädel ein fröhliches Gesicht. Lassen Sie sich nichts von Ihren Sorgen anmerken. Kranke Kinder sind da sehr feinfühlig. Ich würde Ihnen vorschlagen, in unsere Kantine zu gehen und eine Erfrischung oder eine Tasse Kaffee zu trinken. Sie haben dadurch noch ein paar Minuten Zeit gewonnen, um sich zu beruhigen. Und versuchen Sie auch die Spuren der Tränen aus Ihrem Gesicht zu entfernen. Sie hören von mir, sobald ich etwas Konkretes erfahren habe. Einverstanden?«
»Einverstanden, Frau Doktor, und entschuldigen Sie bitte, daß wir Ihre Zeit so lange in Anspruch genommen haben.«
»Das macht überhaupt nichts. Ich helfe gern, wenn ich helfen kann.«
»Komm, Mona, wir sollten wirklich zuerst die Kantine aufsuchen, bevor wir zu Manuela gehen«, sagte Regine nun, und beide verabschiedeten sich von Hanna und ließen sie allein.
Nachdem beide eine Tasse Kaffee getrunken hatten und Mona noch im Waschraum gewesen war, um die letzten Tränenspuren zu beseitigen, gingen sie hinauf zur Krankenstation und betraten das hübsche Einzelzimmer, in dem man Manuela untergebracht hatte.
Nur mit großer Mühe konnte Mona verhindern, erneut die Fassung zu verlieren, als sie ihren Liebling da so verlassen in den Kissen liegen sah. Das war ja noch schlimmer als am Tag zuvor. Sie zwang ein fröhliches Lächeln in ihr Gesicht und trat an das Bett.
»Hallo, mein Mädchen, wie geht es dir? Schau nur, ich habe dir Besuch mitgebracht.« Liebevoll beugte sich Mona über Manuela und hauchte einen zärtlichen Kuß auf die Stirn des Mädchens.
»Freust du dich denn nicht, daß wir gekommen sind?«
»Doch, Mutti, ich habe schon so auf dich gewartet. Es ist auch sehr schön, daß Oma mitgekommen ist. Ich bin nur so müde«, kam es leise von Manuelas Lippen, und ein klägliches Lächeln huschte für den Bruchteil von Sekunden über das blasse Gesicht.
Mona machte ihrer Mutter Platz, die Manuela nun liebevoll begrüßte, und sagte: »Wenn du müde bist, Schätzchen, schlaf dich nur tüchtig aus, damit du recht bald wieder gesund wirst.«
»Du bist eine ganz liebe Oma, aber ich glaube nicht daran, daß ich wieder gesund werde. Ich bin immer müde. Wenn ich nur immer schlafe, habe ich Angst, daß ich einmal nicht mehr aufwache. Warum ist das nur alles so?«
Sanft strich Regine ihrer Enkeltochter die feuchten Locken aus der Stirn und erwiderte: »So etwas Dummes wollen wir nicht von dir hören, mein Schatz. Du bist doch sonst immer ein vernünftiges Mädchen. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir alle haben dich sehr lieb und werden schon auf dich aufpassen. Und viel Schlaf ist wirklich gesund, du wirst es selbst erleben.«
Es dauerte nur wenige Minuten, und Manuela war eingeschlafen. Regine gab Mona einen Wink, ihr aus dem Zimmer zu folgen. Draußen auf dem Gang mahnte sie: »Du mußt dich mehr zusammennahmen, Mona. In deinem Gesicht kann man lesen wie in einem aufgeschlagenen Buch. Du solltest doch in der Mittagszeit Alexander im Hotel anrufen. Vielleicht zeigt er Herz und kommt doch noch zur Klinik. Um Manuelas willen würde ich es mir sehr wünschen.«
*
»Gut, daß ich dich noch erwische, Kay. Ich wollte zwar auch gerade ins Doktorhaus zum Mittagessen, aber hast du noch ein paar Minuten Zeit für mich?«
»Für dich immer, Schwesterherz, obwohl ich einen Bärenhunger habe. Was gibt es? Geht es um die kleine Bischoff?«
»Genau, darum geht es.«
»Du hast also schon Gelegenheit gehabt, mit den Eltern der Patientin reden zu können?«
»Mit der Mutter und der Großmutter, Kay.«
»Und der Vater?«
»Er hatte keine Zeit zum Kommen. Er ist im Übrigen nur der Stiefvater des Mädchens.«
»Oje, dann stehen die Chancen also doch denkbar schlecht für uns, das Mädchen retten zu können, oder…?«
»Das würde ich nicht sagen. Es ist nur so, daß die ganze Angelegenheit äußerst kompliziert ist. Hör zu, das Wichtigste in alle Kürze.«
Hanna berichtete nun ihrem Bruder in knappen Sätzen, was sie über die Adoption von Mona Bischoff erfahren hatte.
»Was hast du jetzt vor, Hanna?«
»Ich werde all unsere Beziehungen in die Waagschale werfen, um den Aufenthaltsort des Mädchens zu erfahren, Kay. Wenn wir Manuelas Leben erhalten wollen, ist das ja wohl der einzige Weg. Hier liegt wieder einmal ein Grenzfall vor, und auch auf den Ämtern arbeiten Menschen, die ein Herz haben.«
»Denkst du dabei auch an die Menschen, die das Baby damals adoptiert haben?«
»Ja, natürlich, Kay. An diese Menschen denke ich ganz besonders. Wenn sie das Kind lieben, werden sie auch ein Herz für eine verzweifelte Mutter haben. Wir sind auf die Mithilfe dieser Menschen angewiesen. Es gibt da doch Wege, ohne das Kind aus seinem gewohnten Umfeld herauszureißen. Ich weiß, daß es keine leichte Sache werden wird, aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Frau Bischoff hat mir ihr Wort gegeben, nicht eigenmächtig zu handeln, ohne mich nichts zu unternehmen.«
»Du vertraust ihr?«
»Ja, ich vertraue ihr. Außerdem ist da noch Frau Hauser, die Mutter von Frau Bischoff, die auf ihre Tochter achten wird.«
»Und der Ehemann? Es ist immerhin ein einflußreicher Geschäftsmann. Wird er nicht querschießen?«
»Ich muß zugeben, daß Herr Bischoff der einzige Störfaktor werden könnte. Ich sage mit voller Absicht, werden könnte, denn er scheint sich nicht viel um seine Stieftochter zu kümmern. Außerdem weiß er bis jetzt noch nichts von der Angelegenheit.«
»Dann bleibt abzuwarten, wie er reagieren wird. Wie wirst du nun in der Behandlung der Patientin verfahren? Hast du einen bestimmten Plan?«
»Ja, Kay, ich werde es mit zytostatischen Mitteln versuchen, damit das Zellwachstum gehemmt wird. Blutübertragungen von wöchentlich dreimal 400 ccm ziehe ich auch in Betracht. Natürlich erst nach Absprache mit der Mutter, da sie nur eine lindernde Wirkung haben. Wichtig ist fürs erste eine vitaminreiche Nahrung, damit die Wiederherstellungskraft des Körpers gefördert wird. Viel mehr können wir nicht tun. Wir können nur hoffen, daß wir bei der Suche nach der Zwillingsschwester recht schnell einen Erfolg verbuchen können. Wie ist es denn bei dir gelaufen? Ist unsere neue Mitarbeiterin inzwischen eingetroffen?«
»Ja, vor einer guten halben Stunde, Hanna. Ich werde sie morgen früh bei unseren Mitarbeitern und der übrigen Belegschaft der Klinik einführen.«
Oben auf der Krankenstation wurde für die kleinen Patienten das Mittagessen verteilt. Für Manuela brachte Schwester Laurie zartes Fischfilet, Kartoffelpürre und Kopfsalat, dazu ein Glas Obstsaft. Doch alles Zureden Monas wirkte nicht viel. Manuela aß nur eine winzige Kleinigkeit und trank ihren Saft. Schon das strengte sie an, und sie schlummerte erneut ein.
»Ich bleibe hier im Zimmer, Mona. Willst du nicht inzwischen mit Alexander reden?«
»Doch nicht am Telefon, Mutti«, entgegnete Mona, die ihre Mutter wohl falsch verstanden hatte.
Regine merkte es sofort und sagte beschwichtigend: »Ich meine doch nur, was Manuelas Erkrankung betrifft, Mona. Mir ist schon klar, daß du die andere Sache nicht am Telefon mit Alexander besprechen, kannst.«
»Ich werde heute abend, wenn ich mit Alexander allein bin, alles hinter mich bringen. Ich fürchte mich zwar vor seiner Reaktion, doch ich sehe ein, daß ich es auch ihm nicht länger verschweigen kann.«
»Du hättest ihm schon damals alles sagen müssen, vielleicht wäre dann alles ganz anders gekommen. Ich bin nur gespannt, ob er zur Klinik kommt, wenn er von dir hört, wie es wirklich um unser Schätzchen steht.«
»Ich auch, Mutti. Darum werde ich jetzt hinunter in die Aufnahme gehen und ihn anrufen.«
»Tu das, Mona.«
Mit gemischten Gefühlen ging Mona hinunter.
Martin Schriewers, der informiert war, was es mit der Erkrankung der Elfjährigen auf sich hatte, verband Mona mit dem Hotel in Celle und zog sich dann diskret zurück.
Es dauerte nur ein paar Minuten, bis Mona am anderen Ende der Leitung die Stimme ihres Mannes hörte.
»Hallo, Alexander, ich bin es, Mona. Du hattest ja gesagt, daß du ab Mittag im Hotel zu erreichen wärst. Ich möchte dich nur darüber informieren, was Manuela fehlt.«
»Hat man überhaupt etwas gefunden, Mona?«
»Ja, Alexander, Manuela ist sehr krank. Es war für mich entsetzlich, als Frau Dr. Martens mir sagte, daß sie Leukämie hat. Ich habe solche furchtbare Angst um mein Kind.«
Einen Moment blieb es in der Leitung still, und Mona fragte: »Bist du noch da, Alexander?«
»Ja, ich bin noch da. Das ist ja schlimm, was du gerade gesagt hast. Ist kein Irrtum möglich?«
»Nein, ein Irrtum ist ausgeschlossen. Wenn nicht ein Wunder geschieht, dann, dann…« Mona stockte, sie brachte kein Wort mehr heraus, und Tränen schossen in ihre Augen.
»Nun mach dich nicht selbst verrückt, Mona. Es gibt doch heute auch bei dieser Erkrankung Wege, um sie aufzuhalten. Du mußt nicht alles immer gleich so negativ sehen.«
»Kannst du nicht kommen? Ich brauche dich doch jetzt.«
»Du weißt, wie sehr ich Krankenbesuche hasse, Mona. Was würde es denn nutzen, wenn ich auch noch da herumsitzen würde? Grüße Manuela von mir und sag ihr, daß ich sie in den nächsten Tagen besuchen komme. Wir unterhalten uns heute abend weiter darüber.«
»Du kommst also nicht?«
»Nein, Mona.«
Ohne ein Wort des Abschieds legte Mona einfach den Hörer auf und verließ mit gesenktem Kopf den kleinen Raum. Hatte sie wirklich etwas anderes von Alexander erwartet?
Regine Hauser zog sofort die richtigen Schlüsse, als Mona das Krankenzimmer wieder betrat.
»Er kommt also nicht, Mona?«
»Nein, Mutti, und ich möchte jetzt auch nicht weiter darüber reden. Ich warte nur noch ab, wie Alexander heute abend auf meine Beichte reagiert. Bitte, frag mich jetzt nichts.«
Erst gegen Abend fuhr Mona mit ihrer Mutter nach Celle zurück. Und erst, nachdem sie mit Alexander zu Abend gegessen hatte, fragte sie ihn: »Kannst du für ein paar Minuten mit in mein Zimmer kommen, Alexander? Ich muß dringend mit dir reden.«
»Können wir das nicht hier bei einem Glas Wein tun, Mona?«
»Nein, dazu möchte ich mit dir allein sein.«
»Gut, wenn du darauf bestehst. Gehen wir also hinauf«, entgegnete Alexander kühl.
Mit gesenktem Kopf, erst stockend dann immer fließender, erzählte Mona ihm von ihrer Vergangenheit, was sie ihm bis zu diesem Zeitpunkt verschwiegen hatte, und schloß: »Ich weiß, daß ich dir schon damals alles hätte sagen müssen. Doch zuerst hatte ich Angst, dich zu verlieren, und irgendwann war es zu spät. Kannst du mir mein Schweigen verzeihen?«
Mona hob den Kopf und erschrak vor dem Ausdruck in Alexanders Gesicht. Empörung und eisige Kälte schlugen ihr entgegen. Innerlich fröstelnd sah sie ihn an und wartete.
»Was soll ich? Ich soll dir verzeihen, daß du mich all die Jahre betrogen hast? Für was, für einen Trottel hältst du mich eigentlich, meine Liebe?«
»Ich habe dich nicht betrogen, dir nur etwas verschwiegen, Alexander. Warum bist du so hart? Hast du mich überhaupt jemals geliebt?«
»Das spielt jetzt keine Rolle mehr, denn ich könnte ja die gleiche Frage an dich stellen. Du hast alles zerstört. Zu denken, all die Jahre belogen worden zu sein, das trennt uns für immer. Und du wagst es, von Verzeihung zu reden. Nein, ich will dich nicht mehr, ich würde dir nie wieder etwas glauben. Sieh zu, wie du in Zukunft allein mit allem fertig wirst. Mit mir brauchst du nicht mehr zu rechnen. Ich fahre schon morgen früh nach Nürnberg zurück und werde meinen Anwalt informieren, damit er die Scheidungsklage aufsetzt.«
Alexander sah sie noch einmal von oben bis unten mit Verachtung an und verließ mit stolz erhobenem Kopf das Zimmer.
Einen Moment blieb Mona wie erstarrt sitzen. Das ist also das Ende meiner Ehe, schoß es ihr durch den Kopf.
Nur wenige Augenblicke später packte sie ihre Koffer, ließ noch eine kurze Nachricht für ihn zurück und verließ das Hotel, um zu ihrer Mutter zu fahren. Es gab so vieles, was nach diesem herben Schlag zu bedenken war.
Hanna hatte unterdessen schon einige Telefongespräche geführt, um ihr Versprechen, bei der Auffindung des adoptierten Mädchens zu helfen, halten zu können.
Doch da kam ihnen allen der Zufall zur Hilfe.
*
Ganz entgegengesetzt, am anderen Ende von Celle, lebte Roger Kröger, Elektromeister und Inhaber eines Elektrogeschäftes, mit seiner Mutter und seiner elfjährigen Tochter Christel.
Am Sonntagnachmittag ging er unruhig im Wohnzimmer seines kleinen Reihenhauses auf und ab.
Martha Kröger, eine schlanke Frau von achtundfünfzig Jähren, sah von ihrer Handarbeit auf und sagte mahnend: »Nun setz dich endlich hin, Roger. Mit deiner Rastlosigkeit machst du mich ganz nervös. Du fährst zu der Ausstellung, und damit basta. Im Geschäft läuft auch ohne dich für ein paar Tage alles gut, und ich werde hier im Haus ja wohl mit Christel fertig. Worüber machst du dir also Sorgen? Ich verstehe dein Zaudern einfach nicht. Vielleicht lernst du endlich jemanden kennen, und das Mädchen bekommt eine neue Mutter. Ich bin nicht mehr die Allerjüngste, und es ist weder für dich noch für Christel gut, allein zu bleiben.«
Martha Kröger meinte es gut mit ihrem Sohn, der vor etwas über einem Jahr seine Frau und Christels Mutter bei einem Unfall verloren hatte. Das hieß, es war nicht Christels leibliche Mutter gewesen, denn Roger und seine Frau Liane hatten Christel als neugeborenes Baby adoptiert. Liane hatte selbst keine Kinder bekommen können. So hatten sich beide für eine Adoption entschieden und es auch nie bereut. Christel, inzwischen elf Jahre alt, war seitdem Rogers Ein und Alles. Nach Lianes Tod, über den er lange nicht hinweggekommen war, wurde das Band zwischen Roger und Christel noch fester. Er liebte das zarte Mädchen wie sein eigen Fleisch und Blut. Doch auch das Mädchen liebte seinen Vati über alles.
»Du meinst also wirklich, ich könnte euch für ein paar Tage allein lassen, Mutter?«
»Natürlich, das meine ich doch schon die ganze Zeit, Roger. Ich werde sogar die Gelegenheit wahrnehmen und mit Christel nach Wintorf fahren, um wieder einmal meine Freundin zu besuchen. Eine kleine Abwechslung wird auch unserem Wildfang guttun. Du kannst dich also unbelastet auf die Ausstellung konzentrieren. Ich weiß doch genau, wieviel Interesse du an allen Neuerungen dieser Branche hast.«
»Na gut, dann bin ich einverstanden.«
Zwei Tage später fuhr Roger Kröger zu der für ihn so wichtigen Ausstellung nach Frankfurt.
Am Garagentor stand ein elfjähriges Mädchen mit kurzen blonden Locken und winkte so lange, bis der Wagen mit dem Vater hinter einer Straßenbiegung verschwand, erst danach ging es langsam durch den Vorgarten ins Haus zurück.
Prüfend sah Martha Kröger die Elfjährige an und sagte lächelnd: »Mußt nicht traurig sein, Christel. Vati kommt ja in ein paar Tagen wieder nach Hause. Wir beiden Hübschen werden uns die Zwischenzeit schon vertreiben. Was meinst du?«
»Ich bin nicht traurig, Oma. Ich habe nur immer Angst, daß Vati auch etwas passiert, wenn er mit dem Auto unterwegs ist.«
»Brauchst du nicht, Christel. Vati gibt auf sich acht. Ihm passiert schon nichts. Was meinst du, sollen wir morgen mit dem Bus nach Wintorf zu Tante Nette fahren? Es ist schon eine Weile her, seit wir sie das letzte Mal besucht haben.«
»Au ja, prima, Oma. Dann kann ich ja wieder mit der Susi, dem Lars und der Katrin spielen. Wann fahren wir denn?«
»Wenn du möchtest, gleich morgen nach dem Frühstück. Vielleicht bleiben wir auch für zwei Tage dort, damit dir die Zeit schneller vergeht, bis Vati wieder bei uns ist. Nun, sollen wir es so machen?«
»Ja, Oma, du bist die beste Oma auf der Welt, und ich habe dich sehr lieb.«
»Ich dich auch, du kleiner Wildfang, du«, sagte Martha Kröger und legte liebevoll einen Arm um das zierliche Mädchen.
»Klein, Oma? Ich bin doch schon elf und muß nur noch ein paar Jahre in die Schule gehen. Später brauchst du auch nicht mehr zu arbeiten, ich mach dann alles für dich.«
»Später, Christel, doch jetzt werden wir erst einmal zum Einkaufen gehen. Ich möchte nämlich noch einen Kuchen backen, den wir morgen mit zu Tante Nette nehmen. Du hast doch Lust zum Einkaufen, oder?«
»Na klar doch, Oma. Ich mach es auch allein, wenn du möchtest?«
»Ich weiß, du bist ein liebes Mädchen. Ich denke aber, heute gehen wir beide, ich möchte dir auch noch ein großes Eis spendieren. Also, lauf in dein Zimmer und zieh was Hübsches an. Wir fahren mit dem nächsten Bus in die Stadt.«
Ihrem Kosenamen alle Ehre machend, stob Christel wie ein Wirbelwind davon.
»Ich mach auch ganz schnell, Oma!« rief sie Martha Kröger noch zu, bevor die Tür mit einem lauten Knall hinter ihr zufiel.
Mit einem zärtlichen Lächeln sah Martha dem Mädchen nach. Das Mädel war wirklich manchmal zu lebhaft und ausgelassen. Sie selbst wurde langsam alt, konnte da nicht mehr mithalten. Roger sollte sich schon um Christels willen dazu entschließen, eine junge Frau ins Haus zu holen.
Christel brauchte junges Leben um sich und nicht nur immer sie alte Frau. Mit fast sechzig Jahren war sie eben kein junger Hüpfer mehr.
Es dauerte nicht lange, und Christel kam die Treppe herunter.
Jetzt wird es Zeit, dachte Martha Kröger. Rasch schlüpfte sie in ihren Staubmantel und nahm ihre Einkaufstasche. Noch ein Blick in ihre Geldbörse, ob sie auch genug Geld eingesteckt hatte, und fertig war sie. Da kam auch schon Christel in die Küche gewirbelt.
»Ich bin fertig, Oma, wir können jetzt zum Bus.«
»Geh, Christel, mußte das sein, schon wieder die ollen Jeans? Wir wollen doch in die Stadt fahren.«
»Ja und, Oma? Jeans sind doch so bequem. Ich mag sie eben. Es sind auch die neuen, die du mir erst vorige Woche gekauft hast. Vati mag es, wenn ich in Hosen herumlaufe. Du darfst auch nicht schimpfen. Sehe ich denn nicht schick aus mit meinem neuen Pulli?« Kokett drehte sich die Elfjährige vor ihrer Oma ein paarmal im Kreis herum.
»Na gut, meinetwegen. Du bist sowieso manchmal ein halber Junge. Beeilen wir uns, sonst fährt uns der Bus noch vor der Nase weg.«
Der Bus kam gerade um die Ecke, als Martha Kröger mit Christel an der Haltestelle anlangte.
»Siehste, Oma, da haben wir aber Glück gehabt. Es ist richtig prima, daß ich jetzt so lange nicht in die Schule muß.«
»Ich dachte immer, daß du gern zur Schule gehst?«
»Geh ich doch auch, Oma, aber Ferien sind auch was Feines. Fahren wir morgen früh auch mit dem Bus zu Tante Nette?«
»Wie denn sonst, Christel? Wenn Vati nicht mitfährt, bleibt uns wohl nichts anderes übrig.«
»Ob Tante Nette wohl noch immer die Muschi hat, Oma?«
»Natürlich, Christel. Ich habe zwar einige Tage nicht mit ihr telefoniert, aber ich weiß, daß die Muschi bald Junge bekommen wird. Vielleicht sind sie inzwischen auch schon da.«
»Oh, Oma, da freue ich mich aber. Was meinst du? Ob Vati mir wohl erlaubt, ein kleines Kätzchen in unser Haus zu holen?«
»Da mußt du ihn fragen. Er erlaubt es bestimmt, denn wir haben ja Platz genug im Haus und im Garten. So, wir sind gleich da. An der nächsten Haltestelle müssen wir aussteigen.«
Die Aussicht auf die jungen Kätzchen bei der Freundin der Oma, die sie von klein auf Tante Nette nannte, machte Christel ganz kribbelig, und Martha Kröger war am Ende froh, die Einkäufe und den Besuch in der Eisdiele hinter sich gebracht zu haben. Damit das Mädel beschäftigt war, ließ Martha es später beim Kuchenbacken helfen. Etwas, was die Elfjährige auch mit großer Begeisterung tat. So zart das Persönchen auch war, so viel Energie steckte auf der anderen Seite in der zierlichen Gestalt.
Doch auch dieser Tag ging zu Ende, und Martha fand noch Zeit, sich von der Hektik des Tages auszuruhen und abzuschalten.
*
Während der Busfahrt nach Wintorf, einem kleinen Ort in der Nähe von Ögela, war Christel wieder so aufgedreht wie am Nachmittag zuvor, und Martha mußte sie ein paarmal mahnen, doch still zu sitzen. Nach ungefähr einer Stunde Fahrtzeit waren sie am Ziel und stiegen aus dem roten Bahnbus aus.
»Hast du den Kuchen auch nicht vergessen, Oma?«
»Nein, habe ich nicht. Er ist hier in meinem Korb.«
»Darf ich den Korb tragen oder deine Tasche? Dann hast du es nicht so schwer, Oma.«
»Meinetwegen, nimm den Korb. Wir sind ja auch in ein paar Minuten bei Tante Nette. Wir werden sie heute einmal überraschen.«
Annette Richling, wie Martha Kröger achtundfünfzig Jahre alt, war eine mollige, mittelgroße Frau mit dunkelbraunem Haar. Sie war gerade im Garten damit beschäftigt, einige Wäschestücke auf die Wäscheleine zu hängen, als sie eine helle Mädchenstimme rufen hörte: »Tante Nette, Tante Nette, wo steckst du denn?«
Annette ließ alles liegen und stehen und eilte vor ihr Häuschen, wo Christel und Martha Kröger an der Haustür standen und klingelten.
»Du meine Güte, wo kommt ihr denn schon so früh her? Das ist aber eine schöne Überraschung.«
Schon war sie bei ihren Besuchern und streckte ihnen erfreut ihre Hände entgegen.
»Wir wollen dich besuchen, Tante Nette.«
»Das ist fein, Christel. Ich freue mich sehr darüber. Wartet, ich schließe gleich die Haustür auf, damit ihr ins Haus könnt.«
»Wir kommen dir doch hoffentlich nicht ungelegen, Nette?« fragte Martha die Freundin.
»Ihr kommt nie ungelegen, Martha, du kennst mich doch. Ich freue mich immer, wenn mich mal jemand besuchen kommt. Man sieht, daß es der Christel gutgeht. Sie hat ja richtig rote Wangen bekommen. Magst du ein Glas Milch, Mädel? Ich habe heute früh schon frische geholt.«
»Lieber eine Cola, Tante Nette.«
»Cola habe ich nicht im Haus, Christel. Ist ja auch nicht gesund für kleine Mädchen.«
»Ich bin doch nicht mehr klein, Tante Nette. Ich bin schon elf Jahre alt. Bei Vati und Oma darf ich schon mal Cola trinken.«
»Wir können ja nachher eine Flasche Cola kaufen. Inzwischen mußt du dich eben mit Milch oder Zitronenlimonade begnügen.«
»Limo mag ich auch.«
»Na fein, ich hole dir ein Glas.«
Annette Richling ging zum Kühlschrank, um die Limonadenflasche zu holen.
Christel sah sich um und fragte: »Wo ist denn deine Muschi, Tante Nette? Die Oma hat gesagt, daß sie bald junge Kätzchen bekommt. Stimmt das?«
»Du trinkst jetzt erst einmal deine Limonade, danach zeige ich dir etwas Hübsches, Christel. Du mußt aber ganz leise sein.«
»Ich sage kein Wort, ehrlich.«
Hastig trank die Elfjährige das Glas leer, das ihr Annette reichte, danach drängte sie: »Nun zeige es mir doch, Tante Nette, ich bin schon ganz neugierig.«
Annette und Martha tauschten verständnisvolle Blicke, und Annette sagte lächelnd: »Na, dann komm schon, du gibst ja sowieso nicht eher Ruhe.«
Leise öffnete sie einen Moment später die Wohnzimmertür und flüsterte Christel zu: »Schau neben dem Sessel nach, aber nicht anfassen, hörst du?«
Mit staunenden Augen sah Christel in das Körbchen, das neben dem Sessel stand. Da lag doch wahrhaftig die schneeweiße Katze Muschi, und an sie geschmiegt zwei winzige Katzenkinder. Eines war so weiß wie die Muschi und das andere ganz schwarz, mit einem weißen Flecken über der Nase.
»Oh, Tante Nette, sind die aber süß. Warum darf man sie denn nicht anfassen? Muschi kennt mich doch?«
»Sie sind erst vier Tage alt, Christel. Katzenmütter mögen es nicht, wenn man zu früh ihre Kinder anfaßt. Wenn Muschi aus ihrem Körbchen kommt, dann darfst du sie streicheln. So laß es lieber sein, sonst wird sie böse. Komm, wir lassen sie jetzt lieber wieder allein.«
»Schade, Tante Nette, sie sind doch so süß. Ich möchte daheim auch ein Kätzchen haben. Ich frage den Vati, ob er dir nicht eines abkauft. Machst du das?«
»Weißt du was, Christel? Wenn dein Vati dir erlaubt, ein Kätzchen zu haben, dann darfst du dir eines aussuchen. Aber du kannst es erst mit nach Hause nehmen, wenn es etwas älter ist. Nun, was sagst du dazu?«
»Hast du gehört, was Tante Nette gesagt hat, Oma?«
»Ja, ich bin doch nicht taub, Christel. Du mußt nur zuerst den Vati fragen, sonst geht gar nichts. Du kannst jetzt nach draußen und nachsehen, wo deine Freundinnen stecken. Lauf nur nicht zu weit fort, denn wenn Tante Nette das Essen fertig hat, rufen wir dich.«
»Au ja, prima, Oma, ich gehe zur Susi hinüber. Vielleicht sind Katrin und Lars auch da.«
»Geh nur und sei auch schön vernünftig, damit uns keine Klagen zu Ohren kommen.«
Die letzten Worten hörte Christel schon nicht mehr, denn wie ein kleiner Wirbelwind war sie zur Tür hinaus.
»Die Kleine ist also immer noch so ein Wildfang, Martha?« fragte Annette lächelnd.
»Wie du selbst sehen konntest«, entgegnete Martha.
»Und Roger, warum hat er euch nicht gebracht?«
»Er ist gestern nach Frankfurt zur Ausstellung gefahren. Ein paar Tage bleibt er fort, und da haben Christel und ich die Gelegenheit wahrgenommen, um dich zu besuchen.«
»Darüber freue ich mich wirklich sehr. Wenn man immer allein ist, weiß man erst, was eine liebe Freundin bedeutet. Wo sind nur die Jahre geblieben?«
»Man sieht es an den Kindern, Annette. Christel sorgt dafür, daß ich nicht einroste. Dabei wäre es mir schon lieb, wenn Roger sich nach einer jungen Frau umsehen würde. Du magst mir jetzt entgegenhalten, daß er Liane sehr geliebt hat und daß es noch zu früh ist, sich umzusehen. Er muß aber auch an Christel denken. Das Mädel ist in einem Alter, in dem es die liebevolle Hand einer Mutter braucht.«
»Da hast du vielleicht recht, Martha. Wir wollen aber jetzt an fröhlichere Dinge denken. Kümmern wir uns beide jetzt um das Mittagessen, dann können wir heute nachmittag einen langen Spaziergang in die Heide unternehmen. Der Tag ist viel zu schön, um ihn durch ernste Dinge zu trüben, obwohl die Zeiten für uns lange vorbei sind, so unbefangen wie Christel zu sein.«
»Ist ja auch wahr, Annette. Kümmern wir uns jetzt ums Essen, damit wir anschließend etwas unternehmen können. Sag mir nur, was ich machen soll.«
*
Eine von Christels Freundinnen, Susi Michels, wohnte nur ein paar Häuser weiter.
»Mensch, Klasse, Christel, daß du dich mal wieder sehen läßt. Bist du mit deinem Vati und mit deiner Oma gekommen?«
»Nur mit meiner Oma. Wir bleiben aber bis morgen nachmittag hier.«
»Toll, das müssen wir sofort Katrin erzählen. Ich wollte sowieso zu ihr. Du kommst doch mit, oder?«
»Ist doch klar. Ich muß nur zum Mittagessen wieder bei Tante Nette sein.«
»Da haben wir ja noch massig Zeit zum Spielen. Lars und Petra kommen auch. Wir wollen bei Katrin in der Scheune spielen. Wir haben uns auf dem Heuboden ein richtiges Nest gebaut. Es wird dir gefallen. Schade, daß du nicht länger hierbleiben kannst. Gerade jetzt in den Ferien wäre das prima. Na, ist ja auch egal. Bis morgen bleibst du ja hier.«
Fröhlich lachend rief Susi ihrer Mutter noch zu: »Wir gehen dann, Mutti.«
»Meinetwegen, aber du bist pünktlich zum Mittagessen wieder hier, verstanden? Und spielt vernünftig.«
»Machen wir, Mutti.«
Wenig später wurden Christel und Susi mit großem Hallo von drei weiteren gleichaltrigen Kindern empfangen. Gemeinsam gingen sie in die große Scheune, in der sie mit der Erlaubnis von Katrins Eltern spielen durften. Sie waren auch bald so mit ihren Spielen beschäftigt, als wäre Christel jeden Tag mit von der Partie.
Fröhlich turnten sie auf dem Heuboden herum. Sie bewarfen sich mit Heu, spielten Verstecken, und Christel war eine der Lebhaftesten.
Gerade als sie über einen Balken klettern wollte, rief Katrin ihr erschrocken zu: »Da auf die andere Seite dürfen wir nicht, Christel. Bleib hier, sonst fällst du noch runter und tust dir weh.«
»Ich fall schon nicht, Katrin. Komm doch rüber, hier ist das Heu noch viel weicher, und es riecht so gut. Oder hast du etwa…?« Mitten im Satz brach Christel ab, weil sie anfing zu rutschen. Verzweifelt suchte sie nach einem Halt. Ehe es jemand von ihren Spielkameraden verhindern konnte, rutschte sie über die Kante des Heubodens und stürzte mit einem hellen Aufschrei hinunter auf die Diele.
Lars, wie alle anderen auch elf Jahre alt, kletterte als erster die Leiter hinunter, gefolgt von Susi, Katrin und Petra.
»Christel, Christel, was ist denn, so steh doch auf!« rief Susi angstvoll und starrte auf die regungslose Gestalt ihrer Spielkameradin.
Katrin aber hastete davon und rief schon von der Scheunentür aus mit lauter, vor Angst schriller Stimme: »Mutti, Mutti, so komm doch und hilf der Christel, Mutti, komm schnell.«
Aufgeschreckt kam Gerda Kohler aus dem Wohnhaus.
»Warum schreist du denn so laut, Katrin?«
»Mutti, so komm doch! Die Christel ist vom Heuboden gefallen und steht nicht mehr auf. Bitte, bitte, Mutti, du mußt ihr doch helfen.«
»Du liebe Güte, wie konnte das nur passieren, Katrin? Geh und hol den Vati, er ist hinten im Pferdestall. Aber beeile dich.«
Während Katrin davonlief, eilte Gerda Kohler so schnell sie konnte in die Scheune.
Entsetzt weiteten sich ihre Augen, als sie die reglose Gestalt auf dem Dielenboden liegen sah.
Drei Augenpaare starrten sie verschreckt an, als sie fragte: »Wie ist das passiert, Kinder?«
»Sie ist abgerutscht, Frau Kohler, wir haben nicht helfen können. Ist die Christel tot?«
»Rede keinen Unsinn, Lars. Ihr lauft jetzt alle drei rasch zu Frau Richling, da ist die Christel ja zu Besuch, und sagt Bescheid, daß sie rasch kommen soll. Ein bißchen schnell.«
»Ja, Frau Kohler.«
Schon liefen Lars, Susi und Petra los.
Nur Augenblicke später kam Werner Kohler in die Scheune gelaufen. Er sah, daß sich seine Frau über die reglose Mädchengestalt beugte und fragte heiser: »Was ist mit dem Mädel, Gerda?«
»Sie atmet, und ich kann so auch nichts von äußeren Verletzungen feststellen, Werner. Aber ich trau mich nicht, sie zu bewegen. Wir müssen einen Krankenwagen rufen. Birkenhain ist ja nicht weit von uns entfernt. Ich befürchte, daß das Mädel sich innere Verletzungen zugezogen haben könnte.«
»Lauf du und ruf in der Klinik an. Sag, was passiert ist, die Ärzte in Birkenhain wissen schon, was zu tun ist. Ich kümmere mich inzwischen um das Mädel.«
Eilig lief Gerda Kohler davon, um die Kinderklinik zu informieren.
Werner Kohler beugte sich über das reglos daliegende Mädchen. Er schob seine Strickweste unter Christels Kopf und achtete darauf, daß sie beim Atmen nicht behindert wurde. Mehr konnte er auch nicht tun, als auf den Rettungswagen der Kinderklinik zu warten.
Gleichzeitig mit seiner Frau Gerda kamen auch Christels Oma und Annette Richling angelaufen.
»Was ist mit Christel, Frau Kohler? Die Kinder haben mir erzählt, daß sie irgendwo abgestürzt ist. Wo ist mein Enkelkind?«
»Ich habe gerade in der Kinderklinik angerufen, Frau Kröger. Was passiert ist, tut mir so leid. Kommen Sie bitte, Christel liegt in der Scheune. Sie ist vom Heuboden gestürzt.«
»O Gott, o Gott, ist es schlimm? Wie soll ich das nur meinem Jungen beibringen? Dabei kann ich ihn noch nicht einmal erreichen«, jammerte Martha Kröger, die nur mühsam ihre Fassung aufrechterhalten konnte.
»Wie schlimm es ist, weiß ich nicht, Frau Kröger. Äußerlich sichtbare Verletzungen hat sie nicht. Aber irgendetwas hat sie, weil sie noch immer ohne Besinnung ist.«
Bevor sie die Scheune erreichten, schickte Gerda Kohler noch die anderen Kinder heim und sagte zu ihnen: »Hier stört ihr jetzt nur. Katrin sagt euch morgen, oder vielleicht noch heute abend, wie schwer Christel sich bei dem Sturz verletzt hat.«
Mit hängenden Schultern schlichen Susi, Lars und Petra davon. Mit zitternden Lippen kniete Martha Kröger im nächsten Augenblick neben Christel und stammelte beschwörend: »Liebling, mein kleiner Wildfang, so mach doch endlich deine Augen auf. Ich bin doch hier, deine Oma.«
»Bitte, Frau Kröger, es hat keinen Sinn. Wir können nur warten. Ich denke jedoch, daß der Rettungswagen in wenigen Minuten hier sein wird.«
»Ich glaube, da kommt er schon«, sagte in diesem Moment Annette Richling und hob lauschend den Kopf.
Es war so, der Rettungswagen näherte sich sehr rasch. Werner Kohler atmete auf, denn es machte auch ihm Angst, daß das kleine Mädchen noch immer kein Lebenszeichen von sich gab. Er fühlte sich an dem Unglück mitschuldig, da er den Kindern ja erlaubt hatte, auf dem Heuboden zu spielen.
Man konnte jetzt nur darum beten, daß die Spielkameradin seiner Tochter keinen ernsthaften Schaden erlitten hatte.
Kurz darauf hielt der Rettungswagen der Kinderklinik vor dem Haus.
*
Nach der Visite am Morgen war Hanna nach Absprache mit ihrem Bruder nach Celle gefahren, um dort persönlich beim Leiter des Jugendamtes vorzusprechen. Einen Hausbesuch, den Hanna noch durchführen mußte, übernahm Kay.
Es war kurz nach elf Uhr, als Kay zu seinem Assistenzarzt sagte: »Ich werde jetzt den Hausbesuch für meine Schwester machen und anschließend gehe ich zu Tisch, Dr. Küsters. Im Augenblick liegt ja hier nichts Wichtiges an. Sie halten hier in der Zwischenzeit die Stellung. Wenn ich zurückkomme, können Sie dann wie vorgesehen ihren freien Nachmittag nehmen.«
»Wenn nicht wieder etwas dazwischenkommt, Chef«, erwiderte Michael Küsters.
»Wir wollen es nicht bereden«, antwortete Kay lächelnd und trug sich noch rasch aus der Anwesenheitsliste aus, bevor er mit langen Schritten die Klinik verließ.
Michael Küsters ging an seine Arbeit zurück, denn er mußte bei einem der kleinen Patienten mit einem gebrochenen Bein den Gips erneuern. Er war gerade damit fertig, als Martin Schriewers ihn von der Aufnahme aus anrief und sagte: »Ein Telefongespräch, Herr Dr. Küsters. Ich stelle zu Ihnen durch.«
»Danke, Herr Schriewers, ich übernehme.«
Michael hob den anderen Hörer ab. »Hier Kinderklinik Birkenhain, Dr. Küsters.«
Eine aufgeregte Frauenstimme sagte: »Mein Name ist Kohler, Herr Doktor. Hier ist gerade ein Unfall passiert. Ein Kind ist vom Heuboden gestürzt. Können Sie nicht den Rettungswagen schicken? Das Kind, ein Mädel von elf Jahren, ist ohne Besinnung.«
»Wo genau ist der Unfall geschehen?«
»Hier in Wintorf, obere Gasse, bei Kohler. Es ist das Anwesen am Ende. Bitte, kommen Sie schnell.«
»Der Rettungswagen wird sofort losfahren, Frau Kohler. Das verletzte Kind sollten Sie nach Möglichkeit nicht verlagern.«
Sofort, nachdem Michael Küsters den Hörer wieder aufgelegt hatte, gab er einige Anweisungen, damit im Operationssaal alles vorbereitet werden konnte. Dr. Dornbach, der hinzukam, übernahm es, das Operationsteam zusammenzuholen, denn da der Chefarzt im Augenblick nicht anwesend war, fuhr Michael Küsters mit dem Rettungswagen mit, um am Unfallort Erste Hilfe leisten zu können.
Da Wintorf nicht allzuweit von Ögela und der Kinderklinik entfernt war, war man sehr schnell am Ziel.
Mit langen Schritten eilte der Arzt auf das offenstehende Scheunentor zu, an dem eine junge Frau stand und heftig winkte. Die beiden Pfleger folgten mit der Trage.
Mit einem Blick übersah Michael Küsters die Situation.
»Bitte, machen Sie Platz«, forderte er kurz und beugte sich im nächsten Moment über das bewußtlose Mädchen. Während er umsichtig einige Reflexe prüfte und eine erste, kurze Untersuchung durchführte, dachte er: Gott sei Dank, das Kind ist nicht zu hart aufgeschlagen. Äußere Verletzungen konnte auch er nicht feststellen, und die Ohnmacht war wohl durch eine schwere Gehirnerschütterung ausgelöst worden.
Doch er erkannte auch sofort die Anzeichen einer inneren Verletzung. Alles deutete auf eine Verletzung des Zwerchfells hin. Das Kind mußte auf dem schnellsten Weg in den Rettungswagen, damit er sofort eine Thoraxdrainage einführen konnte.
»Darf ich mit in die Klinik fahren? Ich bin die Großmutter des Mädels«, bat Martha Kröger mit versagender Stimme, als die Pfleger die Trage in den Rettungswagen brachten.
»Es tut mir leid, dafür ist kein Platz, denn es müssen einige Sofortmaßnahmen ergriffen werden. Bitte, entschuldigen Sie, Frau…?«
»Kröger ist mein Name.«
»Entschuldigen Sie mich jetzt, aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Sie können ja dem Wagen folgen. Es wird sich sicher jemand dazu bereit erklären, Sie in die Klinik zu fahren.«
Schon stieg Michael Küsters zu dem verletzten Kind in den Wagen und schloß von innen die Tür.
Mit eingeschaltetem Martinshorn fuhr der Wagen davon.
Mit Martha Krögers mühsam bewahrter Fassung war es nun endgültig vorbei.
Tränen der Verzweiflung rannen unaufhaltsam über ihre Wangen.
»Bitte, Sie dürfen doch nicht so verzweifelt sein, Frau Kröger. Man wird Christel in der Kinderklinik ganz bestimmt helfen können. Mein Mann zieht sich nur rasch etwas anderes an und fährt Sie dann nach Birkenhain in die Klinik«, sagte Gerda Kohler und legte mit einer beruhigenden Geste einen Arm um Marthas zuckende Schultern.
»Frau Kohler hat sicher recht, Martha. Man wird Christel in der Klinik helfen. Du mußt dich etwas beruhigen, hörst du?«
Annette Richling trat nun neben die Freundin, nahm ihren Arm, und sie gingen nun alle zum Wohnhaus vor, aus dem in diesem Augenblick Werner Kohler kam und sagte: »Kommen Sie, Frau Kröger, ich fahre Sie in die Kinderklinik.«
Als sie dann neben Werner Kohler im Wagen saß und sie in Richtung der Kinderklinik losfuhren, sagte sie leise: »Wenn dem Kind etwas passiert, Herr Kohler, wie soll ich meinem Sohn je wieder unter die Augen treten? Er ist in Frankfurt auf einer Ausstellung und kommt erst morgen abend wieder zurück. Ich kann ihn noch nicht einmal benachrichtigen. Ich habe nicht gut genug auf Christel aufgepaßt.«
»Sie trifft keine Schuld, Frau Kröger. Wenn es einen Schuldigen an der ganzen Sache gibt, so bin ich derjenige. Mit meiner Erlaubnis haben die Kinder im Heu spielen dürfen. Sie spielen immer da, und es ist noch nie etwas passiert. Es sind doch schon vernünftige Kinder mit ihren elf Jahren. Ich habe nicht genug nachgedacht und aus diesem Vorfall viel gelernt. Auch ich bete zu Gott, daß der Christel bei dem Sturz nicht viel passiert ist. Zum Glück lag auf der Diele ziemlich viel Heu. Es hat den harten Aufprall sicherlich etwas gemildert. Ich bitte Sie, wenn Sie wieder nach Hause wollen, rufen Sie bei uns an. Ich hole Sie dann selbstverständlich von der Klinik ab.«
»Das geht doch nicht, Herr Kohler. Ich kann doch nicht noch mehr von Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Ich bin Ihnen schon dankbar, daß Sie mich zur Kinderklinik fahren.«
»Ich tu es gern und werde auf Ihren Anruf warten, Frau Kröger. Außerdem bleibe ich so lange in der Klinik, bis man sagen kann, welche Verletzungen sich die Christel bei dem Sturz zugezogen hat. Da, sehen Sie, da vorn ist schon die Kinderklinik Birkenhain.«
*
Im Laufschritt wurde die Trage mit dem verletzten Kind in die Notaufnahme gebracht.
»Sofort in die Röntgenabteilung und danach in den OP«, gab Michael Küsters Anweisung, bevor er sich an Dr. Dornbach wandte und fragte: »Ist Herr Dr. Martens inzwischen schon drüben im Doktorhaus eingetroffen, Malte?«
Malte Dornbach antwortete: »Bis vor wenigen Minuten noch nicht. Ich habe jedoch Frau Sanders gebeten, ihm sofort Bescheid zu geben, daß er hier dringend benötigt wird. Wie schaut es denn mit dem verletzten Mädchen aus?«
»Ich befürchte eine Zwerchfellruption. Eine Thoraxdrainage habe ich schon im Rettungswagen eingeführt. Außerdem habe ich auch schon Blut für die Blutgruppenbestimmung und für die Kreuzprobe entnommen. Man kann jetzt nur hoffen, daß der Chef schnell hier sein wird.«
»Wenn nicht, wirst du den operativen Eingriff vornehmen müssen, Michael.«
»Wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben, da ja auch Frau Dr. Martens nicht da ist.«
»Du kannst es«, entgegnete Malte Dornbach, der sich während der vergangenen Zeit auch privat mit Michael Küsters angefreundet hatte.
Wenig später stand die Diagnose, durch die Röntgenaufnahme bestätigt, fest. Es handelte sich tatsächlich um eine Zwerchfellruptur, die nur operativ behoben werden konnte. Die Patientin wurde in den Operationssaal gebracht, und die letzten Vorbereitungen wurden getroffen.
Malte Dornbach und Michael Küsters befanden sich noch im Waschraum, als Kay eintrat.
»Da sind Sie ja, Chef, es ist alles soweit vorbereitet«, informierte Michael seinen Vorgesetzten aufatmend.
»Sie hätten es auch allein geschafft. Ich habe mich schon anhand der Unterlagen ins Bild gesetzt.«
Nachdem auch Kay seine Hände gebürstet hatte und in den von Schwester Regine gehaltenen Operationskittel geschlüpft war, sagte er: »Also, meine Herren, dann wollen wir mal. Es ist zugleich auch der Einstand von Frau Dr. Wilde. Toi, toi, toi.«
Viel war von der Patientin für Kay nicht zu sehen, als er an den OP-Tisch trat, denn der Körper des Mädchens war bis auf das Operationsfeld mit sterilen Tüchern abgedeckt.
Die neue Anästhesistin Simone Wilde kontrollierte noch einmal mit einem Blick, ob alles in Ordnung war, und gab mit ihrem zustimmenden Nicken Kay das Zeichen zum Beginn des Eingriffes.
Die Operation verlief ohne Komplikationen, und erst als Christel vom OP-Tisch gehoben wurde, stutzte Kay und sah ungläubig auf das kleine Mädchen.
»Aber das ist doch die kleine Manuela Bischoff!« entfuhr es ihm verblüfft, und er warf einen verständnislosen Blick auf Michael Küsters, der sich gerade seinen Mundschutz entfernte.
»Irrtum Chef, die Kleine heißt Christel Kröger. Doch Sie haben recht – die kleine Bischoff und dieses Mädchen sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Daß ich darauf nicht sofort gekommen bin. Das ist vielleicht ein Zufall.«
»Zufall oder Schicksal, Dr. Küsters, wir werden es sehen. Es wäre ja nicht auszudenken, wenn dieses Mädchen das wäre, nach dem wir so dringend suchen. Sind die Angehörigen des Kindes hier?«
»Ich weiß nicht, ob die Großmutter des Mädchens inzwischen hier ist, Chef. Soll ich nachsehen?«
»Das werde ich übernehmen. Sorgen Sie dafür, daß die Patientin jetzt zunächst auf die Intensivabteilung gebracht wird. Ehe ich in unserer anderen Sache Fragen an die Großmutter stelle, möchte ich doch zuerst mit meiner Schwester reden, wenn sie von Celle zurückkommt. Wir können ja nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen, wie man so schön sagt.«
Noch einmal sah Kay sehr nachdenklich auf die kleinen Patientin, die nun von Michael Küsters und Schwester Regine aus dem Operationssaal geschoben wurde.
Nein, es kann eigentlich kein Irrtum möglich sein. Es kann sich bei diesem Mädchen nur um die Zwillingsschwester von Manuela handeln, ging es dabei durch seine Gedanken. Doch zuerst mußte er sich nun darum kümmern, ob ein Angehöriger des Mädchens in der Klinik eingetroffen war. Er entledigte sich seiner Operationskleidung, zog einen weißen Kittel über und verließ nun gleichfalls die Abteilung.
Auf dem Gang kam Kay Schwester Dorte entgegen. Freundlich wollte er wissen: »Sind schon Angehörige des kleinen Unfallopfers in der Klinik eingetroffen, Schwester Dorte?«
»Ja, Herr Dr. Martens. Im Wartezimmer warten schon seit Beginn der Operation die Großmutter des Mädchens und ein junger Mann.«
»Vielen Dank, ich werde mich sofort um die Herrschaften kümmern.«
Als Kay das Wartezimmer betrat, kam eine aufgeregte ältere Dame auf ihn zu. Mit verzweifelter Stimme, die vor Erregung wie geborsten klang, fragte sie: »Was ist mit meiner Enkeltochter, Herr Doktor? Ist es sehr schlimm?«
»Sie sind also die Großmutter der Patientin? Ich bin Dr. Martens und habe das Mädchen bis vor wenigen Minuten operiert. Das Mädchen hat sich außer einer schweren Gehirnerschütterung einen Zwerchfellriß zugezogen. Es geht ihm jetzt den Umständen entsprechend. Machen Sie sich keine Sorgen, es wird alles wieder in Ordnung kommen.«
»Gott sei Dank«, entfuhr es Werner Kohler, der sich im Hintergrund gehalten hatte.
»Sind Sie der Vater der Patientin?« Fragend sah Kay den jungen Mann an.
»Nein, Herr Dr. Martens. Mein Name ist Kohler. Auf meinem Anwesen ist der Unfall geschehen. Ich habe Frau Kröger nur in die Klinik gebracht.«
»Und wo befinden sich die Eltern? Sind sie schon informiert, Frau Kröger?«
Aufmerksam betrachtete Kay die Oma der Kleinen.
»Die Mutter von Christel ist vor gut einem Jahr gestorben, Herr Dr. Martens. Den Vater, meinen Sohn, kann ich telefonisch nicht erreichen. Er kommt erst morgen von einer Ausstellung zurück. Wird Christel die Operation überstehen?«
»Natürlich. Da ist noch etwas. Im allgemeinen sind wir an bestimmte Bedingungen gebunden, die besagen, daß bei Operationen das schriftliche Einverständnis vorliegen muß. Bei Ihrer Enkeltochter konnten wir darauf keine Rücksicht nehmen, da ein Notfall vorlag. Es mußte sehr schnell gehandelt werden, da innere Blutungen vorlagen.«
»Die Hauptsache ist doch, daß Sie helfen konnten, Herr Dr. Martens. Da ist doch alles andere unwichtig.«
»Wenn Sie es auch so sehen, ist es für mich eine große Erleichterung, Frau Kröger. Hier in Birkenhain ist Ihre Kleine gut aufgehoben, und es wird alles für sie getan, damit sie wieder völlig gesund wird.«
»Ich glaube und vertraue Ihnen, Herr Dr. Martens. Darf ich Christel jetzt sehen?«
»Ja, aber nur einen Moment, Frau Kröger. Wir haben das Mädel auf die Intensivabteilung gelegt, wo sie während der nächsten vierundzwanzig bis achtundvierzig Stunden unter ständiger ärztlicher Kontrolle steht. Erst wenn wir sicher sind, daß keine unvorhergesehenen Komplikationen mehr eintreten können, werden wir sie auf die Krankenabteilung verlegen. Haben Sie sonst noch Fragen?«
»Nein.«
»Gut, Frau Kröger. Bevor ich Sie zur Intensivabteilung bringen lasse, möchte ich noch einige Angaben für das Krankenblatt: das Alter der Kleinen, Adresse und Telefonnummer, wo man Sie notfalls erreichen kann.«
Martha Kröger gab ihm die notwendigen Angaben, und Kay ließ sich natürlich nichts davon anmerken, daß ihn besonders das Alter und das Geburtsdatum der kleinen Patientin interessierten.
*
Da Hanna nicht mehr ins Klinikgebäude kam, konnte Kay erst mit ihr über den Fall sprechen, als er an diesem Tag in der Klinik fertig war und ins Doktorhaus zurückging.
Jolande hatte gerade frischen Kaffee aufgebrüht, da man etwas verspätet Kaffee trinken wollte, als Kay an der Wohnungstür klingelte.
»Das kann um diese Zeit eigentlich nur Kay sein, Hanna«, sagte Bea Martens lächelnd zu ihrer Tochter, und Jolande ging rasch zur Tür, um zu öffnen.
»Ist meine Schwester schon daheim, Füchsin?« fragte Kay.
»Ja, sie ist da. Kommen Sie nur herein. Sie können gleich mit uns Kaffee trinken. Ich habe auch Kuchen gebacken.«
»Das laß ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Appetit habe ich schon. Außerdem hat Frau Sanders heute ihre freien Nachmittag genommen.«
»Dann paßt es ja ausgezeichnet, Herr Doktor. Gehen Sie schon mal hinein, ich bringe sofort noch ein Gedeck.«
»Hallo, Kay. Du bist wohl neugierig, ob ich heute schon etwas auf dem Jugendamt erreicht habe?« empfing Hanna ihren Bruder und lächelte ihm vielsagend zu.
»Tag, Mutti, Tag, Hanna. Teils, teils, denn ich habe auch Neuigkeiten, die sich hören lassen können. Doch willst du mich nicht zuerst zu einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen einladen? Bei mir ist heute nämlich das Mittagessen ausgefallen.«
»Na, wenn es so ist, nimm bitte Platz. Wie ich die Füchsin kenne, holt sie schon ein Gedeck für dich.«
»Schon da, Hanna«, kam da die fröhliche Stimme Jolandes von der Tür her. Sie stellte das Gedeck vor Kay hin und goß danach auch für alle Kaffee ein, bevor sie sich ebenfalls setzte.
Alle ließen es sich schmecken. Nach dem Essen lehnte Kay sich zurück und sagte: »Das hat gutgetan. Fürs Erste ist mein Hunger gestillt.«
»Nun, Bruderherz, willst du deine Neuigkeiten zuerst loswerden, oder soll ich?«
»Erzähl, Hanna. Hast du schon etwas erreichen können?«
»Nur einen Teilerfolg, Kay. Morgen im Laufe des Vormittags kann ich anrufen und bekomme dann die Adresse der Leute, die damals das kleine Mädchen adoptiert haben. Es sind noch verschiedene Rückfragen notwendig. Hört sich doch schon ganz gut an, nicht wahr? Jetzt laß aber hören, was du für Neuigkeiten auf Lager hast. Deinem zufriedenen Gesichtsausdruck nach muß es schon was Gutes sein.«
»Der Grund für mein ausgefallenes Mittagessen war ein Notfall. Ich war ja kurz vor der Mittagszeit zu den Petersens gefahren, als Dr. Küsters zu einem Unfall gerufen wurde. Ein kleines Mädchen war in einer Scheune vom Heuboden gestürzt und hatte sich dabei innere Verletzungen zugezogen.«
»Und das nennst du eine gute Nachricht, Kay?«
»Laß mich weiter berichten, Hanna. Wir haben die Kleine, bei der außer einer schweren Gehirnerschütterung auch eine Zwerchfellruptur vorlag, erfolgreich operiert. Sie wird also wieder gesund werden. Das zum ersten Teil meines Berichtes. Das Erfreuliche kommt jetzt. Ich habe mir das Mädchen erst nach der Operation genau ansehen können. Vorher war alles schon für den Eingriff vorbereitet gewesen. Also, kurz und gut, als ich das Mädchen nach dem Eingriff genau sah, glaubte ich in meiner ersten Verblüffung Manuela Bischoff vor mir liegen zu sehen. Du kannst dir eine derartige Ähnlichkeit überhaupt nicht vorstellen. Sie gleichen einander wie ein Ei dem anderen. Von der Großmutter des Mädchens bekam ich dann genaue Angaben. Die Kleine, Christel heißt sie, ist vor etwas über elf Jahren am 28. Mai in Celle geboren. Nun, Schwesterherz, was sagst du nun zu meiner Neuigkeit?«
»Wenn du recht hättest, wäre es einfach phantastisch, Kay. Du hast ja auch die Anschrift, oder?«
»Nur die in Wintorf. Frau Kröger besucht dort im Augenblick eine Freundin. Die kleine Christel hat im Übrigen vor über einem Jahr ihre Mutter verloren. Der Vater, der sich noch bis morgen auf einer Ausstellung befindet, ist telefonisch nicht erreichbar. Wir müssen also so und so abwarten. Selbst wenn es sich bei dem Mädel um die Zwillingsschwester handeln sollte, sind uns noch für ein paar Tage die Hände gebunden. Wir müssen während dieser Zeit alles unternehmen, um Manuela Erleichterung zu verschaffen. Wir müssen die schwachen Kräfte stabilisieren.«
»Ich wünsche euch von ganzem Herzen, daß euch euer Vorhaben gelingt«, sagte Bea Martens mit viel Zuversicht. »Das Schicksal scheint es noch einmal gut zu meinen. Ihr dürft jetzt nur nicht auf halbem Weg aufgeben.«
»Aufgeben, Mutti, niemals«, erwiderte Hanna mit fester Stimme, und Kay nickte dazu bekräftigend.
Auch nachdem Jolande schon lange den Kaffeetisch abgedeckt hatte, unterhielten sich Bea Martens und ihre beiden Kinder über medizinische Fälle der Klinik.
»Du warst heute nicht drüben, Mutti? Warum?«
»Ich habe mich nicht so recht wohl gefühlt, Kay. Ich hole alles morgen nach. Die beiden Mädchen werde ich mir dann auch ansehen.«
»So war das nicht gemeint, Mutti. Du mußt es ja nicht. Es fiel mir nur auf.«
»Ich weiß, daß ich nicht muß, Kay. Ich habe jedoch zuerst befürchtet, daß bei mir eine Erkältung im Anzug ist, und ich will auf keinen Fall die kleinen Patienten gefährden. Es ist inzwischen schon so weit, daß ich die Kinder vermisse, wenn ich mal einen Tag aussetze. Es fehlt mir dann etwas. Es ist ein schönes Gefühl zu erkennen, daß man von den kranken Kindern gebraucht wird. Kleine Spiele, ein Märchen erzählen, über die kindlichen Probleme reden. Wie dankbar die Kinder doch schon für diese kleinen Zuwendungen sind.«
»Wie fühlst du dich denn jetzt, Mutti?« wollte Hanna wissen.
»Ausgezeichnet, Hanna.«
»Fein, Mutti, dann können wir ja noch vor dem Abendessen einen kleinen Spaziergang machen. Wie ist es mit dir, Kay? Hast du keine Lust, uns zu begleiten?«
»Heute nicht, Hanna. Ich möchte mir noch einiges an Fachliteratur durchsehen. Geht ihr zwei Hübschen ruhig allein. Für mich wird es Zeit, in meine vier Wände zu kommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen unterhaltsamen Abend. Wir sehen uns ja morgen früh in der Klinik drüben, Hanna.«
»Da kannst du mal sehen, Mutti. Dein Sohn ist nur zu faul zum Laufen«, neckte Hanna den Bruder, der sich rasch aus dem Staub machte und sie und die Mutter allein ließ.
*
Mona verbrachte an diesem Tag wieder viele Stunde bei Manuela im Krankenzimmer. Es war nicht leicht für sie, ihrem Mädel immer ein lächelndes Gesicht zeigen zu müssen, wo ihr doch eher zum Weinen zumute war. Als Manuela irgendwann am Nachmittag mit matter Stimme fragte: »Warum kommt Vati denn nicht in die Klinik, Mutti?« mußte sie sich noch mehr zusammennehmen.
»Vati mußte schon zurück nach Hause, Liebes. Wir zwei bleiben aber noch ganz lange hier bei der Oma. Auch wenn du die Klinik verlassen darfst. Freust du dich nicht darüber, ganz bei der Oma zu bleiben, Mutti?«
»Vielleicht tun wir das, doch erst mußt du ganz gesund werden.«
»Darf ich dich etwas fragen, Mutti?«
»Natürlich, was möchtest du denn gern wissen?«
»Was fehlt mir, Mutti? Werde ich überhaupt wieder gesund oder muß ich sterben?«
»Manuela, Liebling, was redest du nur für einen Unsinn? Natürlich wirst du wieder gesund. Manchmal dauert es eben nur ein bißchen länger.«
»Du sollst mich nicht anschwindeln, Mutti. Keiner sagt mir etwas, wenn ich frage. Warum tun alle so, als wäre ich ein kleines Baby. Immerzu wird mir Blut abgenommen. Ich will das nicht. Vielleicht werde ich dadurch immer so müde. Es ist mein Blut, und ich will es behalten.«
»Aber Liebling, du sollst dich doch nicht aufregen. Dein Blut braucht man doch, um es zu untersuchen. Frau Dr. Martens muß doch wissen, was sie dir für Medikamente geben darf und welche nicht. Du bist zwar sehr krank, aber du wirst wieder gesund werden. Ich sage dir doch immer die Wahrheit.«
»Dann sag mir, wie die Krankheit heißt, die ich habe, Mutti. Ich will es wissen, damit ich mich nicht länger davor fürchten muß, einzuschlafen. Ich träume dann immer so ganz komische Sachen. Bitte, Mutti, ich bin doch schon elf, und es dauert nicht mehr so lange, bis ich zwölf werde.«
Die großen fragenden Augen in dem schmal gewordenen Gesicht Manuelas ließen Monas Blicke nicht los. Was sollte sie nur für eine Antwort auf die Fragen geben? War es für Manuela gut, wenn sie die Wahrheit erfuhr? Mona dachte an die Erklärungen der Ärztin. An die Möglichkeit einer Knochenmarkübertragung. Würde Manuela es überhaupt verstehen? Ein paar Sekunden zögerte sie noch, dann gab sie sich einen inneren Ruck. Sie beugte sich über Manuela, umschloß deren beide Hände mit warmem Druck und sagte weich: »Ich will versuchen, es dir zu erklären, mein Liebling. Du mußt mir jetzt genau zuhören.«
Mit behutsamen Worten versuchte Mona ihrer Elfjährigen nun ihre Krankheit zu erklären. Sie gab auch an ihr Mädchen weiter, was sie von Hanna über eine Knochenmarkübertragung wußte. Sie klammerte nur aus, daß für eine solche Übertragung nur ein Geschwisterkind in Frage kommen würde.
Stumm lauschte Manuela den Worten ihrer geliebten Mutter. Als diese ihr alles gesagt hatte, schwieg sie einen Moment, und Mona sah ihr an, daß sie angestrengt über irgendetwas nachdachte.
Als Mona weich fragte: »Bist du jetzt zufrieden, mein Liebling?« entgegnete Manuela leise: »Ja, Mutti, und ich habe jetzt auch gar keine Angst mehr. Wenn Frau Dr. Martens niemanden findet, dann darfst du nicht traurig sein, wenn mich der liebe Gott zu sich in den Himmel holt.«
»Still, Liebling, das wird nicht geschehen. Wir wollen uns das Leben doch schön mit Oma machen. Schwester Laurie wird dir gleich wieder deine Medizin bringen, und danach wirst du schlafen, und ich fahre zu Oma nach Hause. Morgen kommt die Oma wieder mit in die Klinik. Weißt du, du mußt ganz fest wollen, daß du recht bald wieder gesund wirst, dann hört dich unser Herrgott im Himmel und erfüllt deinen Wunsch.«
»Ich möchte auch schlafen, Mutti, ich bin schon wieder sehr müde. Wann kommt Schwester Laurie denn mit meiner Medizin?«
»Ich werde mal nachschauen. Ich komme sofort wieder zurück.«
Mit weichen Knien ging Mona aus dem Zimmer. Draußen auf dem Gang lehnte sie sich für ein paar Sekunden kraftlos gegen die Wand. War es richtig gewesen, Manuela die Wahrheit über ihre Erkrankung zu sagen? Sie war auf einmal nicht mehr sicher, sich richtig entschieden zu haben.
»Ist Ihnen nicht gut, Frau Bischoff?« hörte sie plötzlich vor sich die besorgte Stimme Schwester Lauries.
Erschrocken öffnete sie ihre Augen und sah auf die junge Schwester, die sie besorgt betrachtete.
»Es ist nichts, Schwester Laurie, mir geht es gut.«
»Bestimmt, Frau Bischoff? Vielleicht sollten Sie mal die Kantine aufsuchen und sich etwas stärken.«
»Es ist wirklich alles in Ordnung, Schwester Laude. Ich habe aber eine Bitte an Sie. Wenn ich nachher die Klinik verlasse, könnten Sie und auch Ihre Ablösung später etwas mehr als üblich auf Manuela achten? Ich habe meiner Tochter auf ihr Drängen hin die Wahrheit über ihre Krankheit gesagt. Ich bin mir jedoch nicht mehr so sicher, ob ich mich richtig entschieden habe. Manuela ist vielleicht doch noch zu jung, um alles richtig begreifen zu können.«
»Selbstverständlich achten wir ganz besonders auf Ihre Tochter, Frau Bischoff. Und ob Ihre Entscheidung gut war, kann ich nicht so beurteilen wie Frau Dr. Martens. Es ist aber in vielen Fällen so, daß die erkrankten Kinder so sensibel werden, daß sie spüren, wenn man ihnen laufend etwas vormacht. Und Kinder, die die Wahrheit erfahren, lehnen sich innerlich auf, fangen an zu kämpfen. Sprechen Sie morgen früh mit Frau Dr. Martens darüber. Sie kann Ihnen bestimmt eher etwas dazu sagen. Um Manuela sorgen Sie sich nicht, wir werden nun ein ganz besonderes Auge auf sie haben. Sie können sich darauf verlassen.«
»Ich danke Ihnen, Schwester Laurie. Eigentlich wollte ich zu Ihnen, um Sie zu fragen, wann Manuela ihre Medizin bekommt. Das Mädel ist müde und möchte schlafen.«
»Ich war auf dem Weg zu ihr, Frau Bischoff. Sie wird danach bestimmt wieder die ganze Nacht durchschlafen.«
»Das wäre zu wünschen. Ich fahre dann auch gleich heim, da ich morgen vormittag frühzeitig hier in der Klinik sein möchte.«
Mona folgte der jungen Schwester ins Krankenzimmer. Eine Viertelstunde später verließ sie die Klinik für diesen Tag und fuhr zu ihrer Mutter zurück.
*
Als Hanna am frühen Morgen das Klinikgebäude mit Kay betrat, sagte sie: »Ich muß zuerst auf die Intensivabteilung, um mir das Mädel anzusehen. Es läßt mir eher keine Ruhe. Wenn das stimmt, was du gestern am Spätnachmittag gesagt hast, habe ich schon etwas in der Hand, wenn der Anruf vom Jugendamt für mich kommt.«
»Geh und du wirst mir recht geben, Hanna. Da ich die vergangene Nacht ohne Störungen schlafen konnte, nehme ich an, daß die Kleine eine ruhige Nacht hatte.«
»Es ist anzunehmen. Bis gleich bei der Besprechung.«
Hanna war genauso verblüfft, als sie Augenblicke später die kleine Patientin sah, wie es ihr Bruder am Tag zuvor gewesen war.
Es war schon eine seltsame Fügung des Schicksals, daß die beiden Mädchen zur gleichen Zeit in der Klinik waren. Das mußte doch für Manuela ein gutes Omen sein. Jetzt würde es wohl nur darauf ankommen, sich mit dem Vater des Mädchens, wenn es wirklich der Adoptivvater war, zu einigen. Hanna hoffte, daß er nicht so herzlos war, die Bitte einer verzweifelten Mutter abzuschlagen. Dabei wußte Hanna in diesem Augenblick überhaupt noch nicht, wie sie nun weiter vorgehen sollte. Zunächst galt es noch, den Anruf des Jugendamtes abzuwarten.
Hanna kontrollierte die Werte und ließ sich von Schwester Margret, die ihren Frühdienst inzwischen angetreten hatte, den Bericht der Nachtbereitschaft geben. Es waren keine besonderen Vorkommnisse eingetragen, also hatte die kleine Patientin eine ruhige Nacht hinter sich, und zufrieden mit dem Verlauf verließ Hanna die Intensivabteilung.
Nach der anschließenden Frühbesprechung durchquerte sie gerade die Eingangshalle, als zwei ältere Damen das Gebäude betraten.
Hanna blieb einen Moment abwartend stehen und sagte: »Guten Morgen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich bin Frau Dr. Martens.«
»Guten Morgen, Frau Dr. Martens. Ich bin Martha Kröger. Meine Enkeltochter ist gestern nach einem Unfall zu Ihnen in die Klinik gebracht worden. Ich möchte gern wissen, ob ich heute zu ihr kann«, antwortete eine der Frauen, Martha Kröger.
»Es ist für einen Besuch etwas zu früh, Frau Kröger. Ihre Enkeltochter befindet sich noch auf der Intensivabteilung. Ich kann Sie jedoch beruhigen. Das Mädel hatte eine ruhige Nacht. Durch die schwere Gehirnerschütterung ist es noch nicht wieder voll da und braucht zunächst viel Ruhe.«
»Darf ich sie denn wenigstens sehen? Mein Sohn, der mich gestern bei meiner Freundin angerufen hat, befindet sich schon auf dem Weg hierher. Ich möchte ihm doch wenigstens sagen können, daß ich Christel sehen konnte.«
»Natürlich dürfen Sie das Mädel sehen. Doch nur für ein paar Minuten. Vielleicht können wir Manuela morgen früh auf die Krankenstation verlegen, dann dürfen Sie bleiben, solange Sie wollen. Ich habe aber noch eine Bitte. Sollte Ihr Sohn kommen, so soll er nach mir fragen. Ich möchte mich gern zuerst mit ihm unterhalten.«
»Ich werde es ihm ausrichten, Frau Doktor. Er wird wohl zuerst kurz in Celle vorbeifahren, um von zu Hause einige Kleidungsstücke für mich und Christel mitzubringen.«
»Ihr Wohnort ist also Celle?«
»Ja, Celle, Rückertsweg 17, Frau Doktor. Ich bin hier in Wintorf nur zu Besuch bei meiner Freundin. Wenn ich vorstellen darf? Das ist meine Freundin, Annette Richling.«
»Es freut mich, Sie kennenzulernen, Frau Richling.« Freundlich reichte Hanna der Begleiterin Martha Krögers, die sich etwas im Hintergrund gehalten hatte, ihre Hand.
Hanna sah kurz auf ihre Uhr. Es wurde Zeit für sie, die Visite vorzubereiten. Sie rief Schwester Dorte herbei, die Martha Kröger und ihre Freundin zur Intensivabteilung brachte.
Hanna ging nun endgültig hinauf auf die Krankenstation, um sich ihren anderen Aufgaben zu widmen. Hin und wieder warf sie einen Blick auf die Uhr, da sie ja den Anruf des Jugendamtes erwartete. Sie war schon sehr gespannt darauf, ob sich die Anschrift von Martha Kröger mit der Adresse, die man ihr mitteilen wollte, decken würde.
Schwester Laurie, die gerade aus dem Krankenzimmer kam, trat auf Hanna zu und fragte: »Haben Sie einen Augenblick Zeit, Frau Doktor?«
»Natürlich, Schwester Laurie. Gibt es irgendwelche Probleme?«
»Es könnten vielleicht welche werden. Ich habe gestern abend noch Gelegenheit gehabt, mit Frau Bischoff zu sprechen. Das Mädel hat die Mutter so lange bedrängt, bis diese ihr die Wahrheit über ihre Krankheit gesagt hat. Ich habe Frau Bischoff geraten, mit Ihnen darüber zu reden, denn sie war sich nicht mehr sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ich wollte Sie nur vorab informieren.«
»Vielen Dank, Schwester Laurie. Wie gibt sich das Mädel denn heute morgen?«
»Sie ist sehr ruhig, Frau Doktor. Es hat zumindest den Anschein, als hätte sie die Wahrheit gut verkraftet.«
»Gut, dann werde ich mich jetzt mal um Manuela kümmern. Noch einmal vielen Dank, daß Sie mich aufgeklärt haben. Ich erwarte noch einen Anruf, der im Zusammenhang mit Manuela äußerst wichtig ist. Bitte, rufen Sie mich, wenn der Anruf kommt.«
»Selbstverständlich, Frau Doktor.«
»Guten Morgen, Manuela, du bist ja sogar wach«, begrüßte Hanna ihre jungen Patientin, als sie das Krankenzimmer betrat.
»Guten Morgen Frau Doktor. Ich habe doch ganz lange geschlafen«, antwortete Manuela leise.
»Und wie fühlst du dich? Die Medikamente scheinen dir ganz gut zu bekommen.«
»Ich fühle mich nur so schlapp, Frau Doktor. Ich habe jetzt auch nicht mehr solche Angst, denn meine Mutti hat mir gestern gesagt, welche Krankheit ich habe. Ich habe nur noch nicht alles verstanden.«
»Was hast du nicht verstanden, meine Kleine?«
»Mutti hat gesagt, daß meine. Krankheit Leukämie heißt. Wir haben in der Schule mal darüber gesprochen, und da sagte unsere Lehrerin, daß Leukämie eine Blutkrankheit ist. Mutti hat aber zu mir gesagt, daß Sie jemanden finden müssen, von dem ich gesundes Knochenmark übertragen bekomme.«
»Das ist richtig, denn es gibt verschiedene Formen dieser Krankheit. In deinem Fall ist das Knochenmark krank und kann nicht mehr die Blutkörperzellen bilden, die notwendig sind. Wenn wir nun gesundes Knochenmark übertragen können, sterben die kranken Zellen ab, und du wirst wieder gesund. Verstehst du, was ich dir sagen will?«
»Ja, aber tut das nicht sehr weh?«
»Nein, du wirst es überhaupt nicht spüren. Weißt du, Manuela, ich finde, du bist ein sehr kluges und tapferes Mädchen. Deine Mutti kann stolz auf dich sein. Fühlst du dich denn besser jetzt, wo du genau Bescheid weißt?«
»Ja, Frau Doktor, denn ich habe jetzt nicht mehr solche Angst, einzuschlafen und nie wieder wach zu werden.«
»Das brauchst du auch nicht. Bald wird es dir bessergehen.«
»Das möchte ich so gern, Frau Doktor. Ich werde den lieben Gott darum bitten, daß er Ihnen jemanden schickt, damit Sie mich gesund werden lassen.«
»Das ist fein, er wird deine Bitte bestimmt hören. Jetzt muß ich dich wieder allein lassen. Es sind hier in der Klinik noch viele Kinder, die auch krank sind und meine Hilfe brauchen. Wenn deine Mutti später kommt, schaue ich noch einmal nach dir. Wenn etwas ist, weißt du ja, daß du Schwester Laurie alles sagen kannst.«
Hanna ließ Manuela allein und ging kurz ins Schwesternzimmer, um noch etwas mit der Oberschwester zu besprechen, als der erwartete Anruf des Jugendamtes kam.
Als sie die Adresse hörte, die man ihr durchgab, fiel ein zentnerschwerer Brocken von ihrer Seele. Die Adresse lautete: Familie Roger Kröger, Celle, Rückertsweg 17.
*
Es war kurz vor der Mittagszeit, als Martin Schriewers Hanna meldete, daß gerade ein Herr Kröger eingetroffen sei und sie sprechen wollte.
»Schicken Sie den Herrn in mein Sprechzimmer, Martin. Es ist der Vater der kleinen Patientin, die gestern nach dem Unfall operiert worden ist. Ich erwarte Herrn Kröger.«
»In Ordnung, ich schicke ihn durch, Hanna.«
Augenblicke später betrat ein sehr besorgter junger Mann nach kurzem Anklopfen Hannas Sprechzimmer.
»Guten Tag, Frau Dr. Martens. Sie wollten mich sprechen? Geht es meiner Tochter schlechter? Ich habe nur durch einen zufälligen Telefonanruf bei der Freundin meiner Mutter erfahren, was mit meiner Christel passiert ist. Ich habe mich danach sofort auf den Heimweg gemacht und hier bin ich. Bitte, ich muß wissen, was ist mit meinem Kind?«
»Ihrer Tochter geht es gut, so weit man es nach der Operation sagen kann. Die vergangene Nacht ist sehr ruhig verlaufen. Sie hat noch großes Glück gehabt.«
»Darf ich zu meiner Tochter?«
»Ja, natürlich, Herr Kröger. Ich möchte jedoch zuerst noch etwas anderes mit Ihnen besprechen. Es geht dabei um eine todkrankes Kind, das an Leukämie leidet.«
»Wie kann ich jetzt an andere Dinge denken als an mein Kind, Frau Dr. Martens?«
»Ich bitte Sie darum. Bitte, werfen Sie nur einen kurzen Blick auf dieses Kind, es ist auch ein Mädchen, und Sie werden mich danach verstehen.«
»Gut, wenn Ihnen so viel daran liegt, werde ich Ihrer Bitte nachkommen und mir dieses fremde Mädchen ansehen.«
»Danke, Herr Kröger, es wird auch nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie bitte mitkommen würden.«
Während Hanna mit Roger hinauf auf die Krankenstation ging, dachte sie: Ob ich damit wohl das Richtige mache? Aber wenn er Manuela erst sieht, ist ihm leichter verständlich zu machen, welche Hilfe sie von ihm erwartete.
Oben auf dem Gang kam ihnen Mona Bischoff entgegen. Hanna entging nicht, daß der junge Mann Mona verblüfft anstarrte und dann nachdenklich den Kopf schüttelte.
»Schläft Manuela, Frau Bischoff?«
»Ja, sie ist gerade eingeschlafen, Frau Dr. Martens. Ich nutze nur die Gelegenheit und trinke in der Kantine eine Tasse Kaffee.«
»So ist es auch recht, denn Sie brauchen Ihre Kräfte noch.«
Mona ging weiter, und auch Hanna und Roger setzten ihren Weg fort.
Plötzlich blieb Roger erneut stehen und fragte: »Wer war diese junge Frau? Ich kenne sie, oder irgendetwas ist an ihr, das mich an jemanden erinnert. Ich kann es nur im Augenblick nicht einordnen.«
»Warten Sie noch ein paar Minuten, dann werde ich Ihnen auch sagen, wer diese junge Frau ist. So, wir sind da. Bitte, leise, damit wir die Patientin nicht wecken.«
Leise drückte Hanna die Klinke hinunter und schob die Tür auf.
»Bitte, Herr Kröger.«
Roger machte nur einen Schritt an Hanna vorbei ins Zimmer, dann blieb er ruckhaft stehen.
»Das ist ja meine Christel«, entfuhr es ihm tonlos. Er fuhr mit einem Ruck herum und fragte rauh: »Was hat das alles zu bedeuten? Das ist doch meine Tochter.«
Wortlos zog Hanna ihn aus dem Zimmer und schloß die Tür.
»Das ist nicht Ihre Tochter, Herr Kröger. Es handelt sich um das kleine Mädchen, von dem ich Ihnen in meinem Sprechzimmer erzählte. Es heißt Manuela Bischoff und ist an Leukämie erkrankt. Die junge Frau, der wir auf dem Gang begegnet sind, ist die leibliche Mutter Manuelas. Bitte, kommen Sie noch ein paar Minuten mit ins Ärztezimmer, dort werde ich Ihnen auch noch den Rest erzählen.«
Hinter Roger Krögers Stirn vollführten die Gedanken einen wilden Wirbel, doch wortlos folgte er Hanna ins Ärztezimmer und sank wie vernichtend auf einen Stuhl.
Hanna ließ ihn ein paar Minuten in Ruhe, danach sagte sie mit ernster Stimme: »Ich kann verstehen, daß Ihnen alles unglaublich erscheint, doch es gibt für alles eine ganz einfache Erklärung. Dieses kleine Mädchen, das Sie gerade gesehen haben, befindet sich auch erst ein paar Tage bei uns in der Klinik, wo wir die furchtbare Krankheit feststellen mußten. Es gibt für Manuela nur eine Rettung. Durch die Knochenmarksübertragung von einem Geschwisterkind könnte ihr geholfen werden. Ich möchte zu diesem Zeitpunkt nicht die ganze Vorgeschichte berichten, sondern nur so viel, daß Frau Bischoff vor über elf Jahren einem Zwillingspärchen das Leben schenkte. Bevor die Mutter von Frau Bischoff es verhindern konnte, war schon eines der Mädchen adoptiert worden. Adoptiert von Ihnen und Ihrer Frau. Es ist für uns ein Wink des Himmels, daß beide Mädchen zur gleichen Zeit in der Klinik sind. Können Sie mir soweit folgen?«
»Ich habe Sie verstanden, Frau Dr. Martens. Sie erwarten doch wohl nicht von mir, mein Kind abzugeben? Ich liebe Christel wie mein eigen Fleisch und Blut. Sie gehört mir.«
»Niemand denkt daran, Ihnen das Mädel fortzunehmen, Herr Kröger. Die Mutter, die sich über lange Jahre nach ihrem Kind verzehrt hat, verzichtet, wenn auch schweren Herzens, weiterhin. Sie hat nur den Wunsch, das Leben des Kindes, das ihr geblieben ist, zu retten. Sie bat uns um Hilfe bei der Suche nach dem Mädchen. Ich bekam heute vom Jugendamt in Celle Ihre Anschrift. Bis zu diesem Zeitpunkt weiß Frau Bischoff noch nichts davon. Sie weiß auch nicht, daß das Mädel, nach dem wir suchen, so nah ist. Werden Sie der jungen Frau Ihre Hilfe versagen?«
»Nein, wenn es so ist, wie Sie sagen, helfe ich gern. Ich habe doch kein Herz aus Stein. Ich bin sogar bereit, ihr zu erlauben, Christel zu sehen. Christel darf nur nicht erfahren, wer diese junge Frau in Wirklichkeit ist.«
»Damit wird sie einverstanden sein, Herr Kröger. Ich möchte Ihnen dazu nur noch sagen, daß Frau Bischoff ihr Kind nicht aus Leichtfertigkeit vor elf Jahren zur Adoption freigegeben hat. Sie ist eine sehr warmherzige, vom Schicksal jedoch ziemlich gebeutelte Frau.«
»Jetzt weiß ich auch, warum mir der Anblick der jungen Frau gleich so vertraut vorkam. Es ist die Ähnlichkeit mit Christel. Könnten Sie es arrangieren, daß ich mich mit Frau Bischoff einmal einige Minuten ungestört unterhalten kann? Das heißt, wenn der Ehemann einverstanden ist.«
»Der Ehemann hat seine Frau verlassen, als sie ihm endlich beichtete, ein Zwillingspärchen geboren zu haben. Ein Mann, der sein krankes Kind nicht einmal hier besucht hat. Von dem dieses Kind glaubt, es sei sein Vater. Ich erzähle Ihnen diese Dinge nicht, um zu klatschen. Sie gehören meiner Meinung nach zum Gesamtbild.«
»Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir damit entgegenbringen. Ich werde es auch ganz bestimmt für mich behalten. Doch jetzt möchte ich endlich zu meinem Kind.«
»Einverstanden, ich bringe Sie persönlich hinunter auf die Intensivabteilung.«
*
Auch Mona Bischoff war nach der kurzen Begegnung auf dem Gang sehr nachdenklich weitergegangen. Wer war dieser junge Mann neben Frau Dr. Martens wohl gewesen? Warum hatte er bei ihrem Anblick gestutzt und sie so eigenartig angesehen? Sie konnte sich nicht erinnern, ihn schon einmal gesehen zu haben. Er war ihr völlig fremd.
Nun, es spielte auch keine Rolle. Sollte sie zu all ihren Sorgen zusätzlich über einen fremden Mann nachdenken? Noch saß die Enttäuschung über Alexanders Reaktion zu tief in ihr fest. Dabei brauchte sie gerade in diesen schweren Tagen so nötig einen Menschen an ihrer Seite, der ihr Verständnis entgegenbrachte. Doch der einzige Mensch, mit dem sie über alles reden konnte, war ihre Mutter. Hoffentlich hatte die Ärztin Glück und konnte dazu beitragen, Manuelas Zwillingsschwester zu finden. Es war doch schon höchste Zeit. Warum nur dauerte alles so lange? Mona fragte sich auch, ob sie an diesem Tag wohl noch die Gelegenheit bekommen würde, mit Frau Dr. Martens zu reden. Sie nahm sich nur die Zeit für eine Tasse Kaffee, danach ging sie rasch wieder zu Manuela zurück.
Manuela schlief noch, und Mona setzte sich still ans Fenster und wartete darauf, daß ihre Tochter wach wurde. Unwillkürlich mußte sie wieder an das eigenartige Verhalten des jungen Mannes während der kurzen Begegnung auf dem Gang denken. Vielleicht hatte er sie auch nur mit jemandem verwechselt. Aber sehr nett und vertrauenerweckend hatte er schon ausgesehen.
Nach einer Weile hörte sie vom Bett her ein Geräusch. Rasch trat sie ans Bett. Manuela war erwacht und sagte: »Du bist doch noch da, Mutti? Ich dachte, du wärst schon nach Hause gefahren und hättest die Oma geholt.«
»Das mache ich später, Manuela. Erst wenn du etwas zu Mittag gegessen hast.«
»Ich habe aber keinen Hunger.«
»Du mußt etwas essen, mein Schatz, du willst doch wieder gesund werden. Es wird nicht mehr lange dauern, und Schwester Laurie oder Schwester Jenny wird dein Essen bringen. Wenn du immer so wenig ißt, machst du mich ganz traurig.«
»Ich dachte, daß du wegen Vati traurig bist, Mutti. Du mußt aber nicht. Wir brauchen ihn nicht, wenn er uns nicht mag.«
»Wie kommst du denn darauf?«
»Wenn Vati mich liebhätte, wäre er mich doch besuchen gekommen, Mutti. Ich bin auch nicht mehr so klein, um nicht zu merken, daß er immer sehr viel mit dir gezankt hat. Ich weiß doch, daß du dann immer sehr traurig warst. Du hast doch noch mich und die Oma.«
»Ich weiß, mein Mädel. Vermißt du den Vati denn nicht?«
»Nein, Mutti.«
»Weißt du, Vati und ich verstehen uns nicht mehr. Wir haben beschlossen, uns zu trennen. Wir zwei, du und ich, bleiben erst einmal für längere Zeit bei der Oma. Du mußt also nicht traurig darüber sein.«
»Vati kann dann auch nie mehr mit mir schimpfen und mit dir zanken?«
»Nein, das kann er nicht mehr.«
»Dann bin ich auch nicht traurig, Mutti. Bei der Oma gefällt es mir sehr gut. Er darf mich dir aber nicht wegnehmen, ich bleibe nur bei dir. Die Ursel in meiner Klasse muß bei ihrem Vati bleiben. Der hat sich auch von Ursels Mutti scheiden lassen.«
»Du wirst immer bei mir bleiben, das verspreche ich dir. Warum, das sage ich dir, wenn du wieder gesund bist. Und jetzt denken wir nicht mehr an Vati. Einverstanden?«
»Ja, Mutti.«
Mona wollte gerade noch etwas sagen, da betrat Schwester Laurie das Krankenzimmer und brachte für Manuela das Mittagessen.
»Heute bekommst du etwas ganz Leckeres, Manuela. Schau nur, wie gut das schon aussieht. Zartes Hähnchenfleisch und Gemüsereis und dann hier der leckere Obstsalat. Und Orangensaft, frisch ausgepreßt, gibt es auch noch. Na, ist das vielleicht nichts?« Lustig blinzelte Schwester Laurie der Elfjährigen zu.
»So viel! Das kann ich aber nicht alles aufessen, Schwester Laurie.«
»Versuch es wenigstens. Im Obstsalat und im Saft sind alle Vitamine die du brauchst. Ich komme später und hole das Tablett wieder ab. Jetzt wünsche ich dir einen guten Appetit.«
Es gehörte für Mona wieder viel gutes Zureden dazu, ihre Tochter dazu zu bewegen, wenigsten, von allem ein bißchen zu essen. Doch schließlich war auch das wieder einmal geschafft.
»So, und nun fahre ich zur Oma. Wenn wir zu Mittag gegessen haben, komme ich wieder zu dir und bringe Oma mit. Hast du auch noch einen Wunsch? Soll ich dir etwas mitbringen?«
»Nein Mutti, nur, wiederkommen, damit ich nicht so allein…«
»Ich komme wieder und bleibe mit der Oma den ganzen Nachmittag bei dir.«
»Dann schlafe ich jetzt, Mutti. Ich bin schon wieder sehr müde.«
»Wenn du müde bist, schlaf ruhig. Ich beeile mich und bin bald zurück«, kam es weich von Monas Lippen, und sanft streichelte sie Manuelas Wangen und hauchte einen zärtlichen Kuß auf ihre Stirn. Danach wandte sie sich hastig ab. Das Mädchen durfte nichts davon merken, wie verzweifelt sie in Wirklichkeit war.
Es war zu offensichtlich, daß ihr Liebling von Tag zu Tag hinfälliger wurde.
Schon als Mona bei ihrer Mutter die Küche betrat, bemerkte diese Monas Niedergeschlagenheit.
»Ist es schon wieder schlimmer mit Manuela geworden, Mona?«
»Ich kann es bald nicht mehr mit ansehen, Mutti. Sie wird jeden Tag hinfälliger. Ich habe solche Angst, sie doch noch zu verlieren.«
»Hast du denn noch immer nichts von Frau Dr. Martens gehört? Ich meine, hat sie noch nichts herausbekommen?«
»Nein, sie hat noch nichts gesagt. Ich glaube schon nicht mehr daran, daß sie Erfolg haben wird.«
»Du mußt daran glauben, Mona. Frage Frau Dr. Martens doch einfach einmal.«
»Wenn du meinst, Mutti, dann mach ich das, wenn wir in der Klinik sind. Du bleibst eine Weile bei Manuela, und ich frage nach, ob ich Frau Dr. Martens sprechen kann. Ja, so machen wir es.«
»Bevor ich es vergesse, Mona, da ist heute morgen ein Schreiben für dich gekommen. Das Schreiben ist von einem Rechtsanwalt aus Nürnberg.«
»Da hat Alexander ja keine Zeit verloren, mich und Manuela loszuwerden«, entgegnete Mona bitter. »Ich öffne den Brief aber erst heute abend. Den Nachmittag will ich mir nicht noch mehr verderben lassen.«
»So ist es richtig, Mona. Dann laß uns jetzt essen, sonst wird alles kalt.«
*
»Du hast schon mit Herrn Kröger über alles gesprochen, Hanna?« Erstaunt sah Kay seine Schwester an.
»Wie ich schon sagte, Kay. Ich habe ihm die Situation erklärt. Er wird uns helfen. Er möchte vorher nur ein persönliches Gespräch mit Frau Bischoff führen. Er bat mich darum, das zu arrangieren.«
»Du erstaunst mich immer wieder, Hanna. Einen so raschen Erfolg in dieser Angelegenheit habe ich nicht erwartet. Es kommt jetzt also nur noch darauf an, daß die Genesung der kleinen Christel Kröger rasche Fortschritte macht. Wenn es uns auch noch so schwerfällt, wir müssen noch einige Tage abwarten. Hoffentlich reicht die Zeit für Manuela Bischoff.«
»Das macht mir im Augenblick auch die größten Sorgen, Kay. Wir können aber nichts daran ändern.«
»Du sagst es. Ich gehe jetzt noch einmal zur Intensivabteilung und schaue mir die Kleine an. Du kannst ja mit Frau Bischoff reden.«
»Das werde ich auch tun, Kay. Wenn sie erst alle Neuigkeiten erfahren hat, wird sie gern bereit sein, sich mit dem Mann zu unterhalten, der damals ihr Kind adoptiert hat. Ich halte dich auch weiter auf dem Laufenden.«
»Befindet sich Frau Bischoff denn schon wieder hier in der Klinik? Als ich zum Mittagessen ins Doktorhaus ging, sah ich sie die Klinik verlassen.«
»Du hast richtig gesehen, Kay. Frau Bischoff war auch nur zum Essen nach Hause gefahren. Sie kam schon vor etwa einer Stunde mit ihrer Mutter zurück.«
»Wenn das so ist, kannst du ja gleich mit ihr reden. Also, dann bis später.«
Als Hanna die Eingangshalle durchquerte, um hinauf zur Krankenstation zu gehen, kam ihr Mona Bischoff entgegen.
»Haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich, Frau Dr. Martens?«
»Ja, Frau Bischoff, auch ich möchte mich gern mit Ihnen über einige Dinge unterhalten. Ich wollte gerade zu Ihnen hinaufgehen. Kommen Sie mit in mein Sprechzimmer, dort sind wir ungestört. Ihre Tochter hat ja im Augenblick andere Gesellschaft, nicht wahr?«
»Ja, meine Mutter ist bei Manuela.«
In ihrem Sprechzimmer bot Hanna Mona einen Platz an und setzte sich ihr gegenüber. Lächelnd fragte sie: »Sagen Sie mir doch zuerst, was Sie auf dem Herzen haben.«
»Es geht immer nur um mein Kind, Frau Doktor. Wie lange hält es diesen Zustand noch durch? Sie wollten mir doch helfen, die Adresse der Familie ausfindig zu machen, die damals mein Kind adoptierte.«
»Ich habe mein Versprechen auch gehalten, Frau Bischoff. Darum wollte ich mit Ihnen sprechen.«
»Werden Sie mir die Anschrift geben? Ich würde noch heute hinfahren, um mit diesen Menschen zu reden.«
»Das wird nicht notwendig sein, Frau Bischoff, denn ich habe für Sie sehr erfreuliche Neuigkeiten. Ein seltsamer Zufall ist uns zu Hilfe gekommen. Hören Sie mir zu. Es geschah gestern mittag. Einer unserer Mitarbeiter wurde zu einem Notfall gerufen. Ein kleines Mädchen war von einem Heuboden gestürzt und hatte sich durch den Sturz sehr verletzt. Dieses Mädchen liegt im Augenblick noch auf der Intensivabteilung. Doch wie es aussieht, kann es schon morgen auf die Krankenabteilung verlegt werden.«
Hanna berichtete nun der immer aufgeregter werdenden Mona davon, daß das Mädchen auf der Intensivabteilung elf Jahre alt und am gleichen Tag wie Manuela geboren war. Auch das Gespräch mit dem Vater des Kindes erwähnte sie.
»Mein Kind ist hier in der Klinik? O Gott, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, es nur einmal wiedersehen zu dürfen. Und sie sieht Manuela wirklich ähnlich?« fragte sie atemlos.
»Ja, und wie ich gerade schon sagte, hat Herr Kröger sogar erlaubt, daß Sie das Mädel sehen dürfen. Er hat nur die Bedingung gestellt, das Christel, so heißt das Mädchen, nicht erfahren soll, wer Sie sind. Wenn Sie damit einverstanden wären?«
»Ob ich einverstanden bin? Ich bin mit allem einverstanden, wenn ich mein Kind nur sehen darf. Sie ahnen ja nicht, wie glücklich es mich macht. Jetzt habe ich auch endlich Hoffnung, daß meine Manuela wieder gesund wird.« Mona sprang auf und fiel Hanna lachend und weinend zugleich um den Hals. »Das werde ich Ihnen niemals vergessen, Frau Doktor«, stammelte sie dabei.
»Ist ja schon gut, Frau Bischoff. Wenn wir helfen können, so tun wir es auch mit unserem ganzen Herzen. Ich muß Ihnen aber auch sagen, daß uns noch für ein paar Tage die Hände gebunden sind. Wir müssen so lange abwarten, bis sich der gesundheitliche Zustand des Mädchens so weit stabilisiert hat, daß wir ohne Gefahr die Übertragung des Knochenmarks vornehmen können.«
»Ist die Mutter auch einverstanden?«
»Die kleine Christel lebt mit ihrem Vater und ihrer Großmutter allein. Frau Kröger kam vor über einem Jahr bei einem Unfall ums Leben.«
»Muß das Kind sehr leiden? Welche Verletzungen hat es denn bei dem Sturz davongetragen?«
»Eine schwere Gehirnerschütterung und einen Zwerchfellriß.«
»Bitte, lassen Sie mich das Mädchen nur einen Augenblick ansehen. Ich halte mich auch ganz bestimmt im Hintergrund. Sie können sich darauf verlassen, daß ich nichts mache, was Sie nicht billigen.«
»Ich glaube Ihnen, möchte aber zuerst von Ihnen wissen, ob Sie damit einverstanden sind, sich mit dem Vater von Christel zu unterhalten.«
»Ja, wann immer er will, Frau Dr. Martens.«
»Ich werde es ihm sagen, Frau Bischoff. Können wir jetzt gehen? Sie müssen mir aber versprechen, vernünftig zu bleiben.«
»Alles, was Sie wollen.«
»Gut, gehen wir zur Intensivabteilung. Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen.«
Mit zitternden Knien und heftigem Herzklopfen ging Mona nun an Hannas Seite zur Intensivabteilung. Sie bekam den üblichen sterilen Kittel, das Häubchen für das Haar, und danach erst durfte sie neben Hanna den Raum betreten, wo sie zum ersten Mal ihr Mädchen sehen sollte.
»Mein Kind, es ist mein Kind«, kam es mit andächtiger Stimme über ihre Lippen, und Hanna entging auch nicht das selige Leuchten, das in Monas Augen erstrahlte.
Ein nie gekanntes, völlig neues Gefühl erfüllte Mona, während sie unverwandt das Gesicht des schlafenden Kindes betrachtete. Wie sehr sie sich nach diesem Augenblick gesehnt hatte, konnte nur sie selbst ermessen. Der Augenblick war noch wundervoller, als sie es sich in all den Jahren Nacht für Nacht ausgemalt hatte.
»Kommen Sie, für heute ist es genug, Frau Bischoff. Sie werden ganz bestimmt noch öfter die Gelegenheit haben.«
Es fiel Mona unendlich schwer, sich von dem Anblick des schlafenden Kindes zu lösen, doch sie wußte, es mußte sein.
»Nun, wie fühlen Sie sich jetzt?« wollte Hanna wissen, als sie wieder draußen auf dem Gang vor der Intensivabteilung standen.
»Es ist für mich wie ein Wunder, Frau Doktor.«
»Manchmal geschehen noch Wunder. Sie wissen jetzt aber auch, daß das Mädchen in all den Jahren gut aufgehoben war und mit viel Liebe aufgewachsen ist. Man darf das alles nicht zerstören.«
»Das habe ich auch nicht vor. Sie manchmal zu sehen, damit will ich auch zufrieden sein.«
*
Als Manuela am nächsten Tag nach dem Mittagessen wieder eingeschlafen war, ging Mona zuerst in die Kantine, um eine Erfrischung zu sich zu nehmen. Anschließend ging sie hinaus in den Klinikpark, um etwas an der frischen Luft zu sein. Zu vieles ging ihr im Kopf herum, über das sie nachdenken mußte. Da es an diesem Tag wieder sehr warm war, suchte sie sich eine schattige Stelle und nahm auf einer der Bänke, die überall zum Sitzen einluden, Platz.
Mona schloß ihre Augen und lehnte sich entspannt zurück.
»Darf ich mich etwas zu Ihnen setzen, Frau Bischoff?« drang da eine dunkle, warme Männerstimme an ihr Ohr.
Erschrocken öffnete sie die Augen und sah vor sich den Mann stehen, der ihr auf dem Gang der Krankenstation begegnet war. Gut sah er aus mit dem dunklen, leicht nach hinten gekämmten Haar.
»Sie kennen meinen Namen?« Fragend sah Mona zu ihm auf.
»Darf ich mich setzen?«
»Bitte.« Mona wies neben sich. Während er Platz nahm, sagte er: »Mein Name ist Kröger, Roger Kröger. Wer Sie sind, weiß ich von Frau Dr. Martens. Ich bin Christels Vater.«
»Sie, Sie sind…«
»Ja, seit elf Jahren bin ich Christels Vater und mir lag sehr daran, Sie näher kennenzulernen.«
»Ich danke Ihnen von Herzen, daß Sie mir erlaubt haben, mein Kind zu sehen. Werden Sie mir helfen, das Leben meiner Manuela zu retten? Sie auch noch zu verlieren, das würde ich nicht verkraften.«
»Ich werde helfen, denn es hätte genausogut Christel treffen können. Wann es möglich ist, werden Herr Dr. Martens und seine Schwester bestimmen. Wo leben Sie mit Ihrer Tochter?«
»Ich habe bis vor einigen Tagen in Nürnberg gelebt, werde aber nicht wieder dorthin zurückkehren. Meine Mutter lebt in Celle, und dort werde ich auch in Zukunft mit meiner Tochter leben.«
»Seit dem Tod meiner Frau lebe ich mit Christel und meiner Mutter allein. Die Adresse ist Ihnen ja inzwischen bekannt.«
»Ja, ich weiß von Frau Dr. Martens, daß Sie mit Ihrer Familie auch in Celle leben.«
»Als ich Sie gestern zum ersten Mal sah, erinnerten Sie mich sofort an jemanden, ich wußte nur nicht, an wen. Ich befand mich da mit Frau Dr. Martens auf dem Weg zum Krankenzimmer Ihrer Kleinen. Der erste Moment war für mich ein Schock, denn ich war sicher, Christel vor mir zu sehen. Sie haben viel Ähnlichkeit mit den Mädchen.«
»Das weiß ich, Herr Kröger. Jetzt müssen Sie mich entschuldigen, ich möchte zu Manuela zurück. Darf ich Christel auch weiterhin sehen, wenn Sie heute auf die Krankenabteilung verlegt wird? Ich möchte ihre Stimme hören, möchte mit ihr reden. Ich verspreche Ihnen aber auch, daß ich mich nicht verraten werde. Ich werde für sie eine Mutter sein, die auch ein krankes Kind hier in der Klinik hat.«
»Ich bin einverstanden, Frau Bischoff, und es mag Ihnen nach unserem kurzen Kennenlernen seltsam erscheinen, ich vertraue Ihnen. Sie sind in vielem meiner verstorbenen Frau ähnlich. Wie könnte ich Ihnen daher auch Ihren Wunsch abschlagen.«
»Ich danke Ihnen, doch jetzt muß ich gehen.«
Etwas zu hastig entfernte sich Mona in Richtung des Klinikgebäudes. Was war nur auf einmal mit ihr los? Warum klopfte ihr Herz so unvernünftig? Das war ihr schon seit langer Zeit nicht mehr passiert. Mona war nicht sicher, ob es daran lag, daß Roger Kröger ihr erlaubt hatte, sogar mit ihrem Kind zu reden, oder daran, daß er doch einen tiefen Eindruck als Mensch bei ihr hinterlassen hatte.
Wieder bei Manuela im Zimmer, fiel es ihr zum ersten Mal nicht ganz so schwer, dem Mädel ein lächelndes Gesicht zu zeigen. Sie fühlte, daß für ihren Liebling alles gut werden würde.
Am frühen Nachmittag, Mona wollte für Manuela aus der Teeküche etwas zum Trinken holen, sah sie gerade noch, daß ein Bett ins Nebenzimmer geschoben wurde. Es war Christel, die man auf die Krankenstation gebracht hatte, denn Roger Kröger und Dr. Hanna Martens betraten nach den beiden Schwestern, die das Bett geschoben hatten, das Zimmer. Einen Moment preßte sie eine Hand gegen ihre Brust, denn ein glückliches Gefühl durchströmte sie. Ihr Kind, ihr eigen Fleisch und Blut so nahe, Wand an Wand mit Manuela zu wissen, war ein überwältigendes Gefühl. Sie wußte in diesem Augenblick, daß sie an diesem Tag die Kinderklinik nicht verlassen würde, bevor sie im Nebenzimmer gewesen war.
Wie an jedem Tag verabschiedete sie sich nach achtzehn Uhr liebevoll von Manuela. Vor der Tür zum Nebenzimmer stockten ihre Schritte, dann drückte sie leise die Klinke hinunter und schob die Tür auf.
Christel war allein im Zimmer. Als Mona auf Zehenspitzen ans Bett trat, sah sie, daß das Mädel noch wach war. Es war, als würde Manuela sie mit ihren blauen Augen ansehen.
»Ich habe solchen Durst«, wisperte eine dünne Stimme.
»Ich werde die Schwester fragen, ob du trinken darfst, dann bringe ich dir etwas. Darf ich?«
»Wer sind Sie denn?« kam es leise über Christels Lippen.
»Ich bin auch zu Besuch hier, Christel. Meine Tochter liegt im Nebenzimmer und ist auch sehr krank. Ich wollte nur mal nach dir sehen, weil ich gesehen habe, daß dein Vati gegangen ist. Du darfst aber noch nicht so viel reden, sonst tut dir dein Kopf wieder weh. Ich komme sofort wieder.«
Mona ging zu Schwester Tina ins Schwesternzimmer und erkundigte sich, ob Christel schon trinken durfte.
»Ich bringe der Patientin sofort etwas, Frau Bischoff.«
»Lassen Sie mich das machen, Schwester Tina. Der Vater des Mädels hat mir erlaubt, daß ich nach ihm sehe.«
»Natürlich, Frau Bischoff. Ich bin ja mit den Fakten vertraut. Entschuldigen Sie, daß ich daran nicht gedacht habe.«
»Macht nichts, Schwester Tina. Ich kümmere mich sehr gern auch ein wenig um Christel. Es ist wenig genug, was ich tun kann.«
Es war ein wunderschönes Gefühl, als Mona einen Arm hinter das Kissen schob und so Christel etwas aufrichtete, damit sie besser aus der Schnabeltasse trinken konnte.
»Danke für den Tee. Sie sind sehr nett.«
»Habe ich doch gern getan, Christel. Darf ich dich denn wieder besuchen?«
»Ja, Sie können ruhig kommen.«
»Fein, dann komme ich auch morgen wieder zu dir. Jetzt versuchst du zu schlafen, hörst du?«
»Ja, bis morgen mein Vati wiederkommt. Er hat gesagt, daß ich bald wieder ganz gesund bin.«
»Dann wird es auch so sein. Also schlaf schön, und ich komme dich morgen wieder besuchen.«
Verwundert sah Regine Hauser ihre Tochter an, als diese zu ihr ins Wohnzimmer kam.
»Was ist los, Mona? Du strahlst ja förmlich von innen heraus. Gibt es gute Nachrichten über unsere Manuela?«
»Nein, Mutti, da hat sich nichts geändert. Wir müssen noch ein paar Tage warten. Aber ich habe ein paar Worte mit Christel sprechen können.«
Mit leuchtenden Augen erzählte Mona ihrer Mutter von ihrem kurzen Besuch im Krankenzimmer Christels und auch von ihrem Gespräch am frühen Nachmittag, das sie mit Roger Kröger geführt hatte.
»Ist das nicht wunderbar, Mutti? Zu meinem Glück fehlt nur noch, daß Manuela wieder gesund wird. Ich fühle, daß alles wieder gut werden wird.«
»Ich werde weiter darum beten, Mona. Unser Herrgott wird uns bestimmt beistehen.«
*
Drei Tage später bat Hanna Roger Kröger und Mona Bischoff zu sich ins Sprechzimmer.
»Wir müssen es wagen, wenn wir Manuela retten wollen. Wir können nicht länger warten, denn die Kräfte des Mädchens schwinden immer mehr, und die Chancen werden dadurch auch immer geringer. Sind Sie mit der Knochenmarkübertragung einverstanden, Herr Kröger?«
Roger zögerte ein paar Sekunden und sah Mona an. Ihre verzweifelten Blicke gaben schließlich den Ausschlag. Er, dessen Gefühle für die leibliche Mutter Christels während der vergangenen drei Tage so stark geworden waren, als würde er sie schon ein halbes Leben lang kennen, konnte die heimliche Not und Verzweiflung in ihren Augen nicht mit ansehen.
»Ich bin einverstanden, wenn Christel daraus kein Schaden entsteht«, antwortete er mit fester Stimme.
»Ich habe keine andere Antwort von Ihnen erwartet, Herr Kröger, und ich verspreche Ihnen, daß dem Mädel nichts passiert. Werden Sie Christel darauf vorbereiten?«
Erneut zögerte Roger einige Sekunden, danach aber sagte er, Monas Blicke dabei suchend: »Wir werden beide mit Christel und mit Manuela reden. Ich finde, es wird Zeit, daß Christel erfährt, daß Mona ihre richtige Mutter ist, und Manuela soll erfahren, daß sie noch eine Zwillingsschwester hat.«
Seine Blicke gingen fragend zu Mona. »Ich soll… Ich darf?« stammelte Mona, und in ihre Augen trat ein fast überirdisches Leuchten.
»Ja, Mona, ich will es so. Christel soll erfahren, daß Sie ihre richtige Mutter sind.«
Mona sprang auf, und lachend und weinend vor Glück fiel sie Roger, der sich ebenfalls erhoben hatte, um den Hals.
»Das werde ich Ihnen nie vergessen, Roger«, sagte sie.
»Ich habe es auch für Christel und mich getan, Mona. Jetzt wollen wir es zuerst Manuela sagen, danach gehen wir zu Christel, die ihr Herz sowieso schon an ihre Tante Mona verloren hat.«
»Ich finde Ihre Entscheidung einfach großartig«, sagte Hanna gerührt. »Ich glaube, daß Sie es niemals bereuen werden. Bereiten Sie also beide Mädchen auf das vor, was auf sie zukommt.«
Als Roger und Mona nebeneinander zur Krankenstation hinaufgingen, sagte Roger mit verhaltener Stimme: »Wir kennen uns erst wenige Tage, Mona, doch wenn alles vorbei ist, darf ich Sie dann etwas Wichtiges fragen?«
»Ja, Roger, wenn alles überstanden ist«, erwiderte Mona mit leuchtenden Augen. Ihr Herz klopfte auf einmal so heftig, daß sie das Gefühl hatte, es würde im nächsten Augenblick zerspringen.
Als sie Manuelas Krankenzimmer betraten, war es Roger, der Manuela sekundenlang wie eine Erscheinung ansah. Das war Christels Ebenbild, nur schmaler und blasser, stellte er erneut fest.
»Du kommst nicht allein, Mutti?« fragte Manuela mit matter Stimme und sah mit groß aufgeschlagenen Augen auf den fremden Mann an der Seite ihrer Mutti.
»Das ist Herr Kröger, Liebling. Er und ich bringen dir heute eine gute Nachricht. Aber zuerst möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Am Ende steht für dich eine große Überraschung.«
Während sich Roger einen Stuhl holte, setzte Mona sich auf die Bettkante und faßte nach Manuelas Händen. Mit leiser Stimme erzählte sie der Elfjährigen ihre eigene Lebensgeschichte. Von den beiden Babys, die sie zur Welt gebracht und von denen sie eines aus Angst fortgegeben hatte.
Atemlos lauschte Manuela der weichen Stimme ihrer Mutti, und als Mona einen Moment schwieg, fragte sie: »Dann ist Vati ja gar nicht mein richtiger Vati, und ich habe noch eine Schwester? Weißt du denn, wo sie ist?«
»Doch, Manuela, deine Mutti weiß jetzt, wo deine Schwester ist. Sie heißt Christel, und ich bin ihr Vati. Deine Mutti hat dir doch vor wenigen Tagen gesagt, daß man jemanden finden muß, von dem du gesundes Knochenmark übertragen bekommst, damit du wieder ganz gesund wirst. Da deine Mutti da aber noch nicht wußte, wo deine Schwester war, hat sie dir nicht gesagt, daß man für eine solche Übertragung nur eine Schwester oder einen Bruder brauchen kann. Verstehst du, was ich dir damit sagen möchte?«
»Ja, daß ich jetzt wieder gesund werden kann. Wo ist denn die Christel? Darf ich sie denn auch einmal sehen?«
»Ja, aber erst müssen deine Mutti und ich ihr noch sagen, daß es dich gibt, und daß deine Mutti auch ihre Mutti ist. Sie weiß es noch nicht. Die Christel ist hier ganz in deiner Nähe, weil sie nämlich auch sehr krank war. Sie war unvorsichtig und ist von einem Heuboden gestürzt. Sie liegt im Zimmer nebenan. Möchtest du denn überhaupt eine Schwester haben?«.
»Ja, Herr Kröger. Mutti, du mußt das gleich der Oma erzählen.«
»Oma weiß es schon, Liebling.«
»Ich habe eine Schwester, oh, ist das schön. Du mußt ihr gleich von mir erzählen, Mutti. So geh doch schon. Ich möchte sie doch sehen.«
»Wir gehen ja schon, Liebling. Du kannst ja inzwischen etwas schlafen.«
»Nein, ich will nicht schlafen. Ich will warten, bis du wieder zurückkommst.«
Mona hauchte einen sanften Kuß auf Manuelas Stirn, erhob sich und verließ mit Roger das Krankenzimmer.
Draußen auf dem Gang sagte Roger: »Manuela hatte wohl kein gutes Verhältnis zu Ihrem Mann, Mona?«
»Nein, er hat sie immer abgelehnt, und ein Kind spürt das auch. Ich bin froh, daß es vorbei ist. Die Scheidungsklage hat er ja inzwischen schon eingereicht. Ich möchte jetzt auch nicht weiter darüber reden. Mich zieht es mit jeder Faser meines Herzens nach Christel. Wie wird sie reagieren?«
»Wenn ich allein bin, spricht sie viel von Ihnen. Sie ist glücklich, daß sie Tante Mona sagen darf. Sie haben Ihr Herz schon gewonnen, wie ich erkennen konnte. Es sind wohl die Bande des Blutes, die diese Gefühle erwachen ließen. Gehen wir zu ihr, und sagen wir ihr alles.«
Einige Minuten später erzählte Mona zum zweiten Mal an diesem Tag einem elfjährigen Mädchen ihre Geschichte. So wie kurz zuvor Manuela, begriff auch Christel sofort.
»Dann bist du… Dann bist du meine Mutti, und ich habe noch eine Schwester?«
»Ja, ich bin deine Mutti, und du hast noch eine Zwillingsschwester.« Tränen rollten plötzlich über Christels Wangen.
»Mutti, meine Mutti.« Zwei weiche Arme schlangen sich um Monas Hals, und ein tränennasses Gesicht schmiegte sich an das ihre. Doch Sekunden später sah Christel erschrocken von Mona zu ihrem Vater und sagte stockend: »Es geht aber nicht, Mutti. Ich habe meinen Vati doch so lieb. Ich kann ihn und Oma nicht allein lassen.«
»Das brauchst du auch nicht. Darüber reden wir, wenn Manuela und du wieder ganz gesund seid.«
»Ist die Manuela wirklich so doll krank?«
»Ja, Christel, und nur du kannst ihr helfen.«
»Aber sehen darf ich sie doch auch?«
»Ja, Christel. Dein Vati und ich werden Frau Dr. Martens fragen, dann schiebt man dein Bett vielleicht in Manuelas Zimmer. Dann könnt ihr immer zusammen sein.«
»Ja, Vati, das möchte ich sogar sehr gern. Du kannst ja gleich gehen und fragen.«
*
Einen Tag nach diesem für beide Mädchen so ereignisreichen Tag wurde die Knochenmarkübertragung an Manuela durchgeführt. Und mit jedem weiteren Tag besserte sich das Befinden Manuelas.
Auch Christel, die mit Manuela auf einem Zimmer lag, konnte schon bald herumlaufen.
Als beide Mädchen nach vierzehn Tagen entlassen werden konnten, stand für Mona und Roger fest, daß sie, wenn erst einmal die Scheidung Monas von Alexander Bischoff rechtskräftig sein würde, für immer zusammenbleiben würden.
Mit Manuela und Christel, beide unzertrennlich, sollte eine neue glückliche Zeit beginnen.
So fanden in der Kinderklinik Birkenhain die Menschen zusammen, die zueinander gehörten und füreinander bestimmt waren.