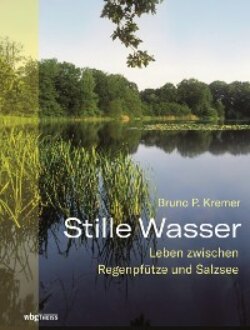Читать книгу Stille Wasser - Бруно П. Кремер - Страница 7
1 Faszinierendes Wasser
ОглавлениеWenn es Magie auf unserem Planeten gibt, ist sie eingefangen in Wasser.
Loren Eiseley (1907–1977)
Zu den unbedingt hervorhebenswerten geophysikalischen Besonderheiten unseres Heimatplaneten gehört es, dass die im Prinzip total simpel erscheinende chemische Verbindung H2O in ihrem flüssigen Aggregatzustand den größten Teil der Erdoberfläche beherrscht. Dies ist im gesamten Sonnensystem einzigartig. Unsere erlebbare Welt ist deshalb tatsächlich überwiegend wässrig. Flüssiges Wasser findet sich in Tropfengestalt in den tonnenschweren Wolken ebenso wie in den Nebelschwaden der unteren Atmosphäre, aber auch als Grund- sowie als Tiefenwasser in den Festgesteinen der Lithosphäre. Fallweise sind allerdings auch die anderen Aggregatzustände vertreten: Außer den Wassertropfenwolken gibt es auch solche, die wie die charakteristisch aufgefasert aussehenden Cirren überwiegend aus Eiskristallen bestehen, und auf der Erde selbst kann das Wasser in manchen Klimagürteln bzw. Höhenstufen vorzugsweise als Eis oder Schnee vertreten sein. Den weltweit weitaus größten Teil stellt aber zweifellos das flüssige Wasser und bietet in seinen verschieden großen Ansammlungen jede Menge spannender Erlebnisräume. Alle offenen oder verdeckten Gewässer bilden in ihrer Gesamtheit die Hydrosphäre, eben die wässrige Hülle der Erde. Die irdische Gashülle bezeichnet man als Atmosphäre – ihre unteren Schichten bestimmen das Wetter. Das Festgestein der Erde ist die Lithosphäre und Betrachtungsobjekt überwiegend der Geologie. Der gelegentlich ziemlich wasserdurchtränkte Boden (= Pedosphäre) ist der gemeinsame Verschneidungsraum von Atmo-, Litho- und Hydrosphäre und bildet mit der Letzteren zusammen die Biosphäre. Nur hier können Lebewesen existieren.
1.1 Wasser ist ein überaus geheimnisvolles und von vielen Mythen flankiertes Medium
Wasserplanet Erde
Nur aus größerer Nähe oder gar aus der eingeschränkten Perspektive des Festlandbewohners Mensch betrachtet ist unsere Erde eine weithin grüne Welt mit festländischer Vegetation, die sich zumindest in Gebieten mit ständig oder periodisch zuverlässiger Wasserversorgung sowie akzeptablen Durchschnittstemperaturen als Pflanzenkleid der Steppen, Prärien oder Wälder entwickeln konnte. Das Grün des Festlandes steht dabei für eine große organismische Leistung: Mithilfe ihres bewundernswerten grünen Blattfarbstoffs Chlorophyll – er kommt übrigens in mehreren molekularen Varianten vor – arbeiten die autotrophen Organismen (Photobakterien, Algen, Pflanzen) als einzige primäre Stoffproduzenten auf der Erde. Nur sie können mithilfe der Sonnenenergie aus dem Kohlenstoffdioxid der Luft (CO2) mit maximal oxidiertem Kohlenstoff und dem wichtigen Betriebsstoff Wasser neue organische Materie in Form von Zuckerverbindungen (CnHnOn) mit maximal reduziertem Kohlenstoff und deren Folgeprodukten produzieren. Dieser einzigartige Prozess heißt Photosynthese und ist deswegen so bemerkenswert, weil nur er tatsächlich die gesamte Biosphäre in Betrieb hält.
1.2 Der größte Teil des auf der Erde erlebbaren Wassers gehört zu den Weltmeeren
Als erdgebundene Bewohner bzw. Erlebende nehmen wir also das festländische Ambiente zumindest in vielen Teilregionen als von grünen Pflanzen dominierte Umwelt wahr – eben mit Wäldern, Grasland (Steppen, Savannen) und den vielen modernen Erscheinungsformen von landwirtschaftlich genutztem Kulturland (Äcker und Felder) sowie diversen Siedlungsflächen von Dorfabmessung bis zur Großstadtdimension. Aus der ungleich größeren Distanz des erdnahen Weltraums zeigt sich die wegen ihrer terrestrischen Vegetation in großen Teilen zumindest jahreszeitlich flächendeckend grüne Erde dagegen als blauer Planet – und das bedingen vor allem ihre ausgedehnten Gewässer. Die Erde ist nämlich – tatsächlich eher ein Wasser- als ein Festlandplanet, auch wenn dem unsere subjektive Alltagswahrnehmung scheinbar entgegensteht. Schon die ersten großflächigen Kartierungen der Erde während der Entdeckungs- und Eroberungsexpeditionen der Portugiesen und Spanier seit dem 15. Jahrhundert lieferten jedoch die überraschende ebenso wie wichtige Erkenntnis, dass unser Heimatplanet überwiegend ozeanisch ist: Von den heute geradezu penibel genau vermessenen 510 Mio. km2 Gesamtoberfläche sind nahezu 71 % oder 361,1 Mio. km2 mit Wasser bedeckt, und nicht einmal ein Drittel, nämlich nur 29 % oder 147,9 Mio. km2, entfallen auf das Festland, unseren im Alltag erfahrenen und erlebten Aktionsraum. Die moderne Sicht bestätigt dieses Bild: Gerade aus der größeren Distanz des erdnahen Weltraums zeigt sich die Erde tatsächlich als blauer Planet mit ausschließlich wässriger Biologie – eben ein „strahlender Saphir auf mattschwarzem Samt“, wie der legendäre amerikanische Astronaut Neil Armstrong (1930 – 2012) anlässlich einer seiner ersten Erdumrundungen während der Gemini-8-Mission (1966) aus dieser damals noch völlig ungewohnten Perspektive einfühlsam poetisch anmerkte.
Nach den Erkenntnissen der modernen Astrophysik ist der wunderbare Naturstoff Wasser allerdings keine nur auf unseren Heimatplaneten beschränkte, sondern tatsächlich eine wahrhaft kosmische und daher auch weit außerhalb der Erde vorhandene Substanz: Wasser kommt nämlich in den gigantischen Gaswolken der interstellaren Materie ebenso vor wie in den unvorstellbar fernen Galaxien. Mehr noch: Wasser war sogar die erste (relativ einfache) chemische Verbindung, die man in den kosmischen Weiten weit außerhalb unseres Sonnensystems mit den analytischen Mitteln der Radioastronomie nachgewiesen hat. Sogar auf dem ansonsten als weithin staubtrocken geltenden Mond konnte man Wasser unterdessen zumindest in Spuren feststellen.
Ein wenig Mengenlehre
Die insgesamt auf der Erde in Atmosphäre, Hydrosphäre und Lithosphäre vorhandene Gesamtwassermenge beträgt – hochgerechnet sowie hier und da ein wenig abgeschätzt – rund 1,37 Mrd. km3. Diese gewiss nur schwer vorstellbare Menge entspricht einem Würfel mit einer Kantenlänge von annähernd 1100 km. Die irdische Hydrosphäre ist allerdings ganz überwiegend eine marine Umwelt, denn das Salzwasser der Weltmeere (Salzgehalt im Durchschnitt jeweils > 30 ‰) bildet davon mit knapp 96,5 % Volumenanteil die weitaus größte Portion. Nur der kleinere Rest von annähernd 3,5 % ist Süßwasser.
Der gesamte Süßwasservorrat der Erde macht demnach etwa 35 Mio. km3 aus – das ist trotz des Anteils im einstelligen Prozentbereich dennoch mehr als das zehnfache Wasservolumen des Mittelmeeres. Etwa die Hälfte davon ist in Gletschern, in der Schneeauflage der Hochgebirge sowie im Polareis gebunden. Nur der fast schon kaum noch nennenswerte kleinere Rest von einem Fünftel (= 0,52 % des Gesamtvorrates) bildet die erlebbaren Oberflächengewässer, die Bodenfeuchte und den gesamten Grundwasservorrat in Boden bzw. Gestein. Bei dieser Volumenstatistik der Binnengewässer ist allerdings zu berücksichtigen, dass rund 104.000 km3 Wasser auf kontinentale Salzseen entfallen, unter Einschluss der ehemaligen Meeresgebiete Aralsee und Kaspisches Meer. Die reinen Süßwasserseen der Erde bringen es zusammen auf etwa 125.000 km3. Ein Gewässer ragt darunter in erwähnenswertem Maß hervor: Der Baikalsee in Ostsibirien nimmt mit einer Fläche von 31 500 km2 zwar nur den neunten Rang unter den größten Binnenseen der Erde ein, aber seine Tiefe beträgt bis zu 1160 m, und sein Volumen misst rund 23.000 km3. Damit enthält er tatsächlich rund ein Fünftel des gesamten auf die Binnengewässer entfallenden Süßwassers.
Man kann die Süßwasseranteile auf den Kontinenten vielleicht deutlich anschaulicher auch in folgendem Bild darstellen: Von einem gewöhnlichen Eimer voll Wasser (mit 10 l Fassungsvermögen), der hier einmal modellhaft für den Gesamtwasservorrat der Erde stehen soll, entspricht tatsächlich nur die Füllung eines Eierbechers (35 ml) der Wassermenge in allen Bächen, Flüssen und Seen der Kontinente. So gesehen schrumpft selbst Ihr hübscher Gartenteich angesichts dieser Mengenverhältnisse geradezu zum absoluten Ausnahmeobjekt. Noch viel weniger (deutlich unter 0,01 %) ist in allen Lebewesen der Biosphäre enthalten, obwohl diese im Durchschnitt zu über 60 % aus Wasser bestehen. Und auch diese Menge könnte man in der Gesamtstatistik glatt vergessen.
1.3 Selbst kleine und überschaubare Stillgewässer bergen oft große Geheimnisse, die es zu entdecken gilt
Das salzige Meerwasser ist also ganz klar die absolute Dominante in der irdischen Hydrosphäre. Die Grenze zwischen Salz- und Süßwasser (fresh water bzw. Frischwasser, wie man es im angloamerikanischen Sprachgebiet und entsprechend auch in Norddeutschland nennt) zieht man üblicherweise bei einem Salzgehalt von nur < 0,5 ‰. Selbst diese minimale Menge schmeckt man und bemerkt sie auch beim Rasieren oder Zähneputzen: So recht wird selbst bei dieser minimalen Salzbelastung die morgendliche Schaumschlägerei nicht gelingen. Wasser mit einem Salzgehalt zwischen 0,5 und 30 ‰ bezeichnet man dagegen als Brackwasser (abgeleitet vom mittelniederländischen brac = salzig). Die Ostsee direkt vor unserer Haustür ist weltweit das größte Brackwassergebiet; sie weist zudem überaus interessante ökologische Gradienten auf, weil sie in östlicher bzw. nördlicher Richtung immer mehr zu einem (fast) typischen Binnensee wird. Erst ab einem Salzgehalt von > 30 ‰ spricht man von Meerwasser.
Ganz anders liegen die Dinge beim Toten Meer: Es weist gegenüber dem normalen Meerwasser einen stark erhöhten Salzgehalt von tatsächlich 28–30 % (= 280 – 300 ‰) auf. Aber: Dieses aus vielerlei Gründen überaus bemerkenswerte Binnengewässer ist durchaus kein richtiges Meer, weil seine kennzeichnende Ionen-Zusammensetzung von typischem Meerwasser erheblich abweicht. Außerdem weist es eine gänzlich andersartige Entstehungsgeschichte auf.
1.4 Viele Fließgewässer bieten spektakuläre Abschnitte mit Wasserfällen: Im Rheinfall von Schaffhausen stürzt der Rhein über seine frühere Talflanke
Erlebniswelt Wasser
Von wirklich allen auf der Erde erlebbaren wässrigen Welten geht erfahrungsgemäß eine besonders nachhaltige Faszination aus: Schon allein Bach- und Flussufer haben für kleine und große Naturfreunde sowie erklärte Hobbyforscher fraglos ihren besonderen Reiz. Aber auch der kleinste Tümpel irgendwo in der Kulturlandschaft zieht die Aufmerksamkeit zuverlässig auf sich. Auch Fließgewässer, die über Steilhänge rieseln oder sich als Wasserfälle über viele Dutzende Meter in die Tiefe stürzen, sind immer spektakuläre Anlaufpunkte in der Landschaft. Das gilt natürlich auch für den durchaus imposanten, weil je nach Wasserführung heftig tosenden Rheinfall bei Schaffhausen, aber erst recht für die eindrucksvollen Victoria-Fälle zwischen Simbabwe und Sambia im östlichen Zentralafrika, ferner die in ihrer Gesamtwirkung überwältigenden Niagarafälle zwischen dem westlichsten Zipfel des USBundesstaates New York und der kanadischen Provinz Ontario, wo der Erie-See über eine Steilstufe gleich mehrfach und unglaublich polternd in die Tiefe auf das Niveau des anschließenden Ontario-Sees rauscht. Visuell und akustisch gleichermaßen beeindruckend ist zweifellos auch der „Gull Foss“ in Island.
1.5 Zu den schönsten Wasserfällen gehören die Niagara Falls zwischen dem US-Bundesstaat New York und Kanada
Im Unterschied zu den mitunter zumindest plätschernden, oft aber auch vernehmlich rauschenden oder fallweise sogar tosenden Fließgewässern sind die stehenden Gewässer in der Landschaft fast immer ziemlich lautlos und insofern eine stille Welt. Nur bei größeren Wasseransammlungen in der offenen Landschaft kann der über die Wasseroberfläche streichende Wind kleine Bugwellen aufbauen und an den Ufern im Luv einen munter plätschernden Wellenschlag erzeugen. Aber nicht nur wegen ihrer bemerkenswerten und geradezu systemischen Lautlosigkeit (wo sonst erfährt man noch in unserer allenthalben lauten Umgebung „The Sound of Silence“ [nach Simon & Garfunkel]?) bezeichnet man die nicht fließenden, weil stagnierenden Binnengewässer zutreffend auch als Stillgewässer. Allerdings: Wenn man auf winterlich zugefrorenen Stillgewässern so typische Wintersportarten wie Eisstockschießen oder auch nur einfaches Schlittschuhlaufen praktiziert, geht davon für die Wasserorganismen unter der Eisdecke ein ziemlich heftiger und durchaus bedenklicher akustischer Stress einher. Dieser ökologisch relevante Sachverhalt ist erklärten Wintersport-Enthusiasten meist absolut nicht zu vermitteln.
Fließ- und Stillgewässer
Die animativen Fließgewässer haben erklärtermaßen ihre spezifischen und auch zahlreich zu bemessenden Freunde. Das beweisen schon allein die vielen Campingplätze beispielsweise entlang des romantischen Mittelrheintals und seiner größeren Zuflüsse (Lahn, Mosel, Wied und Ahr). Aber auch die vielen stillen Weiher oder gar die recht großflächigen Seen der verschiedenen Gewässerlandschaften zwischen dem Alpengürtel und dem norddeutschen Tiefland haben ihre überzeugten Liebhaber, denn auch hier sind überall Campingplätze bzw. Abstellmöglichkeiten für Wohnmobile eingerichtet. Dafür gibt es besondere, aber nicht immer besonders reflektierte Motive: Sogar ein kleiner Garten- und ein eventuell etwas größer bemessener Parkteich verkörpern eine völlig eigene und immer wieder packende Erlebniswelt mit vielen interessanten Bewohnern: von den schwirrenden Libellen bis hin zu den laichenden Lurchen. Deren genauere Beobachtung im Jahreslauf oder gar die genauere punktuelle Erkundung ihrer jahreszeitlichen Entwicklung versprechen eine Menge spannender und durchaus ungewöhnlicher Einsichten und Erlebnisse – nicht zuletzt auch dann, wenn man mit Lupen- oder gar mikroskopischer Hilfe einmal (in jedem Fall absolut empfehlenswert!) in die jeweils beteiligten und auch immer vorhandenen und geradezu unglaublichen Kleinlebewelten abtaucht. Allein in dieser Größenordnung kommt man dann aus dem Staunen definitiv nicht mehr heraus (S. 133). Sämtliche Gewässer sind somit als Lebensräume – ökologisch betrachtet – ein geradezu diametraler Gegenentwurf zum täglich erlebten festländischen Ambiente. Alles, aber auch wirklich alles ist in diesen besonderen Lebensraumtypen völlig anders als zu Hause auf dem Balkon oder im Garten.
1.6 So wild bewegte Oberflächen wird man an Binnengewässern eher seltener erleben
Das Meer ist noch etwas aufregender
Schon bei den Binnengewässern wird also überaus deutlich, wie grundverschieden diese elementaren Lebensräume vom täglich wahrgenommenen, aber meist nicht weiter hinterfragten festländischen Milieu sind. Diese Basiserfahrung ist aber allemal steigerungsfähig, denn nirgendwo sonst prallen die formenden Elemente der Erdoberfläche so gänzlich unvermittelt aufeinander wie an unseren Meeresküsten, die für die Naturerfahrung vielleicht noch ein wenig spektakulärer sind als die Binnengewässer. Hier findet sich der Besucher geradezu planmäßig in einer echten Grenzsituation: Von der Flutlinie bis zum Horizont breitet sich eine endlos erscheinende und daher sicherlich nicht mehr überschaubare Wasserfläche aus – und das löst gewöhnlich besonders nachhaltige Gefühle aus. Nicht umsonst gehören gerade die Küstenlandschaften zu den mit Abstand beliebtesten Ferien- und Urlaubsgebieten, denn am Saum des Meeres findet Begegnung mit originaler und oft sehr ursprünglicher wilder Natur statt – insbesondere dann, wenn die Wellen nicht ganz so sanft plätschern wie im heimischen Freibad, sondern ein eventuell recht energischer Wind auf breiter Front gewaltige Wasserberge geräuschbetont auf die Ufer klatschen lässt. Vor allem Wasser und Wind sind die Hauptakteure im spannenden Naturszenario Küste und hier hautnah erlebbar in der beachtlichen Bandbreite von Windstille mit spiegelglatter See über leichte Brise mit kleinen Wellen bis hin zum handfesten Sturm mit fetzenweise davonfliegender Salzgischt, die schon nach wenigen Augenblicken die Brillengläser zuverlässig vernebelt.
Aber: Wenn man die offenbar so dominant marin geprägte wässrige Welt wieder zur Gesamtgröße der Erdkugel in Beziehung setzt, schwinden auch die gewaltigen und so flächen- bzw. raumbeherrschend erscheinenden Wassermassen der Ozeane fast wieder zum Nichts. Auf einem gewöhnlichen Schulglobus von 40 cm Durchmesser würde die mittlere Meerestiefe lediglich eine Wasserhaut von 0,1 mm Dicke ausmachen – nicht einmal so viel, wie zwei Seiten dieses Buches dick sind, das Sie gerade in Händen halten. So betrachtet erweisen sich letztlich auch die Ozeane trotz ihrer gewaltigen Breiten- und Tiefenausdehnung als recht schmächtiger Überzug und gleichsam nur als Feuchtebelag des Festkörpers Erde. Das Massenverhältnis des Gesamtfestkörpers zum Gesamtwasservorrat beträgt etwa 5000 : 1, und das würde man eigentlich als Missverhältnis bezeichnen.
1.7 Städtische Wasserspielplätze sind für Kinder während der Sommerwochen zweifellos das Größte und wirklich ein wahres Vergnügen
Packende Wasserwelten
Mag das Meer dem festländischen Betrachter auch ungemein beeindruckend und in seiner Gesamtwirkung auch total faszinierend erscheinen, wofür es sicherlich sehr gute Gründe gibt, so stehen die meist deutlich harmloseren Binnengewässer den zugegebenermaßen grandiosen Küstengebieten bei genauerem Hinsehen in ihrem spezifischen Erlebniswert allerdings kaum nach. Denn diese Erfahrung werden Sie vermutlich sofort bestätigen: Vom Wasser – und selbst von den sehr kleinen Fließ- sowie Stillgewässern – geht erwiesenermaßen immer eine eigenartige Faszination aus. Als Kind haben Sie gewiss viel lieber an einem Bachufer oder Teichrand gespielt als an einer eintönigen, zudem staubigen und womöglich auch noch sehr lauten Straße. Dieser besonderen Vorliebe für das nasse Element kommt man heute übrigens in vielen (Groß-) Städten durch besondere Einrichtungen entgegen: Vielfach gibt es hier die gerade bei Kindern außerordentlich beliebten Wasserspielplätze mit ihren vielen Aktionsmöglichkeiten. Die auch hier schon so frühzeitig begründete Affinität zum Wasser bleibt meist ein Leben lang erhalten. Wenn der Reisekatalog mit Palmenhainen am Südseestrand zielführend zur nächsten Urlaubsplanung motiviert, zeigt er meist nur den Rand des Festlandes und lenkt die eigentlichen Sehnsüchte höchst wirkungsvoll auf das Großgewässer Meer. Aber auch die hier immer angepriesenen größeren Binnengewässer weisen fraglos ihr spezifisches Verführungspotenzial auf: Selbst Fluss- oder Binnenseekreuzfahrten sind in der Branche ein echter Renner.
Besonderer Erlebnisraum
Wasser als Lebens- und Erlebnisraum ist in jeglicher Dimensionierung eben etwas ganz Besonderes, weil es zum gewohnten Ambiente des Alltags stark kontrastiert. Eine weitere vielleicht nicht ganz überraschende Erkenntnisebene kommt hinzu: Bereits der griechische Naturphilosoph Thales von Milet (625 bis 547 v. Chr.) formulierte mit seiner berühmten Sentenz „Wasser ist der Urgrund aller Dinge“ eine grundlegende, aber damals noch weitgehend naturmythisch motivierte und verstandene Einsicht. Diese bemerkenswert klar formulierte Überzeugung lässt sich auch nach etlichen Jahrhunderten und Jahrzehnten abendländischer Wissenschaftstradition in dieser Aussage ohne Abstriche übernehmen, denn im Blick auf die absolut unverzichtbar lebensnotwendige Ressourcenfunktion des Wassers kann sie auch aus moderner hydrologischer bzw. ökologisch-biologischer Sicht durchaus als uneingeschränkte Kernaussage bestehen.
Auch die folgende Überlegung ist vor diesem Hintergrund bedenkenswert: Wasser ist auf der Erde unentwegt unterwegs. Was Sie im sommerlichen (und hoffentlich nicht überfüllten) Freibad so angenehm erfrischend umgibt oder in der nächsten Kaffeepause mit einem belebenden Muntermacher erfreut, könnte angesichts der fortwährend aktiven irdischen Wasserkreisläufe tatsächlich schon einmal die Träne eines kreidezeitlichen Dinosauriers gewesen sein. Ebenso denkbar wären aber auch ein Tautropfen auf einer entzückenden Blume irgendwo in einem vorantiken Paradiesgarten oder möglicherweise erst letztes Jahr ein Nebeltropfen im tropischen Regenwald. Die Wege des Wassers sind zwar im Prinzip bekannt, aber die ganz genauen Routen sind im Detail tatsächlich schwer zu beschreiben.
Wasser in der Wissenschaft
Wenn tatsächlich der weitaus größte Teil der Erdoberfläche von Gewässern eingenommen wird, verwundert es im Prinzip nur wenig, dass sich gerade die Naturwissenschaften in besonderem Maß dieses überaus interessanten Gegenstandes angenommen haben. Die Wasserwissenschaft insgesamt ist unter dem Dach der Hydrologie versammelt. Sie befasst sich gleichermaßen mit den Gewässern und den sie verbindenden Wasserkreisläufen. Die Limnologie untersucht und kennzeichnet die besondere Ökologie der Binnengewässer – der fließenden ebenso wie der stehenden. Die Ozeanologie, im internationalen Sprachgebrauch oft auch als Marine Biologie bezeichnet (so die Titelkomponenten mehrerer Standardlehrbücher sowie Fachzeitschriften), befasst sich dagegen nur mit der Ökologie der Weltmeere und ihrer Randbereiche. Wenn man das Verbreitungsgebiet bestimmter Arten kennzeichnen möchte, spricht man von limnischen (nur oder überwiegend im Süßwasser vorkommenden) bzw. marinen Arten. Einen aus vielerlei Gründen bemerkenswerten Sonderfall stellt die Ostsee als größtes Brackwassergebiet der Erde dar – hier zeigt sich von der dänisch-schwedischen Beltsee bzw. der Kieler Bucht mit einem den Nordseeverhältnissen noch einigermaßen angenäherten Salzgehalt bis zum Ende des Bottnischen Meerbusens vor Finnland ein bemerkenswerter ökologischer Gradient, an dem die marinen bzw. brackwassertoleranten Arten sukzessive von rein limnischen Arten abgelöst werden.
So einfach ist es nicht
1.8 Die enorme Bedeutsamkeit von Wasser zeigt sich vor allem in den notorisch unterversorgten Gebieten der Erde
1.9 In den wenigen verbleibenden Wasserlöchern der afrikanischen Savannen wird es während der Trockenzeit erkennbar ziemlich eng
Auf den ersten Blick erscheint das weltweit vorkommende Wasser als ein recht einfach konstruierter Naturstoff. Seine zweifellos überschaubar einfache Formel H2O ist eine der populärsten chemischen Formeldarstellungen überhaupt und tatsächlich in nahezu allen Bildungsschichten bekannt. Weiterhin gehört zu den bestens vertrauten und fest verankerten Grundtatsachen auch das Wissen, dass Wasser für das Leben auf der Erde einfach unentbehrlich ist und somit tatsächlich die unverzichtbare Basis allen Daseins darstellt, wie Thales von Milet (vgl. Eingangszitat zu Kap. 2) bereits vor mehr als 2500 Jahren zutreffend feststellte. Immerhin erlebt man die ganz und gar elementare Bedeutung des wundervollen und allgemein anerkannten Lebenselixiers Wasser immer dann besonders beeindruckend, wenn es – wie in den vielen bedauerlicherweise zunehmenden Dürregebieten der Erde – extrem knapp oder wie in manchen Industrieregionen nicht mehr genügend sauber verfügbar ist. Seine grundsätzliche Wertschätzung im täglichen Leben steht somit gänzlich außer Frage. Diese bedeutsame und folgenreiche Erkenntnis hält auch die erstmals 1986 vom Europarat in Straßburg formulierte „Europäische Wasser-Charta“ ausdrücklich fest: „Ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasser ist ein kostbares, für die Natur und den Menschen unentbehrliches Gut.“ Damit ist die zentrale und in jeder Hinsicht unersetzliche Rolle des Naturstoffs Wasser zweifellos treffend umrissen. Im Jahr 1993 haben die Vereinten Nationen (UN) den 23. März zum „Tag des Wassers“ (Day for Water) erklärt. Jedes Jahr steht er unter einem besonderen Motto und soll für einen sorgsamen Umgang mit den irdischen Wasserressourcen sensibilisieren. In Deutschland hat dieser UN-Tag bisher allerdings nur wenig Resonanz gefunden.
1.10 Besonders angepasste Pflanzen wie die Sukkulenten der Halbwüsten überstehen Trockenperioden mithilfe diverser Spezialeinrichtungen recht gut. Für Tiere ist das wesentlich schwieriger
Naturstoff mit großem Einfluss
Wasser ist bekanntlich farblos, geschmacksneutral, kalorienfrei und – wo es (noch) reichlich vorkommt – auch vergleichsweise preiswert. Da es andererseits aber so offensichtlich unentbehrlich ist, nahm es schon immer starken Einfluss auf Denken und Deuten der Menschen. Bereits die frühesten überlieferten Mythen verwendeten gerne und im Aussagekern meist auch übereinstimmend das Bild von abgrundtief und grenzenlos gedachten Urgewässern. So ist beispielsweise von den Babyloniern bereits aus dem dritten vorchristlichen Jahrtausend die Erzählung von der „Mutter Salzwasser“ und dem „Vater Süßwasser“ überliefert, deren Nachkommen sich zu Himmel (mit Regen) und Erde (mit Meeren und Seen) formten. Auch der nur wenig jüngere erste biblische Schöpfungsbericht in Genesis 1,1 des Alten Testaments sortiert das als Anfangszustand angenommene und so bezeichnete Chaos zunächst einmal in Wasser und Festland. Ebenfalls im Alten Testament (im 1. Buch Mose, 7–8) findet sich der Bericht von der verheerenden Sintflut, die nur der gottesfürchtige Noah mit seiner Familie und einer ausgewählten Anzahl größerer Landtiere überlebte. Ein sehr ähnliches und gleichermaßen bedrohliches Szenario findet sich – religionshistorisch durchaus bemerkenswert – in der sumerisch-babylonischen Version des Gilgamesch-Epos.
Erstmals mit den Naturphilosophen der griechischen Antike trat jedoch die rein mythische Betrachtung des Wassers stärker in den Hintergrund: Wasser nahm fortan zunehmend einen betont prominenten Platz in der logischen Erklärung der erlebten Natur ein: Der zu Recht berühmte Thales von Milet betrieb als einer der Ersten sogar schon eine Art Ursachenforschung zum Verstehen der Natur und lehrte konsequenterweise, dass Wasser die universelle natürliche Grundlage aller Leben spendenden Feuchte ist. Somit erhob er diesen wichtigen Stoff sogar zu einem allgemein gültigen Grundprinzip und beeinflusste damit eine ganze Philosophenschule. Im Denken von Empedokles (ca. 483 bis ca. 425 v. Chr.) war Wasser neben Feuer, Luft und Erde eines der vier Elemente, aus denen in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen alles Sein besteht. Der große Aristoteles (384 – 322 v. Chr.), der sicherlich bedeutendste Philosoph und Naturgelehrte der Antike, verfeinerte die von seinen denkenden Vorgängern übernommene Elementlehre um etliche Begriffspaare wie etwa warm und feucht oder kalt und trocken und beeinflusste mit dieser spezifischen Sicht die zunächst nur deutende, aber noch nicht erklärende Naturphilosophie sogar bis weit in die Neuzeit. So lehrten einerseits die antiken Ärzte Hippokrates (ca. 460 bis ca. 370 v. Chr.) und Galenos (129 – 199 n. Chr.) in ihrer später sogenannten Humoralpathologie, dass alle Krankheiten des Menschen auf eine fehlerhafte Zusammensetzung seiner wässrigen Körpersäfte zurückzuführen seien. Andererseits beherrschte diese aus heutiger Sicht sicherlich stark vereinfachend erscheinende, aber dennoch nicht gänzlich unzutreffende Sicht die berühmte Säftelehre des Arztes Paracelsus (1493 – 1541) und weiterhin die übrige Medizin des Abendlandes sogar bis weit in das 19. Jahrhundert. Erst mit der Hinwendung zur damals schrittweise entwickelten Zellforschung durch den berühmten Mediziner und Pathologen Rudolf Virchow (1821 – 1902) kam die Krankheitslehre auf einen anderen und letztlich auch erfolgreicheren Weg.
1.11 Heimische Tagfalter wie der Kleine Schillerfalter nutzen Gewässerrandbereiche gerne zum Stillen ihres Wasserbedarfs
1.12 Auch der Große Schillerfalter sucht zum Wassertanken Gewässerränder auf
1.13 Brunnen sind geradezu Verehrungsstätten des immerfort lebensspendenden Wassers. Die Aufnahme entstand auf dem Hauptplatz von Siena
1.14 Der munter plätschernde Löwenbrunnen im „Paradies“, einem Vorbau der romanischen Abteibasilika von Maria Laach, greift wie alle Brunnenanlagen das Motiv der vitalen Funktionen von Wasser auf
Vom Natur- zum Kultobjekt
Die Bedeutung, die man schon im Altertum dem Wasser beimaß, zeigt sich außer in seinen naturphilosophischen bzw. wissenschaftspropädeutischen Betrachtungen auch in seiner religiösen Verehrung: In allen animistisch bzw. polytheistisch orientierten Naturreligionen finden sich konsequenterweise besondere Fluss-, Meer-, Regen- sowie Seegottheiten. Mal sind es ausgesprochen hübsche und in ihrem Wirken angenehme bis erfreuliche Quellnymphen, mal auch andere wohlwollende Wassergeister, aber fallweise auch boshaft-widerwärtige Dämonen, die mit dem Wasser assoziiert wurden. Das mag aus heutiger Sicht erstaunen lassen oder sogar befremdlich wirken, aber: Der Unterschied zwischen der unbelebten und der belebten Natur wurde früher eben nicht so konturscharf gesehen wie in der heutigen überwiegend rationalen, wissenschaftsdominierten Weltsicht. In manchen Kulturen entlegener Erdenwinkel etwa in Afrika oder Südamerika ist das noch heute so: Fließendes Wasser oder fliegende Wolken sind für die Menschen, die noch weitgehend im nahezu steinzeitlichen (Nat-) Urzustand leben, selbstverständlich ebenso beseelt wie polternde Steine, zuckende Blitze, grollender Donner oder der sich ständig wandelnde Mond. Vor diesem Hintergrund verwundert es auch selbstverständlich nicht, dass in den Riten fast aller großen Religionen eine beachtliche Ehrfurcht vor dem Wasser tradiert ist. Rituelle Waschungen im Judentum, Weihwasser und Taufe im Christentum oder der Ganges als der heilige Fluss der Hindus sind bedenkenswerte Facetten dieses spezifischen und tradierten Empfindens.
1.15 Brunnen wohnt etwas Kontemplatives inne. Es kann demnach kein Zufall sein, dass sie oft auch im Bereich klösterlicher Kreuzgänge angelegt wurden. Das Bild zeigt die Abtei Rommersdorf bei Neuwied
Wasser ist natürlich auch ein zentrales Motiv in der Kunst. Ungezählte Gedichte thematisieren das stehende oder fließende Wasser – zu denken ist dabei an die zahlreichen Varianten des Gedichtes „Der römische Brunnen“ von Conrad Ferdinand Meyer (1825 – 1898). Auch zahlreiche Maler setzten sich mit der Dynamik und Farbigkeit dieses Mediums auseinander – eine Aufzählung oder auch nur ein halbwegs brauchbarer Überblick verbieten sich auch in diesem Kontext angesichts der beachtlichen Werkfülle. Zwei Ausnahmen seien aber erlaubt: Zu Recht berühmt sind die verschiedenen Varianten der Seerosenbilder von Claude Monet (1840 – 1926), die er in seinem zweifellos zauberhaften Garten in Giverny in der Normandie über rund 30 Jahre hinweg immer wieder gemalt hat. Auch Emil Nolde (1864 – 1956) hatte in seinem extrem bunten, weil ungewöhnlich artenreich ausgestatteten Garten seines norddeutschen Wohnsitzes Seebüll nahe der dänischen Grenze einen größeren, nach Art eines Fethings (S. 86) angelegten Teich, der in seinem malerischen OEuvre gelegentlich motivisch aufscheint.
Seit der römischen Antike finden sich in der klassischen Architektur Belege für technisch ungemein ausgereifte Badeanlagen mit Warmbecken (Caldarium) und Kaltbecken (Trepidarium) sowie aufwendige Zusatzeinrichtungen für die Wasser-(zu-) leitung: Die 95,4 km lange und noch in großen Teilstücken erhaltene römische Wasserleitung aus der Eifel in die seinerzeit bedeutende römische Provinzhauptstadt Köln (CCAA: Colonia Claudia Ara Agrippinensium) war eine der Längsten im gesamten damaligen Imperium und eine überaus beachtliche Ingenieurleistung der Antike. Später entwickelte man besondere Wasserspiele, Springbrunnen oder künstliche Kaskaden. Im Kreuzgang zisterziensischer Klöster, dem bevorzugten Ort der monastischen Kontemplation, gab es vielfach wunderschön ausgeformte Brunnenanlagen oder sogar – wie beim Kloster Maulbronn in Baden-Württemberg – architektonisch besonders kunstvoll gestaltete Brunnenhäuser.
Ganz sprichwörtlich
Auf das Leben spendende und erhaltende Wasser nimmt ebenfalls eine reichhaltig entwickelte Metaphorik klaren Bezug: Die Hände in Unschuld waschen, die versiegenden Kräfte, jemandem das Wasser abgraben, die (politische) Brunnenvergiftung, jemanden im Regen stehen lassen, vom Regen in die Traufe geraten, Wasser auf jemandes Mühle geben oder schlicht untergehen sind einige von vielen sprichwörtlichen Wendungen, welche die anerkannte und nachhaltige Bedeutung des Wassers im Alltagsleben widerspiegeln. Nicht zu vergessen sind natürlich die vielen Ortsbezeichnungen, die das Wasser als Namensbestandteil führen. Das aktuelle Postleitzahlenverzeichnis führt allein für Deutschland ein rundes Dutzend Ortsnamen auf, die mit Wasser beginnen.
Wasser als Namensgeber betrifft natürlich auch manche Flüsse selbst: Während beispielsweise Donau, Elbe oder Weser zwar vorgermanische, aber in ihrem Begriffsinhalt nicht weiter erklärbare Namen tragen, verkündet der Rhein, Deutschlands sicherlich bedeutendstes Fließgewässer, sofort, was sich dahinter verbirgt, nämlich ein Fluss. Seine Benennung lässt sich nämlich unzweifelhaft vom indogermanischen reinos bzw. rinos ableiten, mit dem das altgriechische ρειν [rheïn] = „fließen“ in direkter Verbindung steht. Mit dem Verb rheïn sind auch das neuhochdeutsche „rinnen“, in den iberischen Sprachen das Wort rio oder im Englischen die Vokabel river für Fluss sprachverwandt. Das Wasser ist somit konsistenter Bestandteil aller Bereiche der Kultur.
1.16 Kultisches Wasser: Der berühmte dreischalige Brunnen im Kloster Maulbronn ist in einer eigenen Brunnenkapelle am Kreuzgang aufgestellt