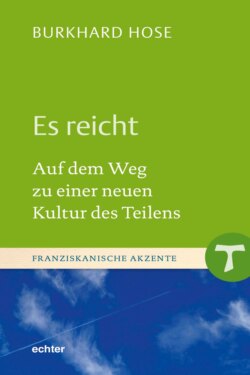Читать книгу Es reicht - Burkhard Hose - Страница 7
ОглавлениеGib mir die Kraft, die Armen nie zu verleugnen und meine Knie vor frecher Macht nie zu beugen.
Rabindranath Tagore
Vorwort: Die Entdeckung einer Kultur des Teilens – das Abendmahl von Herne
Eine offene Tür. Ein Küchentisch. Eine Scheibe Brot und ein Becher Wein. Und keiner, der peinliche Fragen stellt. Das reicht für ein Abendmahl, vielleicht sogar für mehr.
Es muss im Winter 1989 gewesen sein, als ich zum ersten Mal während meines Theologiestudiums begriffen habe, worum es bei den Mählern ging, die Jesus mit Menschen seiner Zeit gefeiert hat. Meine Lehrer waren an diesem Abend drei Franziskaner. Anfang der 1980er Jahre hatten sie eine Wohnung in der Obdachlosensiedlung Buschkampstraße in Herne bezogen. Freiwillig. Und das unterschied sie von allen anderen, die hier lebten. In der städtischen Notunterkunft wohnten Menschen, die wegen einer Zwangsräumung ihre Wohnung verlassen mussten, ihren Job verloren hatten oder nach einer Haftzeit auf dem freien Wohnungsmarkt keine Bleibe fanden. Freiwillig kam hier keiner hin. Deshalb wurde die kleine franziskanische Gemeinschaft anfangs auch skeptisch beäugt.
Warum zieht jemand aus freien Stücken in so eine Straße? Ich hatte mich bei einem Besuch bei einem befreundeten Franziskaner, den ich während des Studiums in der Schweiz kennengelernt hatte, auf einige ruhige Tage im Kloster in Münster eingestellt. Stattdessen nahm er mich mit nach Herne. In meiner Erinnerung hat sich die ausweglose Lage der Obdachlosensiedlung eingeprägt, in der sich der Konvent der Franziskaner niedergelassen hatte. Die Ausweglosigkeit, die viele Menschen hierhergebracht hatte, stellte sich für mich ganz konkret dar: An zwei Seiten war die Siedlung umgrenzt von einer Autobahn und von einem Bahndamm. Wer hier gelandet war, musste sich fühlen wie in einer Sackgasse. Die Franziskaner, die hier wohnten, teilten das Leben der Menschen, die das Leben hierherverschlagen hatte – vielleicht müsste ich besser sagen: Die Umstände hatten die Menschen hierherverschlagen. Und sie hielten sie hier fest. Denn wer die Buschkampstraße als Adresse angab, hatte es schwer, aus ihr wieder herauszukommen. Kein guter Absender, um einen Job oder eine bessere Wohnung zu finden. Diese Erfahrung machten auch die Franziskaner, die sich ja eigentlich freiwillig hier niedergelassen hatten und die sich vorgenommen hatten, sich ganz auf die Umstände einzulassen.
Als ich die kleine Gemeinschaft kennenlernte, bestand sie schon einige Jahre, und es war bereits Vertrauen gewachsen, vielleicht sogar so etwas wie eine neue Kultur des Zusammenlebens. Menschen, die freiwillig auf Privilegien verzichteten, lebten zusammen mit Menschen, denen Privilegien versagt blieben. Sie wollten sie nicht missionieren, aber ihnen war anzumerken, dass sie eine Mission hatten. In der Obdachlosensiedlung zu leben war die Erfüllung eines Auftrags, den sie für sich aus dem Evangelium und ihrer franziskanischen Lebensweise heraus formulierten. Dabei ging es nicht um eine asketische Übung oder um Selbstkasteiung. Es war vielmehr der Versuch, eine neue Kultur des Teilens zu praktizieren. Und zu dieser neuen Kultur gehörte dazu, das eigene Leben so weit zu verändern, dass benachteiligte Menschen nicht durch die Begegnung beschämt wurden. Mit Beschämung meine ich das Gefühl, das sich in Menschen einstellt, denen aus einer Position der Überlegenheit heraus geholfen wird. Mir wurde klar, dass die Beschämung vielleicht die größte Barriere ist, die privilegierte und nichtprivilegierte Menschen voneinander trennt.
Am Küchentisch, an den die Franziskaner zum Abendmahl einluden, wurde mir endgültig klar, was der franziskanische Konvent hier zu leben versuchte. Damals begann ich zu verstehen, was Jesus vermutlich im Sinn hatte, als er mit Menschen zu Tisch saß, die nicht zu den Privilegierten gehörten. Diese Mähler brachten Jesus einen zweifelhaften Titel ein, der sich in den Evangelien erhalten hat: „ein Fresser und Säufer, ein Freund der Zöllner und Sünder“ (Mt 11,19).
Die Verhältnisse in der Welt werden sich wohl erst verändern, wenn Teilen nicht mehr länger die Festlegungen der Gesellschaft verstärkt, indem Reiche nur etwas von ihrem Überfluss abgeben und Armen dadurch zwar in ihrer materialen Not geholfen wird, sie aber innerlich beschämt in einer grundsätzlich unveränderten Lage zurückbleiben. Am Küchentisch in Herne wurde mir klar: Gerechter wird die Welt erst durch eine neue Kultur des Teilens, die gleichzeitig alte Trennlinien zwischen Besitzenden und Benachteiligten in Frage stellt. Echtes Teilen beginnt da, wo mein Leben andere Menschen nicht mehr länger beschämt, sondern dazu beiträgt, dass bislang Benachteiligte ihre Würde leben können.
Manchmal genügt dafür eine offene Tür, ein Küchentisch, eine Scheibe Brot und ein Becher Wein. Und keiner, der peinliche Fragen stellt.