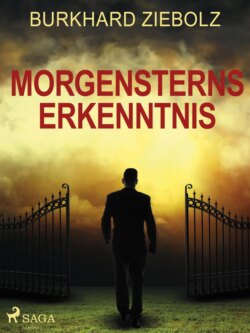Читать книгу Morgensterns Erkenntnis - Kriminalroman aus Niedersachsen - Burkhard Ziebolz - Страница 9
Dritter Tag
ОглавлениеEs war exakt acht Uhr. Etwa vierzig Damen und Herren der Dienststelle saßen, den Kaffee oder Tee vor sich, im Besprechungsraum des Polizeipräsidiums Münzstraße beim morgendlichen Briefing. Der Reihe nach berichteten die jeweils leitenden Beamten von ihren Ermittlungen, um den allgemeinen Kenntnisstand der Kollegen abzugleichen.
Fröhlich war der dritte Beamte, der Bericht erstattete. Nach dem Interview mit Dr. Frenzel hatte es doch noch einige interessante Informationen gegeben. Überprüfungen der Bankverbindungen der Toten hatten ergeben, daß sie über ein Vermögen von knapp einer dreiviertel Million Mark verfügt hatte. Das Geld war von ihr selbst in den letzten vier Jahren in unregelmäßigen Raten zu etwa 50.000 DM bar auf ihr Konto eingezahlt worden. Vor etwa drei Jahren und vor einem Jahr hatte es größere Einzahlungen über 200.000 DM gegeben. »Entweder zahlt der Öffentliche Dienst doch besser, als man uns weismachen will, oder sie hatte eine lukrative Nebenbeschäftigung«, vermutete Fröhlich.
»Das stinkt etwas nach Erpressung«, bemerkte einer der Kollegen. Daran hatte Fröhlich natürlich auch schon gedacht, warum sollte die Ärzteschaft frei von krimineller Habgier sein. Allerdings paßte das nicht ganz zu dem, was er bisher über die Tote gehört hatte.
Da die Morgenstern nach den bisherigen Ermittlungen so gut wie kein Privatleben gehabthatte - die Überprüfung des Resozialisierungskreises hatte ergeben, daß sie nur zahlendes Mitglied war, sich aber selten bei den wöchentlichen Treffen sehen gelassen hatte -, sah es derzeit so aus, als könnte der Täter nur aus dem Krankenhausumfeld kommen.
»Hatte sie Schwierigkeiten mit dem Personal oder den Kollegen?«
»Fehlanzeige. Sie war umgänglich und gutmütig wie ein Koala. Es gibt niemanden, der sich negativ über sie geäußert hat.«
»Was ist mit beruflicher Konkurrenz?« wollte einer wissen.
»Das könnte eher passen«, räumte Fröhlich ein und zündete sich leicht zerstreut eine Zigarette an. Das Protestgeschrei der anwesenden Nichtraucher bewirkte allerdings, daß er sie gleich wieder ausdrückte.
»Anscheinend war sie der große Bremsklotz für die Karriere ihres Assistenten und Kollegen Frenzel. Aber deshalb jemanden umlegen? Glaube ich nicht.«
»Und ihre Patienten? Sie behandelte doch diese ganzen kleinen Pannetypen. Könnte da nicht einer dabei sein, der seine Macke an ihr ausgelassen hat?«
»Wäre immerhin möglich.« Fröhlich hatte die Stirn in tiefe Falten gelegt und betrachtete angestrengt das Plakat an der hellgelb getönten Wand. ›Sei schlauer als der Klauer‹, stand da in großen Buchstaben zu lesen.
»Aber wer von denen hatte Zugang zu diesem Gift? Und wer konnte es ihr verabreichen? Die sitzen alle in einer geschlossenen Abteilung, keiner kann raus oder rein ohne Kenntnis des Pflegepersonals.«
»Hoffentlich«, grummelte es aus den hinteren Reihen. »Das letzte, was uns fehlt, ist eine Herde blutrünstiger, abgedrehter Halbwüchsiger.«
Fröhlich sah seinen Kollegen ohne Begeisterung an. »Von dir würde ich gern mal was Konstruktives hören, Meyer.«
Meyer zuckte die Achseln. »Wenn du darauf bestehst. Wie wäre es denn, wenn ihr das Gift schon viel früher verabreicht worden wäre und es erst zu wirken begann, als sie sich schon eingeschlossen hatte?«
»Respekt.« Fröhlich meinte es ernst. »Geht aber nicht, dazu wirkt das Gift in der Dosierung, die wir bei ihr gefunden haben, viel zu schnell.«
»Seid ihr schon in der Frage weitergekommen, wie ihr die Injektion verabreicht wurde? Anscheinend war doch keine Spritze am Tatort, und das Büro war von innen abgeschlossen.«
»Negativ. Wir haben noch nicht mal eine Theorie.«
»Was ist mit diesem Zwerg mit den vergifteten Fingernägeln, der immer durch den Luftschacht der Klimaanlage klettert? Ein Kratzer, und du hast es hinter dir«, gab Meyer zu bedenken.
Diesmal mußte auch Fröhlich lachen. »Wir haben alle Zwerge mit vergifteten Fingernägeln überprüft. Sie waren zur Tatzeit im Garten.«
Damit war dann das Ideenpotential der Gruppe erschöpft. Natürlich waren die Kollegen alle sehr bemüht, aber der eigene Fall beschäftigte sie gedanklich doch mehr, deshalb wurden bei den Morgenbesprechungen meist nur spontane Einfälle ausgetauscht. Manchmal tauchten Parallelen zwischen Fällen auf, oder jemand konnte sich an Fakten aus alten Vorgängen erinnern, was schon oft erstaunliche Erfolge gezeitigt hatte. Einmal hatte eine der Meyerschen Blödelbemerkungen die Tür zu einer Theorie aufgestoßen, auf die wahrscheinlich durch ernsthaftes Nachdenken keiner gekommen wäre und die sich schließlich als richtig erwiesen hatte.
Leider passiert das viel zu selten, sinnierte Fröhlich bedauernd, als er seinen Bericht beendet hatte und wieder in seinem Büro saß. Er zog konzentriert an der zweiten Frühstückszigarette. Angeregt durch einen Fernsehbericht mit sehr gelungener Computeranimation vom vorherigen Abend - Stichwort: Was richtet das Rauchen in der Lunge an? -, malte er sich dabei aus, wie sich seine Lungenbläschen langsam mit klebriger, brauner Teermasse füllten. Er mußte husten und schüttelte sich.
Erpressung. Das viele Geld auf Dr. Morgensterns Konto. Die Erpressungstheorie war vielleicht am erfolgversprechendsten. Aber wer hatte genug Dreck am Stecken, um sich erpressen zu lassen? Und wer hatte genug Geld, um so hohe Summen zu bezahlen? Frenzels teure Büroeinrichtung fiel ihm ein. Vielleicht sollte er den Doktor mal zu Hause besuchen und sehen, ob er dort auch so luxuriös wohnte.
Der erste Weg an diesem Tag führte ihn aber noch einmal ins Krankenhaus. Der größte Teil des Personals war in der Zwischenzeit schon vernommen worden. Die Stationsschwester, die die Leiche gefunden hatte, hatte einen Schock erlitten. Man hatte sie nach Hause gebracht, so daß eine Befragung am selben Tag nicht möglich gewesen war. Als Fröhlich nach dem Morgenbriefing im Krankenhaus anrief, erfuhr er, daß sie nun jedoch wieder im Dienst war.
Schwester Edith Sorgsam-Schröten (kaum zu glauben, daß jemand sich so was freiwillig antut, grauste sich Fröhlich im Geiste) war das Urbild der Krankenschwester. Sie war Anfang Vierzig, von kleiner, aber sehniger Statur. Ihr Kittel war so fleckenlos weiß, daß er wahrscheinlich in der Dunkelheit leuchtete, und ließ sekundäre Geschlechtsmerkmale nicht mal erahnen. Die Haare waren sorgfältig frisiert und sahen aus, als könne kein Windstoß sie aus ihrer derzeitigen Lage verrücken. Von ihrem desolaten Zustand nach dem Fund der Leiche war nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil, sie machte einen sehr energischen und offenen Eindruck. Obwohl sie ihm gegenüber freundlich war, konnte Fröhlich erahnen, daß ihre burschikose Art ihr nicht nur Freunde einbrachte.
Wie immer begann Fröhlich die Vernehmung mit einigen belanglosen Sätzen, die den Gesprächspartner auflockern sollten. Dies brachte ihm ein paar Informationen über die private Schwester Edith ein. Sie plauderte sehr bereitwillig und erzählte ihm, daß sie in ihrer Freizeit extremen Sport trieb (Karate und Fallschirmspringen), daß sie einen Porsche fuhr, daß sie einen Hund hatte und daß sie ein großes Haus in der teuersten Gegend der Stadt bewohnte. Außerdem liebte sie ihre Arbeit und war nicht auf ihr Gehalt angewiesen. Offenbar verdiente ihr Mann, der Inhaber eines Architekturbüros war, genug.
Dr. Morgenstern hatte sie - wie alle anderen auch - nur dienstlich gekannt und beschrieb sie als überaus korrekte Person. Fröhlich war überzeugt davon, daß dies in Schwester Ediths Sprachgebrauch eine Menge bedeutete.
»Feinde? Kann ich mir nicht vorstellen. Sie hat doch nur für ihre Arbeit gelebt. Im Krankenhaus kannte und schätzte sie jeder. Irgendwie... irgendwie hatten alle, auch die, die sie erst kurz kannten, den Eindruck, sie wüßten schon alles über sie. Verstehen Sie, was ich meine? Manchmal trifft man jemanden und glaubt, ihn schon ewig zu kennen. Sie hatte kein Privatleben, das war bekannt, also nahmen wir das, was wir jeden Tag bei der Arbeit sahen, als den wirklichen Menschen Morgenstern an. Vielleicht war sie aber ganz anders, als sie sich hier gab.«
»Wer könnte es also getan haben?«
»Ich glaube, der Mörder muß ein psychisch Gestörter gewesen sein.«
»Sie meinen, einer Ihrer Patienten?« hakte Fröhlich nach.
Die Schwester schluckte hörbar und wurde blaß. Sie schüttelte heftig den Kopf. »Das halte ich für ausgeschlossen«, preßte sie hervor. »Unsere Patienten reagieren alle sehr kontrolliert, keiner von ihnen wäre im derzeitigen Stadium seiner Behandlung zu einem Mord fähig.«
Fröhlich blickte sie nachdenklich an. Brodelte da etwas unter dem Topfdeckel? Er beschloß, die Frau auf kleiner Flamme schmoren zu lassen.
Die beiden schwiegen. Es war plötzlich sehr ruhig im Zimmer, nur das Ticken der großen, runden Wanduhr war zu hören. Fröhlichs Blick wanderte im Raum umher. Zwei der weißen Wände waren mit eierschalenfarbenen Metallschränken zugestellt, an der dritten stand ein weißer Schreibtisch, ebenfalls aus Metall. Den unteren Teil der vierten Wand, die Fröhlichs Platz gegenüber lag, bedeckte ein Regal mit Fachbüchern und Aktenordnern. Darüber hingen Fotos.
Er fixierte sie stirnrunzelnd. Es waren Schnappschüsse, die das Personal gemeinsam mit den Patienten zeigten. Teilweise hingen die Bilder ordentlich in Rahmen, teilweise waren sie nur mit Klebeband an die Wand geheftet.
Auf einer Fotografie war Schwester Edith mit einer Gruppe junger Leute in abgewetzten Jeans und ebensolchen T-Shirts abgebildet. Die meisten trugen lange Haare, es gab viele Tätowierungen, vielfach beringte Ohrläppchen und durchbohrte Nasenflügel. Sie stand mitten in der Gruppe und hatte den Arm um ein dünnes, blasses Mädchen von etwa fünfzehn Jahren gelegt. Das Bild war anscheinend im Innenhof des Gebäudes, der nach außen hin hermetisch abgeschlossen und nur über eine Treppe von der Station aus zu erreichen war, aufgenommen worden.
Auf einem anderen Bild stand Frenzel im Trainingsanzug inmitten der gleichen Gruppe. Die Jugendlichen trugen ebenfalls Sportzeug, einer hielt ein Netz mit Bällen in der Hand. Ein Junge, der dicht hinter Frenzel stand, fiel Fröhlich auf. Er war dicklich, und sein blondes, gut geschnittenes Haar machte im Gegensatz zu dem seiner Freunde einen sehr gepflegten Eindruck. Er war ungefähr vierzehn und hatte ein Mopsgesicht. Der Junge fixierte den Hinterkopf des Arztes mit einem Gesichtausdruck, in dem grenzenlose Verehrung zu liegen schien.
Fröhlichs Blick wanderte wieder zurück zu Schwester Edith. Sie hatte sich nicht, wie erwartet, entspannt, sondern machte einen noch verkrampfteren Eindruck als vorher. Ihre Hände drehten ein Taschentuch zur Wurst, die Knöchel waren schon weiß angelaufen. Ein leichter Schweißfilm wurde auf ihrer Stirn sichtbar. Seltsam, daß viele Menschen kein Schweigen während eines Gesprächs ertragen können, sinnierte der Kommissar. Wahrscheinlich eine Zivilisationserscheinung. Wesen von Kultur unterhalten sich halt, wenn sie zusammenkommen, Schweigen ist unhöflich.
Fröhlich gratulierte sich im Stillen selbst. Er hatte den richtigen Riecher gehabt, hier lag irgendwo ein Hund begraben. Edith hatte offenbar sein Gesicht beobachtet, als er sich die Bilder ansah. Ihr eigenes wies nun einen sehr besorgten Ausdruck auf, eine tiefe, senkrechte Falte grub sich in die Stirn zwischen ihren Augen.
»So, das halten Sie für ausgeschlossen«, echote Fröhlich mit zweiminütiger Verspätung. »Warum denn?« Edith sollte keine Gelegenheit erhalten, sich wieder zu entspannen.
»Nun, keiner unserer Patienten ist unkontrollierbar oder absolut unberechenbar. Wenn Sie sie kennenlernen würden, würden sie Ihnen wie normale andere Kinder in dem Alter vorkommen. Dr. Morgenstern hatte zu allen ein gutes Verhältnis, die Patienten mochten sie. Es gab nie Aggressionen gegen sie.« Die Schwester sprach jetzt sehr schnell.
Fröhlich sah sie nachdenklich an. Er erhob sich ruckartig und ging auf die Wand gegenüber zu, wobei er Schwester Ediths Hände beobachtete. Das Taschentuch war mittlerweile derart verdichtet, daß es bei weiterer Bearbeitung sicher die Härte von Diamant annehmen würde. Sie beugte sich etwas vor, schien sich ebenfalls von ihrem Platz erheben zu wollen.
Fröhlich hatte die Wand erreicht und stand nun mit dem Rücken zu seiner Gesprächspartnerin. Er tippte mit dem Finger auf das Bild mit dem blonden Jungen und drehte sich herum.
»Wer ist das?«
Schwester Edith atmete hörbar. »Das ist Tobias Kronburger. Er ist seit drei Jahren bei uns, weil er seine Schwester umgebracht hat.« Sie schien sich beim Sprechen etwas zu fangen.
Einige Zeit war es still. Der Hauptkommissar richtete wieder den Blick auf das Bild des blonden, harmlos aussehenden Jungen. »Warum hat er seine Schwester ermordet?«
»Wir wissen es nicht. Er stammt aus guter Familie, ist gut in der Schule, immer nett, hat viele Freunde. Nur dieses eine Mal vor etwa drei Jahren ist er ausgerastet, mit der Folge, daß seine Schwester mit durchgeschnittener Kehle in ihrem Bett lag.«
Fröhlich erinnerte sich an den Fall. Ein alter Freund von der Polizeischule hatte ihn bearbeitet. Innerhalb weniger Stunden war Tobias, damals gerade elf Jahre alt, als Täter identifiziert worden. Die Tatwaffe, ein Fischmesser aus dem Besitz seines Vaters, wurde bei ihm gefunden. Sie wies einen blutverschmierten Fingerabdruck auf, der von Tobias stammte. Außerdem hatte ihn ein Zeuge kurz vor der Tat in das Mordzimmer gehen sehen. Es war eine klare Sache.
Tobias legte zwar ein Geständnis ab, gab aber später auch an, sich an den Abend der Tat nicht mehr richtig erinnern zu können. Man stellte eine partielle Amnesie fest, Hinweise auf ein Mordmotiv wurden nie gefunden.
Die Eltern waren erschüttert gewesen. Das Gericht hatte den Jungen wegen der latenten Gefahr, die von ihm ausging, auf unbestimmte Zeit in eine Heilanstalt eingewiesen.
»Dr. Frenzel ist übrigens ein alter Freund von Tobias' Vater und hat sich des Jungen intensiv angenommen«, berichtete Schwester Edith weiter. »Er hat natürlich ein starkes persönliches Interesse an der Sache, außerdem schreibt er an einer Arbeit über Tobias' Fall. Tobias mag ihn sehr und ist, wann immer er darf, bei ihm. Seine Eltern haben ihn hier noch nie besucht. Sie sind über den Verlust der Tochter noch nicht hinweggekommen.«
»Kann man verstehen«, murmelte Fröhlich bedauernd.
Er war nicht so recht zufrieden mit dem Gesprächsverlauf, hatte aber das Gefühl, im Moment nicht weiterzukommen. Deshalb verabschiedete er sich und ging zur Tür, wo er sich noch einmal umdrehte.
»Wir werden uns noch einmal unterhalten müssen, Frau Sorgsam-Schröten.« Fröhlich brachte den Zungenbrecher über die Lippen, ohne anzuecken. »Sie bleiben doch in nächster Zeit in der Stadt, oder?«
Schwester Ediths Teint, der sich etwas erholt hatte, nahm wieder die Farbe ihres Kittels an. Sie versicherte, daß sie in den nächsten Tagen während der Dienstzeiten im Krankenhaus und abends zu Hause anzutreffen sei.
Fröhlich verließ das Zimmer. Vielleicht hatte er eben eine Spur gefunden. Schwester Ediths Verhalten war jedenfalls mehr als merkwürdig. Er nahm sich vor, die Akten des Kronburger-Falles noch einmal durchzugehen. Außerdem mußte er mit Tobias sprechen. Sicher würde er nicht mehr aus dem Jungen herauskriegen als die psychologisch geschulten Angestellten des Krankenhauses; aber vielleicht ergab sich jetzt, einige Zeit nach der Tat, aus dem Blickwinkel des Polizisten ein neuer Aspekt.
Er ging über den Flur der Station und nahm die Treppe nach unten. Der Grundriß der Klinik hatte H-Form, die Halle des Krankenhauses war sozusagen der waagerechte Strich des Hs. Sie war im Moment - um die Mittagszeit - fast leer. Zwei Patienten in Bademänteln mit eingegipsten Unterschenkeln - einer trug den Gips rechts, einer links - saßen auf Besucherstühlen und unterhielten sich. In der Cafeteria trank eine Frau einsam einen Kaffee. Der Pförtner des Gebäudes, der gleichzeitig die Telefonzentrale betreute, saß in seiner Loge. Es war der gleiche Mann, der Fröhlich am ersten Tag der Ermittlungen etwas über Dr. Morgenstern erzählt hatte.
Fröhlich winkte ihm jovial zu und nahm den Fahrstuhl in den ersten Stock des südlichen Westflügels, dort lag das Geschäftszimmer der Krankenhausleitung. Der zweite Stock beherbergte die geschlossene Abteilung Psychiatrie III mit den Patienten von Morgenstern und Frenzel.
An der Tür des Geschäftszimmers standen, mit weißen Plastikbuchstaben auf grauem Plastikgrund, die Namen der Schreibkräfte: Martha Grumbach und Marlene Dittmann. Fröhlich betrat das Sekretariat.
Es war ähnlich funktionell eingerichtet wie alle anderen Räume im Gebäude. An der Wand hingen eine Metalltafel, auf der mit farbigen Magnetplättchen die Dienstzeiten der Ärzte markiert waren, und ein großer Kalender mit dem Foto eines Lavendelfeldes.
Zwei Frauen, die eine jung und hübsch, saßen an sich gegenüberstehenden Schreibtischen und blickten auf, als er eintrat. Er stellte sich vor.
Die ältere erhob sich (dem Namen nach wahrscheinlich Martha, kombinierte der Polizist) und ging ihm einige Schritte entgegen. Fröhlich verlangte den Direktor zu sprechen.
»Wir haben einen Geschäftsführer.« Martha schien eine der schnippischen Vertreterinnen der Sekretärinnenzunft zu sein. Fröhlich war diesem Typ oft begegnet; aus dem Sonderstatus ihres Chefs leiteten sie auch einen Sonderstatus für sich selbst ab und gaben das nach außen weiter. Er schmunzelte.
»Professor Dr. Walkemeier hat jetzt wenig Zeit.«
»Das trifft sich gut«, antwortete er. »Ich brauche auch nur wenig. Würden Sie mich bitte anmelden?«
Marthas Gesicht war wie aus Stein gehauen. »Worum geht es denn?«
»Das sage ich ihm dann schon.« Fröhlich beobachtete belustigt, wie sich der Stein rötlich verfärbte. »Also schön: Es handelt sich um kriminalistische Erhebungen. Sie wissen ja, jeder ist verdächtig.« Er zwinkerte ihr zu.
Wieder mal in nur dreißig Sekunden einen lebenslangen Feind gemacht, dachte er, bereute aber nichts. Kleine Freuden wie diese machten das Leben lebenswert.
Martha machte auf dem Absatz kehrt und ging zu einer Tür im hinteren Teil des Zimmers. Sie klopfte gerade in der richtigen Lautstärke - respektvoll, aber nicht zu überhören. Sie trat ein, ohne die Tür hinter sich zu schließen, und man hörte leises Stimmengemurmel. Dann kam sie wieder heraus.
»Professor Walkemeier läßt bitten.«
»Das soll er nicht zweimal tun.« Mit breitem Grinsen marschierte er an ihr vorbei.
Walkemeiers Zimmer unterschied sich von den anderen, die Fröhlich bisher im Haus gesehen hatte. Es war sehr groß, etwa fünfzig Quadratmeter. Zwei Fenster ließen viel Licht herein. Die Möbel waren vorwiegend Biedermeier, sehr gut aufgearbeitet. Dunkles Braun prägte das Klima des Raumes. Zwei kleine, dunkle Gemälde mit Jagdmotiven schmückten die Wände. Wenn sie keine Reproduktionen waren, und davon ging der Hauptkommissar aus, waren sie sicherlich sehr teuer gewesen. Der Raum roch nicht unangenehm nach Pfeifentabak.
Walkemeier erhob sich lächelnd hinter seinem Schreibtisch, einem Ungetüm mit schwerer, grüner Lederschreibunterlage und einer futuristischen Leuchte aus grünem Glas, und bat ihn näherzutreten. Er war Mitte Fünfzig und korpulent. Ein teilweise ergrauter Vollbart verlieh seinem Gesicht einen patriarchenhaften Charakter, der von seiner energischen Nase noch unterstrichen wurde. Anstelle eines Kittels trug er einen grauen, gut geschnittenen Anzug.
Walkemeier bat den Hauptkommissar in einen der mahagonirot glänzenden Clubsessel aus Leder, der zu einer kleinen Sitzgruppe gehörte, er selbst setzte sich in den Sessel gegenüber. Fröhlich bemerkte, daß der Mann sich trotz seiner Leibesfülle sehr gewandt bewegte.
»Ich hatte Sie früher erwartet, Herr Hauptkommissar. Wie ich hörte, haben Sie schon einige unserer Angestellten vernommen.«
»Nur diejenigen, die sich im Umfeld des Mordes bewegt haben. Aber nun bin ich an einem Punkt, an dem ich einige grundsätzliche Informationen über den Krankenhausbetrieb brauchen könnte. Vieles wird verständlicher, wenn man den normalen Tagesablauf kennt.«
Zum Teil stimmte das. Natürlich interessierten Fröhlich diese Dinge, allerdings hoffte er auch auf einige persönlichere Auskünfte.
Er gab zunächst einen kurzen, sehr oberflächlichen Bericht zu den bisherigen Ermittlungen und fragte dann nach den Dienstzeiten der Ärzte und des Pflegepersonals, nach der Beschäftigungsdauer einiger Mitarbeiter, nach der Organisationsstruktur, nach Arbeitsabläufen. Walkemeier, der Kaffee geordert hatte und sich eine Pfeife stopfte, erwies sich als sehr kooperativ und geduldig und gab bereitwillig Auskunft.
Allmählich wechselte Fröhlich zu Fragen über, die sich mit dem persönlichen Bereich einzelner Angestellter beschäftigten. Walkemeier merkte dies sofort.
»Herr Hauptkommissar, bevor ich Ihnen weitere Fragen beantworte, möchte ich eines vorausschicken: Ich kenne mein Personal ohne Ausnahme sehr gut. Ich glaube nicht, daß irgend jemand davon zu einem Mord fähig ist. Für meine Leute lege ich die Hand ins Feuer. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß es einen wirklichen Grund gab, Frau Morgenstern zu töten. Für mich ist dies die bedauerliche Tat eines Wahnsinnigen.«
Fröhlich war beeindruckt, der Mann gefiel ihm. Er hatte Rückgrat und trat für seine Leute ein. Das war nicht unbedingt die Regel bei Vorgesetzten. Allerdings war ihm aus langjähriger Erfahrung auch klar, wie wenig man normalerweise über seine Mitmenschen wußte. Walkemeier kannte sicher nicht jeden seiner Leute persönlich.
»Vielleicht haben Sie recht. Sicher meinen Sie, daß jemand von außen in die Klinik eingedrungen ist. Aber es gibt einige Dinge, die uns daran zweifeln lassen. Gift ist keine Waffe, die häufig bei spontanen, wahllosen Morden von Geistesgestörten eingesetzt wird. Es ist recht schwer zu beschaffen, und die Anwendung erfordert etwas... nun ja, Sachverstand.«
Er setzte die Befragung fort.
»Wie gut kannten Sie Dr. Morgenstern?«
Walkemeier zog an seiner Pfeife. »Etwas besser als die anderen. Ich stand kurz vor der Beendigung meines Studiums an der Uni Marburg, als sie gerade dort ihre ersten Semester absolvierte, und lernte sie in einer Vorlesung kennen. Bald danach trat ich eine Stelle als Assistenzarzt an und verlor sie aus den Augen. Vor etwa zwölf Jahren, ich war damals hier am Krankenhaus Stationsarzt, bewarb sie sich bei uns auf eine freie Stelle und erhielt sie. Wir trafen uns anfangs einige Male und redeten über die alten Zeiten. Nach ein paar Monaten schlief der Kontakt aber nach und nach ein.«
»Gab es dafür einen Grund?« wollte Fröhlich wissen.
»Keinen konkreten. Es war nur ein diffuses Gefühl meinerseits. Sie schien nicht sehr an unseren Verabredungen interessiert zu sein, manchmal dachte ich sogar, sie wären ihr lästig. Oft hatte ich das Gefühl, sie wäre mit den Gedanken ganz woanders. Natürlich dachte ich an einen Mann, sie war damals sehr hübsch und temperamentvoll. Ich konnte aus unseren Gesprächen aber nicht entnehmen, ob sie andere Bekannte oder Freunde hatte, mit denen sie etwas unternahm, oder was sie überhaupt privat so machte. Wenn das Gespräch auf andere Themen als die Arbeit kam, blockte sie. Sie machte das übrigens sehr geschickt, zu Anfang merkte ich es gar nicht. Irgendwann fragte ich mich dann mal, was ich nun eigentlich von ihr wußte, und das war sehr wenig. In den letzten Jahren war unser Verhältnis ein rein dienstliches.«
»Gab es Konflikte in der Arbeit zwischen Ihnen?«
»Überhaupt nicht. Frau Morgenstern war eine sehr gute Fachärztin und ungeheuer engagiert in ihrer Arbeit. Ihre Veröffentlichungen sind anerkannt in der Fachwelt, sie hat dort einen wirklich guten Namen. Als Untergebene war sie sehr korrekt, kooperativ und hilfsbereit, es gab nie Anlaß auch nur zu der kleinsten Klage. Ihr Tod ist ein großer Verlust für das Krankenhaus.«
Fröhlich unterdrückte mühsam ein Gähnen. Alle erzählten das gleiche über die Ermordete, aber wenn sie keine Feinde gehabt hätte, wäre sie wahrscheinlich noch am Leben. Walkemeiers Rückblick auf die Anfänge von Frau Morgensterns Arbeit im Krankenhaus war allerdings interessant gewesen.
Er räusperte sich.
»Wer wird eigentlich ihr Nachfolger?«
»Im Moment nimmt Dr. Frenzel diese Aufgabe wahr. Er kommt auch durchaus als regulärer Nachfolger in Frage. Natürlich müssen wir die Stelle ausschreiben, aber von den Anforderungen her ist Frenzel wahrscheinlich von allen potentiellen Bewerbern der geeignetste. Er ist in der Klinik anerkannt. Er hat seit Jahren mit Frau Morgenstern zusammengearbeitet und kennt jeden Fall, den sie auch kannte. Er hat an vielen ihrer Veröffentlichungen mitgeschrieben und ist deshalb auch in der Ärzteschaft kein unbeschriebenes Blatt. Ja, ich denke wirklich, er wäre der Beste für den Job«, bestätigte Walkemeier sich selbst noch einmal sein Urteil.
Fröhlich lächelte. Da war doch schon mal jemand, der von Dr. Morgensterns Ableben profitierte.
»Was ist Dr. Frenzel für ein Mensch?«
Walkemeier zog wieder bedächtig an seiner Pfeife. »Frenzel ist schon in Ordnung. Er kommt aus sehr guter Familie - seinem Vater gehört die Frenzel-Chemie GmbH, Sie haben vielleicht schon davon gehört. Sie produzieren chemische Erzeugnisse für spezielle Nischenanwendungen.«
Fröhlich kannte die Firma wirklich. Sie hatte ihren Standort in der Nähe von Braunschweig, gehörte zu den fünfzig größten der Branche und hatte in den letzten Jahren schwindelerregende Zuwachsraten erzielt. Dieser Hintergrund erklärte natürlich Frenzels Lebensstil und seine teure Büroeinrichtung.
»Frenzel hat Schule und Studium mit hervorragenden Ergebnissen hinter sich gebracht. Er tat mir immer ein wenig leid; an einem anderen Krankenhaus, in einer anderen Konstellation, hätte er sicher schon eine sehr gute Karriere gemacht. Hier war Dr. Morgenstern immer vor ihm.«
Er sah den Hauptkommissar prüfend an. »Nicht daß Sie dadurch auf Ideen kommen. Frenzels Ehrgeiz hält sich in Grenzen und ist auf keinen Fall groß genug, um einen Mord zu begehen.«
»Warum ist er nicht an ein anderes Krankenhaus gegangen?«
»Das habe ich ihn auch gefragt. Er wollte nicht. Seine Arbeit hier interessiert ihn so sehr, daß er sich etwas anderes nicht vorstellen kann. Außerdem erklärt er es auch mit persönlichen Beziehungen in der Nähe. Er hat seine Familie hier und arbeitet manchmal wohl auch noch beratend in der Produktentwicklung der Frenzel-Werke mit.«
»Ein vielseitiger Mensch. Ist er verheiratet, oder hat er eine Freundin?«
Der Professor zog leicht die Brauen zusammen. »Er ist nicht verheiratet. Ich habe ihn auch nie mit einer Frau gesehen. Das muß aber nichts heißen, es gab nicht viele Gelegenheiten, bei denen ich zugegen war und er jemanden hätte mitbringen können. Er ist ein gutaussehender Bursche, intelligent, hat Charme und noch dazu Geld. Sollte mich wundern, wenn er kein Mädchen hätte.«
»Frenzel ist sehr im Fall Tobias Kronburger engagiert«, bemerkte Fröhlich.
»Ja, das ist richtig. Sein Interesse ist sowohl beruflicher als auch privater Natur. Frenzel kennt die Kronburgers schon lange. Er war oft bei ihnen zu Gast, übrigens auch an dem Abend, an dem die kleine Karla ermordet wurde. Genaugenommen war er derjenige, der Tobias ins Zimmer seiner Schwester gehen sah und der ihn dann vor Gericht belasten mußte. Während des Verfahrens setzte er sich dafür ein, daß Tobias bei uns eingeliefert wurde. Er hatte schon vor der Tat ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, war sehr oft mit ihm und seiner Schwester zusammengewesen, Zoo, Tennis, Fußball und so weiter. Tobias hängt an ihm wie ein Schoßhund.«
Ohne es zu wissen, hatte er genau Fröhlichs Eindruck von dem Foto bei Schwester Edith wiedergegeben.
»Kommt Tobias in der Therapie gut voran?«
»Bei Fällen wie diesem ist eine Kontrolle nur schwer möglich. Wie Sie vielleicht wissen, ist Tobias vor der Tat niemals durch Gewalttätigkeit aufgefallen. Gerade das macht die Geschichte so rätselhaft - und für den Fachmann so interessant.«
»Was ist Ihre Diagnose? Was war der Auslöser für die Tat?«
»Unsere bisherigen Untersuchungen - oder besser Dr. Frenzels bisherige Untersuchungen - lassen auf eine Art multiple Persönlichkeit schließen. Tobias ist gleichzeitig noch eine zweite Persönlichkeit, die sich aber nur sehr selten zeigt. Das erklärt auch, warum er sich an nichts erinnern kann - im Moment verfügt er nur über sein Gedächtnis als Tobias Kronburger, die andere, dunkle Persönlichkeit hat sich zurückgezogen. Fälle dieser Art sind nicht selten. Es gibt Patienten, die zehn und mehr verschiedene Charaktere in sich vereinen. Je nachdem, mit welchem man gerade spricht, können sie nett, aggressiv, intelligent, dumm, eine Frau, ein Mann oder etwas anderes sein.«
Leute mit dauernd wechselnden Charaktereigenschaften waren sicherlich als Gesprächspartner nicht uninteressant und boten viele Überraschungen, dachte Fröhlich.
»Gibt es für Tobias eine Heilungschance?«
»Nach dem heutigen Stand des Wissens keine hundertprozentige. Seit er hier ist, hat er keine Anzeichen von Fehlverhalten erkennen lassen. Frenzel arbeitet täglich mit ihm, wesentlich öfter als mit anderen Patienten. Ob dies irgend etwas bewirkt, ist schwer zu sagen. Man hat schon von Personen in gleichartigen Fällen gehört, die nach Jahren der Ruhe urplötzlich in die andere Persönlichkeit zurückfielen und wieder gewalttätig wurden. Diese Unsicherheit wird Tobias sehr lange Zeit in Gewahrsam halten. Ich würde mich wegen des Restrisikos jedenfalls sehr schwer tun, ein Gutachten zu unterschreiben, auf dessen Basis er entlassen werden könnte. Letztendlich wäre es aber Dr. Frenzels Aufgabe, die Entlassungsfähigkeit festzustellen.«
Der Junge hatte also lebenslänglich. In Anbetracht der Grausamkeit seiner Tat und der Gefahr, die seine Person immer noch barg, hatte dies nach Fröhlichs Ansicht eine gewisse Rechtfertigung. Er erinnerte sich, daß Tobias seiner Schwester mit dem Messer brutal die Kehle durchgeschnitten und sie dabei mit einem Kissen am Schreien gehindert hatte. Sie war innerhalb kürzester Zeit erstickt. Das Kissen hatte auch verhindert, daß er mit Blut bespritzt wurde; an seiner Kleidung waren damals nur wenige Tropfen gefunden worden. Es war kein zufälliges Gemetzel gewesen, sondern er war bei seiner Tat planmäßig und mit Bedacht vorgegangen.
»Seine Eltern besuchen ihn nicht, sagte man mir. Haben Sie mal mit ihnen gesprochen?«
»Wiederholt.« Walkemeier wirkte etwas bedrückt. »Übrigens haben das auch Frenzel und Morgenstern getan. Abgesehen von der menschlichen Seite wäre ein solcher Besuch auch therapeutisch von großem Nutzen. Sie weigern sich aber beide, ihn zu sehen. Die Mutter beschrieb mir einmal den Moment, als sie, wenige Stunden nach der Tat, einen Blutstropfen am Schlafanzug ihres Sohnes fand. Bis dahin war er unverdächtig gewesen - Frenzel machte seine belastende Aussage erst später. Keiner brachte ihn mit dem Mord in Verbindung. Können Sie sich die Situation vorstellen? Im einen Moment noch der Sohn, der den Schmerz um die tote Tochter teilt, im nächsten Augenblick das Monster, das sie abgeschlachtet hat. Der Vater hatte die Leiche der Kleinen damals gefunden, der Anblick hat ihn um Jahre älter gemacht. Die beiden haben keinen Sohn mehr.«
Konnte das die intensive Beziehung zwischen Tobias und Frenzel erklären? Tobias war quasi ohne Eltern, Frenzel als Bezugspersonhatte deren Stelle eingenommen. Auf dem Foto hatte aber noch etwas anderes im Blick des Jungen gelegen, etwas, das sehr schwer zu benennen war und nichts mit einer normalen Vater-Sohn-Beziehung zu tun hatte.
Es war später geworden, als Fröhlich geplant hatte. Er bedankte sich bei Walkemeier. Tatsächlich hatte ihm dieser mit seiner offenen und sympathischen Art sehr geholfen. Sie standen auf und schüttelten sich die Hände.
»Es kann sein, daß ich in den nächsten Tagen nochmals auf Sie zukommen werde«, bereitete Fröhlich seinen Gesprächspartner vor.
»Wann immer Sie wollen«, antwortete der Professor. »Und lassen Sie sich nicht von Frau Grumbach abwimmeln. Sie ist eine harte Nuß, hat aber einen Kern aus Nougat.« Offenbar wußte er um die Wirkung, die seine Sekretärin auf Besucher hatte.
Fröhlich schlenderte den Gang vor Walkemeiers Büro hinunter und nahm den Lift in die darüberliegende Etage, wo die geschlossene Abteilung mit den pathologisch kriminellen Patienten lag.
Der zweite Stock unterschied sich etwas von den anderen Etagen. Die Wände waren hier nicht weiß, sondern farbig. Wahrscheinlich aus therapeutischen Gründen, mutmaßte Fröhlich und hatte recht damit.
Direkt neben der Fahrstuhltür gab es eine Rezeption, an der ein Pfleger saß. Er sah ebenso stabil aus wie die Tür hinter ihm, die den Zugang zur eigentlichen Station bildete. Links und rechts neben der Tür standen zwei weiße Säulen von etwa zwei Metern Höhe. Fröhlich identifizierte sie als hochempfindliche Metalldetektoren der neuesten Generation. Vor sich, unter dem Tresen, hatte der Pfleger zwei Monitore, die ihm Einblick in die Räume hinter der Tür gestatteten. Der Tresen mochte noch weitere Sicherheitsvorrichtungen verbergen.
Der Mann machte den Eindruck, als sei sein zweiter Vorname Vorsicht und sein dritter Mißtrauen. Sein erster war Jannis, wie dem Namensschild auf seiner Brust zu entnehmen war.
Fröhlich zeigte ihm seinen Dienstausweis und erklärte sein Hiersein. »Ich würde mich gern etwas auf der Station umschauen. Und mich mit Tobias Kronburger unterhalten.«
»Ich lasse Sie hinein. Fragen Sie nach Schwester Barbara, die hat den Überblick. Haben Sie Metallgegenstände bei sich? Die hat unser Detektor nicht so gern.«
Der Polizist gab Schlüsselbund, Geldbeutel, Kugelschreiber und Dienstpistole ab. Jannis trug ihn namentlich mit Uhrzeit in eine Liste ein und drückte dann auf einen Knopf vor sich. Das leise Summen des Türöffners war zu hören. Fröhlich drückte sich durch die Tür.
Dahinter lagen etwa fünf Meter Flur, überwacht von einer Kamera, dann wieder eine stabile, geschlossene Tür. Auch hier summte der Öffner. Fröhlich winkte Jannis über Video kurz zu und trat aus der Schleuse in die Station.
Die nüchterne Krankenhausatmosphäre verlor sich hier völlig. Die Wände waren in Ockertönen gestrichen, die Türen in einem warmen Grün, kleine, bunte Reproduktionen moderner Maler lockerten das Bild auf. Er ging an einem Aufenthaltsraum mit Fernseher und Flipper vorbei, der mit bunten Postern wie tapeziert war. Zwei Mädchen, etwa dreizehn Jahre alt, saßen hier und sahen fern.
Geradeaus, am Ende des Ganges in etwa dreißig Metern Entfernung, sah er die offene Tür eines Zimmers, das er für den Aufenthaltsraum des Personals hielt. Er marschierte darauf zu. Auf seinem Weg hatte er Gelegenheit, einige der Räume zu sehen, die von den Patienten bewohnt wurden. Abgesehen von der überall vorhandenen Standardmöblierung hatte man ihnen anscheinend gestattet, sich ihre Zimmer selbst einzurichten, so daß jedes etwas anders aussah.
Bei aller Unterschiedlichkeit gab es jedoch viele Gemeinsamkeiten. Der Wandschmuck bestand überwiegend aus Postern, wobei Rockgruppen und Sportmotive vorherrschten. Auch Radios oder kleine Stereoanlagen gehörten meist zur privaten Ausstattung.
Eines der Zimmer erschloß sich seinem Blick, weil gerade eine Schwester hineingegangen war und die Tür hinter sich offengelassen hatte. Es stach auf merkwürdige Weise so stark von den anderen ab, daß er es einfach genauer betrachten mußte. Er trat näher.
Als erstes fiel ihm auf, daß persönliche Gegenstände und Dekoration fehlten, so daß er zunächst dachte, der Raum stünde leer. Auf den zweiten Blick bemerkte man aber doch schwache Spuren der Person, die ihn bewohnte. Eine Flasche Wasser, halbleer, stand auf einem ansonsten kahlen Tisch, am Gestell des Bettes war ein Rosenkranz mit kleinen, schwarzen Kugeln aufgehängt. Auf dem Nachtschrank neben dem Bett stand ein Wecker und das gerahmte Bild eines etwa zwölfjährigen, hübschen Mädchens mit langen, blonden Haaren. Es stand auf einer gepflegten Rasenfläche vor einem großen Haus und lächelte freundlich in die Kamera. Der Raum war von klinischer Sauberkeit und wirkte fast steril. Er strahlte die Leere einer Theaterkulisse aus.
Die Schwester hatte das Fenster geöffnet und drehte sich gerade um. Als sie so plötzlich den Zuschauer im Türrahmen bemerkte, fuhr sie erschreckt zusammen.
Fröhlich lächelte sie beruhigend an. »Ich bin Hauptkommissar Fröhlich und untersuche den Mord an Dr. Morgenstern. Wissen Sie, wo Schwester Barbara ist?«
»Die haben Sie gerade gefunden«, antwortete die Frau, die sich schon wieder von ihrem Schrecken erholt hatte.
Sie war Mitte Zwanzig und auf unaufdringliche Art hübsch. Ihre rotblonden Haare reichten sehr lang den Rücken hinunter. Sie machte keinen so harten Eindruck wie Schwester Edith und ließ sicher öfter mal fünfe gerade sein. Diese Eigenschaft war ihr aber bei der Arbeit bestimmt nicht hinderlich, sondern machte ihr den Umgang mit den Patienten wahrscheinlich eher leichter.
Fröhlich trat in das Zimmer. »Ist das der Raum von Tobias Kronburger?« fragte er, einer plötzlichen Eingebung folgend.
»Woher wissen Sie das?«
»War nur so ein Gefühl. Was macht er, wenn er in seinem Zimmer ist? Ich sehe hier keine Bücher, kein Radio, keine Spiele, mit denen man sich beschäftigen kann.«
»Wenn er hier ist, schläft er, oder... er denkt nach. Meistens ist er aber draußen irgendwo.«
»Heißt ›draußen irgendwo‹ bei Dr. Frenzel?«
Barbara sah ihn abschätzend an. »Ja, das heißt es. Zumindest meistens.«
»Wundern Sie sich bitte nicht über meine Kenntnisse der Gegebenheiten hier. Ich habe schon mit einigen Ihrer Kollegen gesprochen.« Fröhlich lächelte sie wieder an, und sein sonst eher nachdenklich wirkendes Gesicht verwandelte sich in das eines kleinen Jungen. Sie lächelte zurück.
Er ging an ihr vorbei zum Fenster, das, wie alle Fenster der geschlossenen Abteilung, nach innen zu öffnen und mit dicken Gitterstäben gesichert war.
Über einen schmalen, asphaltierten Innenhof mit Basketballkorb und aufgemaltem Spielfeld hinweg sah er auf den südlichen Ostflügel des H-förmigen Grundrisses. Auch dort waren alle Fenster vergittert. Er war erstaunt: Von seinem Standort aus hatte er einen direkten Blick in das Mordzimmer und - einige Türen weiter - in Dr. Frenzels Büro, das ebenfalls im zweiten Stock lag. Das Schwesternzimmer, in dem er die Stationsschwester befragt hatte, mußte sich demnach auf der diesen Räumen gegenüberliegenden Seite des Flures befinden.
»Warum sind die Büros der Ärzte und das Schwesternzimmer so weit von der Station und den Patienten entfernt?«
Fröhlich beobachtete Frenzel im Fenster gegenüber, wie er, offensichtlich sehr aufgeregt, mit jemandem telefonierte. Der Doktor saß mit dem Rücken zu ihm und bemerkte ihn nicht. Dann fiel sein Blick wieder in Dr. Morgensterns Büro. Es schien greifbar nahe. War es möglich, daß... Ein Gedanke begann in seinem Hirn Gestalt anzunehmen, eine Idee, wie der Toten möglicherweise das Gift verabreicht worden war.
»Frau Morgenstern hielt es für richtig. Wenn sie an Schreibarbeiten saß, wollte sie absolut ungestört sein. Sie wollte auch, daß das Personal in den Pausen räumlich getrennt von der Station ist, um sich besser erholen zu können. Außerdem wurden, als die Station eingerichtet wurde, alle Zimmer für die Patienten gebraucht. Wir waren damals voll belegt.«
»Und wie ist die Belegung jetzt?«
»Einige Zimmer sind im Moment frei, zum Beispiel die beiden neben diesem hier. Es würde sich aber nicht lohnen, mit den Diensträumen umzuziehen - wer weiß, ob wir nicht bald wieder Neuzugänge kriegen.«
Das sah Fröhlich ein.
»Diese Station ist völlig von der Außenwelt abgeschottet. Wer kommt hier herein oder heraus?«
»Für das Personal gibt es natürlich unbegrenzten Zutritt. Alle, die hier arbeiten, wurden besonders dafür ausgebildet und einer strengen Sicherheitsüberprüfung unterzogen, bevor sie die Genehmigung bekommen haben. Der engere Kreis des Pflegepersonals hatte sogar Judounterricht!« Man sah ihr die Begeisterung darüber jetzt noch an. »Polizei darf natürlich auch herein, normalerweise nach Absprache mit den behandelnden Ärzten. Und natürlich - mit Erlaubnis der Vollzugsbehörden und der behandelnden Ärzte und unter zeitlicher Begrenzung - Verwandte und Freunde der Patienten.«
»Wie groß ist der ständige Personalstamm?«
»Neben Dr. Morgenstern und Dr. Frenzel noch vier Schwestern und sechs Pfleger. Zwei der Pfleger und eine der Schwestern kommen übrigens aus dem Strafvollzug und haben sich für die Aufgabe hier weiterbilden lassen. Montags bis freitags kommen zwei Lehrer. Wir können hier zwar keine Berufausbildungen wie im Strafvollzug bieten, aber die jungen Leute sollen wenigstens etwas Allgemeinbildung bekommen. Sie nehmen das übrigens meistens auch gut an und kommen besser voran als früher draußen.«
Was Wunder, dachte Fröhlich. Hier gab es viel weniger Ablenkung.
»Könnten Sie mir eine Liste mit allen Namen geben? Wir müssen natürlich jeden überprüfen«, bat er.
Die Schwester nickte. »Natürlich.«
»Wie ist denn der Tagesablauf? Gibt es einen Stundenplan?«
»Natürlich, wie in jedem Krankenhaus. Um halb sieben wird geweckt, sieben Uhr Frühstück. Danach, etwa ab acht, Schule. Um dreizehn Uhr Mittagessen, danach Gruppen- oder Einzeltherapie. Diejenigen Patienten, die keine Therapie haben, haben weiter Unterricht. Ab siebzehn Uhr Freizeit, ab zweiundzwanzig Uhr Bettruhe. Die erste Schicht des Pflegepersonals arbeitet von sechs bis vierzehn Uhr, die zweite von vierzehn bis zweiundzwanzig Uhr. Nachts ist das Personal auf zwei Personen reduziert.«
»Wie verbringen die Patienten ihre Freizeit?« wollte Fröhlich wissen.
»Die Interessen sind unterschiedlich. Lesen, Musik, Fernsehen im Aufenthaltsraum. Es gibt keine Fernseher in den Zimmern, die jungen Leute sollen sich begegnen und lernen, miteinander umzugehen. Einige treiben Sport unten im Hof. Ein Mädchen hat einen Hamster; was glauben Sie, wie schwierig es war, dafür eine Genehmigung zu kriegen. Wir brauchten fast ein Jahr, um alle Beteiligten vom therapeutischen Nutzen des Tieres zu überzeugen. Bei uns entscheidet übrigens nicht nur die Krankenhausverwaltung, das wäre noch einfach. Auch das Jugendamt will gefragt werden. Und die Staatsanwaltschaft. Bei aller Humanität darf doch das strafende Moment nicht vernachlässigt werden.«
Fröhlich konnte sich gut vorstellen, welche Kämpfe das Personal mit den Behörden auszufechten hatte und wie das die tägliche Arbeit beeinträchtigen konnte. Er hatte auch seine Erfahrungen mit der Bürokratie.
»Gab es hier irgend jemanden, der mal Streit mit Dr. Morgenstern hatte?«
Auf diese Frage war Schwester Barbara anscheinend vorbereitet. »Ich wüßte niemanden. Sie hatte eine sehr ruhige, beherrschte Art, die sie sich auch in Konfliktsituationen bewahrte, und ein großes Harmoniebedürfnis. Sie gab niemandem vom Personal das Gefühl, untergeordnet oder weniger wert zu sein, und für die Patienten war sie immer zu einem Gespräch bereit. Natürlich passieren auch bei uns ab und zu Pannen, die ein Eingreifen der Vorgesetzten erforderlich machen. Sie war aber immer gerecht und hat sich niemals gegenüber einem Mitarbeiter gehenlassen.«
»Haben Sie oder Ihre Kollegen hier in letzter Zeit irgendwelche Streitereien oder merkwürdige Zwischenfälle beobachtet? Ist irgend etwas passiert, was von der Routine abgewichen ist?«
Schwester Barbara überlegte. Einen Moment lang verdunkelte sich ihr freundliches Gesicht. Es schien, als kämpfe sie mit sich oder als sei sie sich in irgend etwas unsicher. Zögernd schüttelte sie den Kopf.
»Nichts, was... unnormal wäre.«
Es gab also doch etwas. »Okay. Was wurde denn beobachtet, was Sie noch als normal einstufen würden?«
»Na ja, Reibereien zwischen den Patienten oder dem Personal oder zwischen Personal und Patienten gibt es schon manchmal. Einige Konflikte sind dann halt etwas heftiger als andere.« Sie stockte.
Der Hauptkommissar verstand ihre Bedenken. »Erzählen Sie einfach frisch von der Leber. Ich glaube, ich kann Ihnen sagen, daß wir den Täter sowieso außerhalb des Klinikumfeldes vermuten; Sie denunzieren mit Ihrer Aussage also niemanden. Ich möchte nur ein rundes Bild von allem kriegen.«
Die kleine Notlüge schien die junge Frau zu beruhigen. »Vor ein paar Wochen gab es einen heftigen Wortwechsel zwischen Tobias Kronburger und Dr. Frenzel während der Therapie. Ich ging gerade an der Tür des Behandlungsraumes vorbei, bin auch nicht stehengeblieben. Ich konnte nicht hören, worum es ging, aber sie schrien sich an. Beide sind eigentlich nicht die Typen für laute Auseinandersetzungen, deshalb kam mir das komisch vor. Ich habe Dieter, das heißt Dr. Frenzel, gefragt, was vorgefallen sei. Er wollte aber nicht so recht mit der Sprache raus, war auch etwas aufgeregt und erzählte etwas von Nichternstnehmen der Therapie und Leuten, die seine Bemühungen sabotierten.«
Sie stockte. Bei der Nennung von Frenzels Vornamen war sie leicht rot geworden, Offenbar bestand zwischen Frenzel und Barbara zumindest ein freundschaftliches Verhältnis.
Fröhlich ignorierte das, um den Informationsfluß nicht zu unterbrechen. Er war sehr interessiert.
»Gab es sonst noch etwas?«
»Ein paar Tage nach diesem Streit gab es eine Auseinandersetzung zwischen Dr. Frenzel und einer anderen Patientin, bei der es auch sehr laut zuging. Ich war nicht dabei, aber Herr Plichtner, einer unserer Pfleger, hat das beobachtet. Er hat nicht mitbekommen, worum es ging, erzählte nur, daß beide völlig aus dem Häuschen gewesen seien.«
»Wie heißt die andere Patientin?«
»Robby Anderson. Eigentlich Robinia, aber das will sie nicht hören.«
»Kann ich gut verstehen. Warum ist sie hier?«
»Sie hat zusammen mit zwei Freundinnen einen Dreijährigen entführt und fast zu Tode geprügelt, nur so zum Zeitvertreib.«
Sie sah, wie bei Fröhlich langsam die Klappe fiel, und sprach schnell weiter.
»Es war nicht ganz klar, inwieweit sie Drahtzieherin oder Mitläuferin gewesen ist. Die beiden anderen Täterinnen, beide älter als sie, sitzen in Jugendhaft. Bei Robby wurde eine Einweisung für zwei Jahre in die Psychiatrie angeordnet.«
Anscheinend war sich das Gericht in Robbys Fall wirklich nicht ganz sicher gewesen und hatte sich von der psychologischen Behandlung weiteren Aufschluß erhofft. Das war zwar nach Fröhlichs Meinung moralisch nicht ganz astrein, wurde aber manchmal so gehandhabt. Er nahm sich vor, sowohl mit Plichtner als auch mit Robby zu sprechen.
Für den Moment reichte es ihm. Er verabschiedete sich. An der Tür drehte er sich noch einmal um und musterte die Einrichtung.
»Warum, glauben Sie, richtet sich Tobias sein Zimmer nicht gemütlicher ein?«
»Dr. Frenzel hat dazu eine Theorie«, antwortete Schwester Barbara zögernd. »Er glaubt, der Junge habe das Verlangen nach einer härteren Strafe als der, die er vom Gericht erhalten hat. Deshalb bewohne er ein Zimmer, das wie eine Mönchszelle aussieht. Übrigens tut er sich auch bewußt weh, kratzt sich die Arme blutig und solche Sachen. Das gehört ebenfalls zu diesem Bedürfnis.«
Der Hauptkommissar nickte. »Das Bild da auf dem Nachtschrank, ist das seine Schwester?«
»Ja, das ist sie. Dr. Frenzel hat es ihm gegeben, nachdem er ihn darum gebeten hatte. Seine Eltern wissen nicht, daß er das Foto hat«, setzte sie nachdenklich hinzu.
Fröhlich fragte sich, warum sie das für wichtig genug hielt, um es zu erwähnen.
Beim Hinausgehen kam er wieder am Aufenthaltsraum der Patienten vorbei. Er war, wie der Rest der Station auch, jetzt leer. Dem Zeitplan zufolge, den Schwester Barbara ihm gegeben hatte, waren jetzt wohl alle beim Unterricht oder in der Therapie.
Fröhlich zögerte kurz und ging hinein.
Die Möbel waren relativ neu, funktionell, aber gemütlich. Auch vom Fenster dieses Zimmers aus konnte man den gegenüberliegenden Gebäudeflügel sehen. Neben Fernseher, Radio und sogar einem Flipper gab es ein kleines Bücherregal. Er trat näher und legte den Kopf schief, um die Titel lesen zu können.
Neben vielen alten Krimis fanden sich ein Lexikon, ein Wörterbuch Deutsch / Englisch, zwei pharmakologische Lehrbücher, eine Anatomie, zwei Versandhauskataloge, einige Sachbücher, meist medizinischen Inhaltes, und ein Stapel zerlesener Zeitschriften. Aus der wenig zielgerichteten Auswahl schloß Fröhlich, daß es sich um Bücherspenden handelte, vielleicht von Angestellten des Krankenhauses.
In einer Ecke stand eine Kiste mit Gesellschaftsspielen, obenauf ein Backgammonbrett. Alte Zeitschriften bedeckten den Tisch in der Zimmermitte, dazwischen lag ein Nähzeug, das wohl jemand dort vergessen hatte. An der Wand hing eine Pappzielscheibe, auf dem Boden davor lagen zwei Plastikpfeile mit Saugnäpfen an den Spitzen. Die dazugehörige Pistole lag in der Kiste. Fröhlich erinnerte sich, in seiner Kindheit ein ähnliches Spielzeug gehabt zu haben. Auch zu seiner Zeit waren die Pfeile nie auf dem glatten Untergrund der Zielscheibe haftengeblieben.
Sah eigentlich ganz wohnlich aus. Nachdenklich verließ er die Station. Er hatte immer noch Schwierigkeiten, die Denkweise des Krankenhauspersonals anzunehmen. Anscheinend sahen alle die Insassen der Station nur als Kranke an, denen geholfen werden mußte. Niemand schien sich Gedanken über die Dinge zu machen, die sie getan hatten, oder über die Opfer, die auf der Strecke geblieben waren.
Natürlich war diese professionelle Betrachtungsweise nötig, um psychisch kranken Straftätern unvoreingenommen gegenübertreten zu können und dadurch eine Therapie erst möglich zu machen. Für ihn jedoch, der aus einer anderen Ecke die Bühne betreten hatte, sah alles etwas anders aus. Fünfundzwanzig Jahre Umgang mit Verbrechen und Verbrechern hatten seine Ansichten geprägt. Oft war er Grenzfällen begegnet, bei denen sich die Unterschiede zwischen Gut und Böse verwischten, oder Tätern, die wirklich in eine Sache hineingeschlittert waren, ohne sich helfen zu können. Trotzdem war er der Ansicht geblieben, daß derjenige, der Unrecht getan hatte, dafür bestraft werden mußte, und zwar in einem Maße, daß er die Strafe auch merkte. Das garantierte zwar nicht die Besserung des Delinquenten, war aber wichtig für das Gerechtigkeitsempfinden der anderen Bürger im Lande.