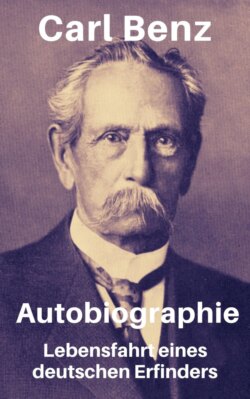Читать книгу Carl Benz - Autobiographie. Lebensfahrt eines deutschen Erfinders - Carl Benz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
AUF DEM GYMNASIUM
ОглавлениеRichtiger müßte es heißen: „Auf dem Lyzeum“. Denn das Gymnasium hieß damals noch Lyzeum. Es war in Karlsruhe hüben und drüben angebaut an die evangelische Stadtkirche. Wer kennt nicht Johann Peter Hebel? Er war nicht nur der große alemannische Mundartdichter, sondern – am Anfang des 19. Jahrhunderts – auch der Direktor des Karlsruher Lyzeums. In denselben Räumen, in denen seine Gedanken vor einem halben Jahrhundert flogen wie die Sturmvögel im Winde, sangen wir in allen Tonarten und Tonstärken: amo, amas, amat! Mit Freuden denke ich an meine Schulzeit zurück. Ich war kein schlechter Schüler. Nie ging ich der ernsten Arbeit aus dem Weg. Ich kannte mein ganzes Leben lang nur einen Kompaß, den der Pflicht. Das „Certieren“ machte mir besonderen Spaß. Das gab bei 80 Schülern Leben in die Bude. Denn in jeder Stunde waren die Schüler bei diesem „Streiten“ um die Plätze auf der Wanderschaft. Und die Wanderkommandos und ihre Ausführungen nahmen oft mehr Zeit in Anspruch als die eigentliche ernste Arbeit.
Unseren Primus Lacher von seinem Hochsitz zu verdrängen war eine Kunst, die auf die Dauer keinem glückte. Ein einziges Mal blühte mir diese kurzfristige Freude. Und das ging so zu: Eines Tages gab uns der Mathematiker ein mathematisches Problem im Kopf zu lösen auf. Da die Spitzenkandidaten die Lösung nicht so rasch parat hatten wie ich, kam ich richtig auf das Primusthrönchen. Wenn alle Stunden Mathematikstunden gewesen wären, so hätte ich vielleicht daran denken können, mich da oben als Großwürdenträger der Klasse häuslich einzurichten und niederzulassen. Aber nach der Mathematikstunde kam die Lateinstunde. Kaum war der antike Professor vor die Klasse getreten, so beehrte er mich mit folgender Ansprache: „Ei, Benz, der Erste geworden?“ „Ja, ja, in der Mathematik“, riefen sie alle durcheinander. „Du bist also ein guter Mathematiker? So sage mir doch einmal, wie heißt lateinisch: der 600000ste?“ Das war nun rascher gefragt als beantwortet. Aber Glück muß der Mensch haben. Und das Glück saß in Form eines Repetenten direkt hinter mir. Der übernahm die Rolle des Heiligen Geistes und telephonierte mir drahtlos seinen alten lateinischen Ladenhüter vor. Damit war die Primusehre noch einmal für einen Tag gerettet. –
Meine Lieblingsfächer waren Physik und Chemie. Das muß wohl auch der Grund gewesen sein, daß unser Physiklehrer mir eines schönen Tages den Ritterschlag zum „Assistenten“ gab. Freudig und gern opferte ich jeden Mittwoch den freien Nachmittag, um in der „Giftbude“ die Apparaturen und Experimente für die Physikstunde am Samstag von 11–12 Uhr vorzubereiten.
So machte ich von Klasse zu Klasse erfreuliche Fortschritte und sah immer tiefer und reifer hinein in die Schöpfungen einer antiken Welt. Wer aber Gelegenheit hatte, den Lyzeisten in seinen stillen Mußestunden zu beobachten, der merkte, daß der Lehrplan nicht allen Kräften gerecht wurde, die in ihm schlummerten. Er liebte die Sonne Homers. Aber er liebte heißer, als er es wußte, auch die Sonne der Gegenwart, unter der die Naturwissenschaften und die Technik so mächtig emporblühten.
Wieder nehme ich die alte Zauberlinse zur Hand und suche nach Erinnerungsbildern. Diesmal sehe ich nicht nur die Heldengestalt einer ringenden Mutter. Diesmal tritt noch einer in den Brennpunkt der Erinnerung, ein Junge mit großen fragenden Augen. Ein Bündel Bücher trägt er unter dem Arm. Soeben ist er „aus der Schule“ gekommen. Eilig hat er's, arg eilig. Nicht einmal Zeit zum Mittagessen nimmt er sich. Schon ist er seiner Mutter durchgebrannt. Er fliegt die Treppe hinauf so schnell, wie andere Menschenkinder sonst nur hinunterfliegen. Welcher verrückten Idee jagt er denn schon wieder nach?
Hier die Erklärung:
Was heute als Arbeitsschule, Werkunterricht, Schülerübungen, Laboratoriumsunterricht, als die neueste Errungenschaft unserer Pädagogik laut gepriesen wird, hat der junge Lyzeist damals schon praktisch durchgeführt, unabhängig von der Schule, einzig und allein aus dem instinktiv richtigen Gefühl des Forschens und Erfindens heraus.
Er hatte ein Versuchsstübchen. Wenn er in dieses eintrat und die Türe hinter sich zumachte, dann dünkte er sich auf einmal ein Großer, ein ganz Großer. Nur auf sich gestellt zu forschen und zu denken, zu beobachten und zu suchen, mit eigenen Augen schauen und mit eigenen Händen schaffen lernen, hei, war das fein! Wie machte ihn das glücklich und stolz zugleich! Der ganze Zauber des Forscherglücks umfing ihn und hielt ihn mit warmen Händen fest. Sieh! Da sind noch alle die Glas- und Probierröhren, die Kochkolben und Drahtnetze, die Spirituslampe und die Chemikalien, mit denen der junge Chemiker arbeitete. Sieh, da hängt noch seine farbige Mütze an der Wand, mit eigenartigen Flecken geziert. Diese chemischen Kainszeichen erhielt die Mütze anläßlich der Darstellung von Wasserstoff. Zu früh angezündet, explodierte der Wasserstoff bzw. das Knallgas mit großer Heftigkeit, so daß die Salzsäure hinausgespritzt wurde bis zur Mütze an der Wand. Diese braunen Säureflecke trugen dem „Alchimisten“ anderen Tages bei den Schulkameraden wenig Ehre ein. „Ho, der Benz, der Benz“, hohnlachten sie, „hat's Pulver zum zweitenmal erfinden wollen.“ –
Alle die Laboratoriumsdinge, vom Reagenzgläschen angefangen bis zu den guten teuren Linsen, mit denen ich allerlei optische Instrumente und Apparate herstellen konnte, kosteten natürlich Geld, für unsere damaligen Verhältnisse sehr viel Geld. Es gibt wohl wenig Mütter, die unter gleichen Voraussetzungen ein gleiches Entgegenkommen gezeigt hätten. Daher wird der Leser verstehen, warum ich meine Linsen noch als alter Mann dankbar hüte wie einen Nibelungenhort. Sie sind eben nicht nur die ältesten Zeugen meines ersten selbständigen produktiven Schaffens; sie sind mehr noch: liebe Andenken an eine brave Mutter, die mit freundlichem Verstehen und hochherziger Opferwilligkeit auf die Budgetwünsche ihres vorwärtsdrängenden Naturforschers einging.
Alle die physikalisch-chemischen Versuche, die ich machte, zu beschreiben, würde viel zu weit führen. Nicht das angelernte Buchwissen war für mich das höchste Ziel, sondern das selbsterarbeitete Erfahrungswissen. Im praktischen Ringen mit Problemen erblicke ich heute noch den größten Erziehungswert der Naturwissenschaften. Wie sehr nämlich das produktive Schaffen eine Quelle der persönlichen Initiative und der Unternehmungslust werden kann, dafür nur zwei Beispiele.
Ich hatte eine Camera obscura. Mit der rückte ich zunächst den Naturobjekten und Naturvorgängen photographierend auf den Leib. Ost zog ich in den Ferien mit meiner Kamera hinaus und hinauf in die Heimat meiner Väter, wo die hohen Schwarzwaldtannen rauschen, und machte Aufnahmen mit dem Eifer des Berufsphotographen. Wald und Fels, Baum und Busch, Haus und Hof brachte der Karlsruher Kamerajäger zur Strecke.
Bald aber ging ich auch auf Menschen los. Es machte mir das allergrößte Vergnügen, wenn sich die Schwarzwaldbauern von mir photographieren ließen – gegen Bezahlung. Viele meiner „Studienköpfe“ kann ich heute noch vorzeigen; sie sind bei dem damaligen umständlichen Herstellungsverfahren gar keine so üblen Proben meiner jungen Kunst. Will man einen gerechten Maßstab an diese Kunst legen, so muß man sich daran erinnern, daß damals die Photographie noch in den Windeln lag und man die nötigen Hilfsmittel nicht fix und fertig kaufen konnte, sondern sie selbst herstellen mußte. Amateurphotographen hat die Welt infolgedessen noch keine gekannt.
Leider habe ich die Leute gelegentlich auch von der unvorteilhaften Seite aufgenommen. Hatte beispielsweise einer einen Kropf, so wette ich 1000 gegen 1: Der Kropf kam auf die Platte. Die Photographierten haben meines Wissens nie Anstand genommen an ihren naturgetreuen Bildern. Kritiker aber, denen ich viele Jahrzehnte später meine Bildermappe zeigte, erblickten in dem kleinen Photographen einen großen Schalk. Daß ich jedoch absichtlich aus nichtsnutziger Schelmerei schlechte Witze auf der Platte fixieren wollte, daran konnte und kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern.
Als Photograph also verdiente ich in meinem Leben die ersten Groschen. Als Photograph und als – Uhrmacher. Was für eine Uhr auch immer müde war und krank – ich half ihr sicher wieder auf die Beine.
Woher die Liebe zu den Uhren kam, kann ich nicht sagen. Sie muß im Blute stecken. Da ich die Schwarzwalduhren mit den gemalten Zifferblättern am meisten liebe, ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß eine meiner Urgroßmütter von einem Schwarzwälder Uhrenmacher abstammte. Auch in den Adern meines Vaters kreiste schon ein Schuß Uhrenmachersblut von den Ahnen her. Sonst hätte er mir nicht bei seinem Tode fünf Taschenuhren hinterlassen. Fünf Taschenuhren! Das ist ein Erbgut, welches für einen wißbegierigen jungen Bastler mehr Verlockendes hat als ein ganzes Rittergut. An diesen Taschenuhren lernte ich die wundervolle Sprache, die ineinandergreifende Zahnräder miteinander reden. Nur schade, daß über meinen Sprachstudien die eine oder andere Taschenuhr die Sprache ganz verlor und ihr Ticken verstummte. Für meine Uhrenliebe gilt das Wort: „Alte Liebe rostet nicht.“ Denn auch in meinem späteren Leben verehrte ich die Zeitenkünder so sehr, daß in jedem Zimmer meines Hauses mindestens eine Uhr ticken mußte. Damit sie alle peinlich genau ihres Amtes walten konnten, ging ich jahrelang – wie von einer magnetischen Kraft getrieben – alle paar Wochen zum Hauptbahnhof, um „die Normalzeit zu holen“. Selbst das unzweideutige Lächeln meiner Frau über das „ewige Zeitholen“ war gegenüber meiner einseitigen Liebhaberei ohnmächtig.
Doch ich eile meiner Zeit voraus. Vorerst sind wir ja noch bei dem Lyzeisten, der als Uhrmacher durch den Schwarzwald zog und mit seiner Kunst manchem Bekannten eine Gefälligkeit erweisen konnte.
Die Bauern wunderten sich über den „gschickten Gschtudierten“ aus der Residenz. Aber niemand – weder die Fachlehrer des Lyzeums noch die treuen Kunden droben im Schwarzwald – ahnten, was aus diesem experimentierenden, photographierenden und uhrenmachenden Scholaren noch werden sollte.
„Frisch blickt' auch ich als junger Bursch ins Leben,
Keck hatt' ich mir gesteckt das höchste Ziel.“
Endlich gab die Mutter meinem stürmischen Drängen nach. Ich durfte im 17. Lebensjahre das Gymnasium vertauschen mit der Technischen Hochschule. Die hieß damals noch Polytechnikum.
Und nun tat sich hell und licht eine neue Welt vor mir auf, die Welt meiner stillen Jugendhoffnungen und Jugendträume. Es war eine Welt des Frühlings! Herrgott! War das ein Treiben und Sprossen, ein Drängen und Wachsen, ein Blühen und Reisen! Über allem aber stand brennend die Sonne der Begeisterung für das ersehnte Studium. Da wurde entworfen, konstruiert, differentiiert und integriert, daß es eine Freude war.
Am 16. April 1863 starb Professor Ferdinand Redtenbacher, der Begründer des theoretischen Maschinenbaus. Studenten begleiteten ihn hinaus zur letzten Ruhestätte. Ich erinnere mich daran noch genau. Denn zu den Studenten, die den Sarg des verehrten Lehrers trugen, gehörte auch ich.
Redtenbacher war nicht nur ein ausgezeichneter Gelehrter und ein berühmter Schriftsteller, er war vor allen Dingen auch ein gottbegnadeter Lehrer. In seinen Vorlesungen hörte man gleichsam die Maschinen laufen. Als besäße er die Kunst, seiner Mechanik dramatisches Leben einzuhauchen, so begeistert und begeisternd unterrichtete er. Kein Wunder, daß er anzog wie ein Magnetpol. Unter seinen Zuhörern saßen nicht nur junge Leute aus allen Teilen Deutschlands. Auch aus Schweden, Österreich, England und Amerika waren sie gekommen, um den großen Meister zu hören. Heute, wo neben die Kulturmacht der Dampfmaschine die Kulturmacht des Motors getreten ist, ist es besonders reizvoll zu sehen, wie Redtenbacher, überzeugt von der Notwendigkeit eines Ersatzes unserer Dampfmaschine, tastend hinausgreift in die Zukunft. Noch schwebt ihm allerdings nichts Konkretes vor, die „Kapitalerfindung“ muß erst kommen. Er schreibt (25. Dezember 1856): „Übrigens muß ich Ihnen gestehen, daß mich diese Steuerungsgeschichten der Dampfmaschinen und die ganze Maschine selbst schon seit langer Zeit nicht mehr interessiert. Auf ein paar Prozent Brennstoff mehr oder weniger kommt es nicht an, und mehr kann man durch derlei Tüfteleien nicht mehr gewinnen. Ich halte es von nun an für lohnender, sich über die Wärme den Kopf zu zerbrechen und unseren jetzigen Dampfmaschinen den Garaus zu machen, und das wird hoffentlich in nicht gar zu ferner Zeit geschehen, indem das Wesen und die Wirkungen der Wärme allmählich zur Klarheit kommen. Die Kapitalerfindung muß freilich erst noch gemacht werden, damit diese kalorischen Maschinen mit Luft oder mit überhitztem Dampf, mit oder ohne Regenerator das zu leisten vermögen, was man sich versprechen darf, und damit namentlich diese Maschinen ein mäßiges Volumen erhalten; aber das alles wird sich wohl finden, wenn man einmal über das innere Wesen der Sache ganz ins reine gekommen ist.“
So sehr ich Redtenbachers Verlust beklagte, in Franz Grashof bekam Redtenbacher einen Nachfolger, der die praktischen Aufgaben der Technik mit der Überlegenheit des mathematischen, streng wissenschaftlichen Meisters zu lösen verstand. Und doch konnte Grashof Redtenbacher nicht in allen Stücken ersetzen. Redtenbachers Stärke lag auf der konstruktiv praktischen Seite des Maschinenbaus. Grashof dagegen war ganz Theoretiker. Seine Lehrweise war klar und exakt, so wohl überlegt jeder Satz und jedes Wort, daß – was er sagte – ohne weitere Überarbeitung „druckfertig“ gewesen wäre. Aber da er fast keine Zeichnungen zu Hilfe nahm und zur Veranschaulichung höchstens einmal ein paar Striche machte, war der Unterricht für die Durchschnittsbegabung seiner Zuhörer zu abstrakt. Nur die Begabteren, die zugleich die nötige grundlegende Bildung hatten, konnten Grashof auf die Höhen seines streng wissenschaftlichen Entwicklungsganges folgen und hatten reichen Gewinn. Welch hohe fachwissenschaftliche Anforderungen er an den Techniker stellte, der den Aufgaben der Gegenwart und zugleich jenen der Zukunft gewachsen sein soll, geht aus seinen eigenen Worten am besten hervor:
„Die Schule darf nicht im Schlepptau des praktischen Bedürfnisses, sondern soll diesem möglichst voraus sein. Die von der Schule gewährte wissenschaftliche Ausbildung soll nicht nur den Anforderungen der Technik in ihrer augenblicklichen Entwicklungsphase, sondern möglichst bis zu dem Zeitpunkt genügen, in welchem der von ihr gebildete Techniker nach einem Menschenalter von der Bühne seiner Tätigkeit abtreten wird.“
Mir hat sie genügt. – Mit Dankbarkeit und Verehrung schaue ich daher immer noch zurück auf die zwei ausgezeichneten Lehrer, die dem jungen Studenten einst den wissenschaftlichen Bergstock in die Hand drückten.
Was ich im Gymnasialbetrieb als Mangel empfand und aus eigener Initiative und aus eigenen Mitteln ergänzend hinzufügte, hier, am Polytechnikum war es: das Laboratorium, die Werkstätte.
Ein Werkmeister von altem Schrot und Korn stand der Werkstätte vor. Die Bekanntschaft mit Homer und Cicero hinderte den stud. ing. Benz nicht, an dem einfachen Manne der Handarbeit und Handfertigkeit mit Verehrung emporzuschauen. „Mehr Achtung vor der Hände Werk, vor dem Handwerk“ ist immer meine Losung gewesen. Und so waren denn die beiden, der Meister und sein Jünger, gar bald die besten Freunde. Von Didaktik und Heuristik verstand der neue Lehrmeister nichts. Aber das lohende Feuer der Berufsfreudigkeit verstand er in seinem Schüler so aufzuschüren, daß die Flammen der Begeisterung zu allen Fenstern seiner Seele herausschlugen. Daher finden wir diesen auch außerhalb der vorgeschriebenen Unterrichtszeit in der Werkstätte, viele Stunden lang bastelnd und schaffend. Und der wackere Meister konnte nicht müde werden, immer und immer wieder Anregungen und Impulse zu geben zu neuem Gestalten und Schaffen.
So ist dieser praktische Werkstattunterricht nicht nur eine fruchtbare Ergänzung zum theoretischen Unterricht gewesen, sondern zugleich auch ein wertvoller Ersatz für das eine Jahr Fabrikpraxis, das dem fachwissenschaftlichen Stus diengang des heutigen Ingenieurs vorauszugehen pflegt. Und doch gab ich mich keineswegs damit zufrieden.
„Keck hatt' ich mir gesetzt das höchste Ziel!“ Ein Fahrzeug wie das des Vaters sollte es werden, ohne Pferde – aber auch ohne Schienen. Ein selbstfahrendes Straßenfahrzeug!
Ich fühlte, daß ich tiefer schürfen und tiefer graben müsse, um auf die Schichte zu kommen, die für meine Zukunftspläne und Zukunftshoffnungen Mutterboden werden konnte. So kamen nach vier Jahren akademischem Studium die Wanderjahre.