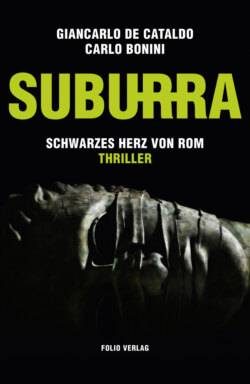Читать книгу Suburra - Carlo Bonini - Страница 9
ОглавлениеVII.
– Ich bin Teresas Freundin.
– Ach, Teresa, Teresa, bist es du, Teresa? Kommen Sie, setzen Sie sich, bleiben Sie nicht an der Tür stehen. Sie sind …
– Justine.
– Die Justine des Göttlichen Marquis oder das kleine jüdische Mädel aus dem Alexandria-Quartett? Ach, ist ja egal. Kommen Sie, kommen Sie, meine Liebe.
Der Professor war seinerzeit berühmt gewesen, sehr berühmt. So berühmt, dass sogar Sabrina von ihm gehört hatte. Ausgerechnet ein paar Tage vor ihrem Treffen hatte sie auf Sky einen alten Film gesehen, der nach der Vorlage eines seiner Bestseller gedreht worden war. Der Professor spielte darin sich selbst. Einen zerstreuten Intellektuellen, halb Philosoph und halb Komiker, der das Publikum zum Lachen brachte ob des Elends und der Widersprüche des Lebens.
Wie alt er doch geworden ist!, dachte Sabrina, als er sie in seiner großen Wohnung an der Nomentana empfing. Der graumelierte Fünfzigjährige mit den tiefliegenden blauen Augen hatte sich in einen gebeugten Tattergreis verwandelt, der sich bei jedem zweiten Schritt auf ein Möbelstück stützen musste, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Von den Wänden blinzelten spöttisch die gerahmten Bilder, auf denen der Professor auf dem Höhepunkt seines Erfolgs zu sehen war. Sie folgte ihm über einen Gang, der in ein großes Wohnzimmer und dann auf eine riesige Terrasse führte, an den Wänden befanden sich merkwürdig geformte Regale mit säuberlich aufgereihten Büchern. Unverständliche Bilder und unheimliche Skulpturen.
– Pascali … Bacon … Tano Festa …
Der Professor sagte eine Reihe von Namen auf, die Sabrina nicht kannte. Er beschrieb seine Schätze in müdem, resigniertem, leicht spöttischem Tonfall. Als wollte er sagen: Was verschwende ich meine Zeit mir dir, du bis ja doch dumm wie Stroh.
– Warten Sie einen Augenblick auf mich, meine Liebe, ich mache mich fertig, dann komme ich gleich zu Ihnen. Ich nehme an, Teresa hat Ihnen gesagt, worum es sich handelt … Justine.
– Ich weiß alles, Professor, Sie können mir vertrauen.
– Vertrauen ist was Ernstes, dozierte der Professor, plötzlich mit finsterem Blick.
Dann erschien auf seinem runzeligen Gesicht plötzlich ein spitzbübisches Lächeln, und er begann zu trällern: „Galbani vuol dire fiduciaaaa, Galbani bedeutet Vertrauen …“
Teresa hatte sie gewarnt: „Er ist ein bisschen seltsam. Er lebt in der Vergangenheit. Er kommt nicht darüber hinweg, dass die Filmleute nichts mehr von ihm wissen wollen. Aber er ist wahnsinnig reich und auf seine Weise freundlich. Wenn du ihn richtig anpackst …“
Wahnsinnig reich. Nun, die Wohnung sah ja vielversprechend aus. Sabrina speicherte die Namen der Künstler, die der Professor genannt hatte, auf dem iPhone. Später würde sie im Internet ihren Marktwert recherchieren. Vielleicht war das Gekritzel ja Millionen Euro wert.
– Da bin ich, meine Liebe. Rufst du bitte ein Taxi?
– Haben Sie nicht etwas vergessen, Professor?
– Ach ja, doch, natürlich, meine Liebe, entschuldige, entschuldige vielmal … wir hatten achthundert vereinbart, nicht wahr?
– Ja, Professor.
– Onkel Mimmo, meine Liebe, für dich bin ich Onkel Mimmo.
Er war Onkel Mimmo, und sie war die Nichte aus der Provinz, die im dritten Jahr Wirtschaft an der Ostiense studierte, sie wohnte vorübergehend bei ihm, bis sie eine Studentenwohnung gefunden hatte. Deshalb trug sie eine keusche Bluse und Jeans, keine Markenjeans, eine rote Jacke mit einer nicht allzu auffälligen Brosche, dezente Schminke und flache Schuhe.
„Keine Schlitze und keine Highheels, kein Pushup, und verstecke deine Tattoos. Erinnere dich: du bist eine Linke.“ So Teresa.
Aber Teresa hatte übertrieben. Als sie die Dachbodenwohnung des Produzenten Eugenio Brown betraten, war der erste Eindruck gar nicht so schrecklich. Männliche Kommunisten in Sakko und Foulard. Einige trugen sogar Merrell-Sneaker und Leinensakkos von Etro. Kommunistinnen, die zwar züchtig gekleidet, aber aufreizend geschminkt waren, und Mädchen in Miniröcken, die sexy Unterwäsche sehen ließen und Stilettos trugen. Manche von ihnen hätte sich auch auf einer Party von Malgradis Freunden sehen lassen können, andere wiederum hätten dem Blick der Türsteher nicht standgehalten. Hätte sie sich angezogen wie immer, provokant und nuttenhaft, wie es ihr zur zweiten Haut geworden war, hätte sie wenigstens nicht den Eindruck erweckt, eine fade, unbedeutende Hure zu sein.
Die perfekte Nichte vom Land.
Der Professor stellte sie ein paar Leuten vor. Alle begrüßten sie höflich, aber kalt, und es gab auch spöttische Blicke. Jaja, die Nichte, sagten die Blicke. Schon recht, Herr Professor! Deine große Zeit ist vorbei, aber du gehörst noch immer zu uns, deshalb verzeihen wir dir deine kleinen Altersmarotten. Aber du hättest dir eine bessere Nichte aussuchen können.
Nach der ersten Begrüßungsrunde ließ sich der Professor auf einen Stuhl fallen, den „der arme Sottsass ’73 entworfen hat“ („Sossas, Stuhl ’73“ notierte Sabrina eifrig auf ihrem iPhone) und begann die üblichen Geschichten zu erzählen. Vier oder fünf arme Schweine hörten ihm zu, mit echter Begeisterung. Oder vielleicht taten sie auch nur so: aus Mitleid oder sonst einem Grund. Sabrina setzte sich neben Onkel Mimmo, lachte, wenn die anderen lachten, und ließ es geschehen, dass der Alte ihr zerstreut den Schenkel streichelte, wenn er sich unbeobachtet wähnte. Achthundert immerhin, aber diese Langeweile! Natürlich ging die Party woanders ab. Vielleicht auf der Terrasse, die auf die Piazza Vittorio blickte. Mitten auf dem Esquilin, wohin Sabrina freiwillig nie einen Fuß gesetzt hätte, denn hier wohnten die Einwanderer, die Arschlöcher. Der Professor und seine Freunde hielten das Viertel jedoch für „entzückend, und unwiderstehlich, so lebendig und vital, das wahre multikulturelle Rom …“
Wie bitte? Hier bekam man ja keinen einzigen Italiener zu Gesicht, nur Chinesen …
Schließlich verkündete der Professor, er müsse mal schnell auf die Toilette. Sabrina nützte die Gelegenheit und schlüpfte auf die Terrasse. Es war eine helle Nacht Ende Juni, aber sie hatte etwas anderes im Sinn. Der Professor war nur eine Fahrkarte in die Welt der Linken, aber lieber eine Ohrfeige als noch so ein fader Abend, also tu was, Sabrì.
Sie ging zwischen den Grüppchen herum, näherte sich den Tischen. Überall wurde geredet, geredet, geredet. Die Menschen redeten mit einer Leidenschaft und einer Hingabe, als hinge die Zukunft der Welt von ihnen ab.
– Wir müssen uns zu regionalen Produkten bekennen. Unbedingt.
– Ich gebe dir recht. Ich trinke nur noch Biowein. Keinen Schwefel mehr. Der ist ein Fluch. Hast du eine Ahnung, wieviel Dreck man heutzutage legal in eine Flasche Wein kippen kann? Bis zu achtzig verschiedene Stoffe, hast du das gewusst?
– Ich habe eine Katze adoptiert. Die Arme hat eine Woche lang vor meiner Tür miaut. Die Impfungen, der Tierarzt und die Kastration haben mich nur vierhundert Euro gekostet.
– Vierhundert Euro? Soviel hat auch Luisa dafür verlangt, dass sie meine Zimmerpalme ins Institut für Phytotherapie gebracht hat. Angeblich, um sie zu behandeln.
– Und, wie ist es gelaufen?
– Nach einem halben Jahr war sie tot.
Wohin hatte sie die Zimmerpalme gebracht, zu einer Masseurin? War sie krank?, dachte Sabrina.
Ein Glatzkopf, der aussah wie die Rausschmeißer bei Malgradis Partys, biss in ein Pfefferoni-Tarantallo, seufzte und sagte: – Ich lese gerade Roths Amerikanisches Idyll. Ein Meisterwerk.
– So was würdest du auch gerne schreiben, was?
– Ich würde zehn Jahre meines Lebens dafür geben.
– Und wer sollte es dir abkaufen?
– Garrone will offenbar einen Film über den Fotografen Corona drehen …
– Die Nachricht stammt von Findus, meine Liebe. Matteo wohnt unter uns. Er hat lange darüber nachgedacht, dann hat er es bleiben lassen.
– Umso besser. Offensichtlich ist Corona sogar ihm zuwider.
– Corona ist der Inbegriff des Fernsehens, des Bunga-bunga, des ganzen Scheißdrecks, des reinen Schreckens, und der Schrecken lässt sich nicht darstellen. Nicht einmal Fellini ist das seinerzeit gelungen.
– Das Schrecklichste ist, dass das Ganze offenbar nie zu Ende geht.
– Das ist auch unsere Schuld, meine Liebe. Wir sind zu sanftmütig. Wir leisten schon lange keine Opposition mehr.
Ein kleiner, fetter, bärtiger Mann hielt eine Predigt über Politik.
Sabrina hätte am liebsten gegähnt. Sie verging vor Langeweile.
Die Kommunistenarschlöcher redeten nur wirres Zeug, und selbst wenn sie etwas Verständliches sagten, taten sie es auf eine Weise … als ob ausschließlich sie es verstehen sollten. Der Rest der Welt konnte scheißen gehen! Außerdem machte keiner der Typen, zu denen sie hinging, Anstalten, sie einzubeziehen.
Teresa hatte sie ja gewarnt.
Teresa hatte in diesem Punkt keinen Zweifel gelassen
„Das ist ein geschlossener Zirkel. Lauter Genossen, wenn du mich verstehst. Es ist sehr schwierig, da reinzukommen. Ein falsches Wort und sie werfen dich raus!“
Genau diesen Eindruck hatte sie auch. Ein geschlossener Zirkel. Sabrina stellte fest, dass sie die vulgäre Ausgelassenheit von Malgradis Partys vermisste. Dort, in der viagrageschwängerten Atmosphäre, hatte sie sich nie fehl am Platz gefühlt. Die geilen Böcke waren freundlich, herzlich, beschützend. Sicher, bei der erstbesten Gelegenheit gaben sie einem den Laufpass und auf Wiedersehen. Aber immerhin war sie mit ihrer Hilfe das geworden, was sie jetzt war. Ohne sie fühlte sie sich verloren.
Aber was ist eigentlich aus dir geworden, Sabrí? Du hältst einem alten Tattergreis für achthundert Euro das Händchen!
Nervös kramte sie in ihrer Tasche. Sie lechzte nach einer Prise Koks, um den Stress und die Enttäuschung wegzustecken. Aber auch in dieser Angelegenheit hatte Teresa keinen Zweifel gelassen.
„Ja kein Koks. Sie sniefen zwar auch, aber der große Kreis ist geschlossen und der kleine undurchdringlich.“
Die Berühmten, dachte Sabrí, waren ordentliche Langeweiler.
– Gestatten?
Sabrina wollte ihren Augen nicht trauen. Jemand hatte von ihr Kenntnis genommen. Der hochgewachsene Eugenio Brown, der Hausherr, stand plötzlich vor ihr. In der Hand ein Feuerzeug mit brennender Flamme.
Ein gutaussehender Mann. Um die fünfzig, groß, graumeliert, im Armani-Anzug. Ein Produzent. Das Wort übte auf Sabrina eine eindeutige Faszination aus. Produzent bedeutete Kino. Vielleicht sogar Fernsehen. Warum nicht? Sie hatte eine gute Figur, und Skrupel hatte sie nie besessen. Warum nicht? Sie war bestimmt nicht die Erste, die auf der Besetzungscouch landete. Warum nicht?
Eugenio Brown. Wenn man sich verkaufen musste, dann wenigstens an einen, der ein Minimum an Attraktivität besaß.
– Danke, ich konnte mein Feuerzeug nicht finden.
– Langweilen Sie sich?
– Nein, allerdings …
– Meine Freunde können manchmal widerwärtig sein.
– Nein … ich kenne bloß niemanden.
– Ich verstehe. Am Anfang ist es immer schwierig.
Sabrina setzte ihr verführerischstes Lächeln auf. Eugenio Brown legte ihr eine Hand auf den Arm.
– Gefällt Ihnen die Wohnung?
– Ein Schmuckkästchen.
Eugenio Brown lächelte sie an. Das war das erste Mal, dass jemand die zweihundertneunzig Quadratmeter große Dachwohnung als „Schmuckkästchen“ bezeichnet hatte. Er sah sie mit vermehrtem Interesse an.
Er war auf jeden Fall ein gutaussehender Mann.
Sie spürte, dass er sie begehrte.
Aber er konnte sich nicht überwinden, den ersten Schritt zu tun.
Sabrina verspürte eine leise Ungeduld. Sie legte ihre Hand auf die seine. Sie lächelte noch verführerischer.
Eugenio Brown öffnete den Mund.
Ein behaartes Individuum im Karohemd packte ihn am Arm und zwang ihn sich umzudrehen.
– Entschuldigt. Eugenio, die Baldini sucht dich.
– Ja, ich komme gleich, bis später, Signorina …
– Justine.
– Ach ja, Justine.
Der Produzent verschwand, eilte zu einem Tisch hinter einer dichten Bananenstaude.
Das Karohemd zündete sich eine Toscano an. Sabrina hätte den Trottel am liebsten bei lebendigem Leib verspeist. Er hatte ihr die schönste Beute weggeschnappt. Sie drehte sich um, um zum Professor zurückzugehen, doch das Karohemd versperrte ihr den Weg. Das Arschloch grinste.
– Schenken Sie mir eine Sekunde Gehör, Signorina Justine? Oder sollte ich lieber … Lara sagen?
Sabrina blickte sich um. Offensichtlich achtete niemand auf sie. Sie hob die Hand, als wolle sie dem sanften Gesicht eine Ohrfeige versetzen. Am liebsten hätte sie ihn gekratzt, dem Arschloch ein Mal verpasst. Sie hatte sowieso verloren. Aber er nahm ihre Hand, führte sie an den Mund und drückte einen flüchtigen, feuchten Kuss darauf.
– Keine Angst. Ich bin nicht gefährlich. Mir gefallen Männer. Komm, trinken wir was, ich muss mit dir reden.
Der Typ hatte eine merkwürdige, entwaffnende Sanftheit. Sie folgte ihm gehorsam zu dem Tisch, auf dem die Spirituosen standen. Karohemd goss zwei Whiskys ein und lotste sie in einen leeren Winkel der Terrasse.
Er hieß Fabio und war Drehbuchautor. Er war gay, wie die Linken die Schwulen nannten, und hatte sie erkannt, obwohl sie kurze, gefärbte Haare hatte.
– Entschuldige, aber wie hast du mich erkannt?
– Von der Website. Du warst doch die von www.larasecrets.com, nicht wahr?
– Entschuldige, aber du bist doch schw…, ich meine gay, woher …
– Ach, im Grunde bin ich nach allen Richtungen offen.
– Das heißt?
– Mir macht alles Spaß, was mit Sex zu tun hat.
– Na und?
– Ich wollte mit dir über Eugenio Brown sprechen.
– Was, er auch?
– Nein, Eugenio mag Frauen.
Sabrina seufzte erleichtert. Sein Stil gefiel ihr jedenfalls. Für Malgradi gab es keine Frauen, nur Fotzen.
– Na und?
– Er ist seit kurzem Witwer, fuhr Fabio fort. Sie ist nach langer Krankheit gestorben. Sie haben sich sehr geliebt. Eugenio ist einer der wenigen Produzenten, die noch an das Qualitätsprodukt glauben.
– Ja, aber was hat das mit mir zu tun?
– Er ist ein gutaussehender Mann. Und sehr verletzlich. Tu ihm nicht weh. Das ist alles.
Der bärtige Drehbuchautor zog sich mit einem Lächeln zurück, das freundschaftlich sein wollte, aber auch sagte: ich habe dich als Freund gewarnt, ich könnte aber auch ein unerbittlicher Feind werden. Du machst mir aber große Angst, du Orang-Utan! Sabrina leerte den Whisky und spürte plötzlich eine gewisse Aufregung. Verletzlich. Verletzliche Männer bargen manchmal große Überraschungen. Verletzliche Männer verliebten sich. Verletzliche Männer wurden schnell von Kunden zu Liebhabern.
Eugenio Brown kam auf sie zu.
Aber jetzt war Sabrina nicht mehr ungeduldig. Sie wusste, dass sie ihn bald in der Hand haben würde. Jetzt hieß es, sich ein wenig zu zieren.
Sie lief in die Wohnung. Sie entdeckte einen Notizblock und einen Kugelschreiber, riss ein Blatt ab, schrieb ihre Handynummer darauf. Dann, als sie sicher war, dass niemand sie beobachtete, nahm sie die Wohnung in Augenschein, bis sie, in der Mansarde, am oberen Ende einer Wendeltreppe, das Schlafzimmer des Hausherrn entdeckte.
Sie legte den Zettel gut sichtbar auf die Bettdecke mit indischem Muster und ging wieder nach unten.
Der Professor war eingeschlafen. Speichel tropfte auf sein Halstuch. Sabrina rüttelte ihn sanft wach, rief ein Taxi, fuhr mit ihm nach Hause und legte ihn ins Bett, ganz brave Nichte. Das war Teil der Abmachung. Als einziges Extra gestattete sie ihm einen kurzen Griff auf den Busen. Dankbar legte der Professor noch einen Zweihundert-Schein drauf.
Jetzt hieß es warten.
Sie musste nicht lange warten.
Eugenio Brown rief sie am Morgen darauf an.
VIII.
Anagnina hatte den süßlichen und unverwechselbaren Geruch jener Orte, wo der Gestank der Menschen und des Betons noch nicht den des offenen Landes übertönte. Abbas kam sich beinahe vor wie einst in Teheran. Sicher, die Castelli, die man von der Via Mongrassano aus sah, waren nicht das Elbursgebirge, und der grüne Hügel, auf dem Frascati lag, war nicht so mächtig und düster wie Tochal. Aber die Luft war dieselbe. Vor allem jetzt im Sommer. Sie verklebte die Schleimhäute des Mundes wie Sand. Sie trocknete die Nasenlöcher aus. Sie kratzte im Hals und ließ einen Geschmack von Kohlenmonoxyd und Teer zurück, ein Rest des Gestanks von Fäulnis und Müll.
Sein Laden befand sich an der Ecke zur Via del Casale Ferranti. Hinter der letzten Haltestelle der U-Bahn-Linie A. Wo die Schafherden Wohnblocks hatten weichen müssen. Die Bruchbude war wohl mal eine Garage gewesen, aber der Kredithai, der sie ihm verkauft hatte, hatte geschworen, sie sei als „Werkstätte“ ins Grundbuch eingetragen. Abbas hatte sie notdürftig eingerichtet. Er hatte die Wände mit Karton und Zeitungen tapeziert, um Feuchtigkeit und Schimmel abzuhalten. Sein Arbeitstisch war eine alte Fleischertheke, die auf verrosteten Böcken stand. Kirschholz-, Eichen- und Ebenholzplatten lagen auf Marmorblöcken herum, in fröhlichem Durcheinander, sie waren das Material für das Handwerk, das er von seinem Vater und seinem Großvater ererbt hatte. Seitdem er ein Kind war, machte er Intarsien, und seine Pianistenhände mit den langen dünnen Fingern erinnerten ihn Tag für Tag daran, was für ein Glück er hatte. Selbst jetzt noch, obwohl er mit seinen sechzig Jahren Hammer und Meißel nicht mehr so fest halten konnte und seine braune Haut so dünn wie Seidenpapier geworden war und man darunter Adern und Sehnen sah.
Er hatte nie begriffen, was seine Kunden mehr schätzten, seine Fähigkeiten oder den Preis, um den er sie verkaufte. Seine Entwürfe interessierten niemanden. Er hatte sie nur Rocco Anacleti gezeigt, der in der Romanina wohnte und den alle im Viertel mit Ehrfurcht grüßten, wie es sich für einen Tyrannen gehörte, doch die Sache war schief gegangen. Mit einem gewissen Stolz hatte er ihm die auf Pergament gedruckten Entwürfe seines Großvaters gezeigt, die er in einem Lederalbum aufbewahrte.
– Was soll denn das sein?
– Persische Blumenmotive.
– Glaubst du vielleicht, ich würde mir das schwule Zeug ans Kopfende des Bettes hängen? Wir sind hier in Rom, nicht bei dir zu Hause. Ich brauche das Bett zum Ficken.
Sie hatten sich auf einen Satyr mit einem riesigen Reliefphallus geeinigt.
– Das Kopfende soll aus Wengèholz sein. Und es soll antik aussehen, hatte ihm Rocco befohlen.
Aber als er die fertige Arbeit sah, hatte er durchgedreht.
– Wofür hältst du mich, für einen Neger? Schau mich an! Was habe ich für eine Hautfarbe? Bin ich ein Neger? Mach das Scheißholz hell, sofort!
Abbas hatte von vorne anfangen müssen. Mit gebleichter Eiche. Ein Glücksspiel. Kein Wunder, bei der unfassbar obszönen Einlegearbeit. Tausend Euro. Er hatte sie noch nicht bekommen. Aber er hatte sie eingefordert. Zuerst freundlich, am Telefon. Dann sogar mit einem Brief an die Adresse von Rocco Anacleti, in dem er mit einem Haufen höflicher Anredeformeln in Großbuchstaben darauf hinwies, dass er sich, sofern er keine „freundliche Antwort erhielt“, an einen Rechtsanwalt der Gewerkschaft wenden würde.
Bei der Ampel am Ende der Tuscolana drückte Max mit einer ungeduldigen Geste den Schalthebel der Street Triple. Das Geräusch, wenn der erste Gang einrastete, verursachte ihm ein angenehmes Gefühl. Ein nervöses Signal, die Ankündigung dessen, was gleich passieren würde. Es war Nacht, aber unsäglich heiß. Der Wind der hundertachtzig PS ließ die Jeans an seinen Schenkeln kleben, das Stirnband am Innenhelm war schweißnass, seine Füße in den roten Sneakers brutzelten wie Toasts. Die Castelli tauchten auf. Max hasste die Castelli. Sie waren ihm immer wie ein provisorischer Deich auf einem Ameisenhaufen vorgekommen. Vor ein paar Tagen hatte Spartaco Liberati, the Voice of Rome, auf Radio Fm 922 darüber geklagt, dass es den Ponentino, den Westwind, nicht mehr gäbe. Ach, es gibt keinen Ponentino mehr, die neu errichteten Wohnviertel halten ihn ab … ach, die Castelli, der Ponentino … Schwachsinn für Reiseführer.
Um die Wahrheit zu sagen, fühlte er sich unbehaglich.
Rocco Anacleti hatte ihm gesagt, er müsse eine Sache mit einem Iraner bereinigen. Rocco Anacleti war nervös. Eigentlich hätte sich Spadino darum kümmern sollen, aber Spadino war verschwunden. Rocco war nervös und faselte merkwürdiges Zeug daher.
Seine Aufgabe: Paja und Fieno Rückendeckung geben.
Die beiden gefielen ihm nicht. Der Job gefiel ihm nicht. Rocco Anacleti gefiel ihm nicht.
Er musste bald eine Entscheidung treffen.
Der „Spitz“ befand sich gegenüber dem Centro sperimentale di cinematografia. Gleich hinter den viereckigen Blöcken aus Glas und Zement, in die das Innenministerium die Generaldirektion der Spezialeinheit zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Verbrechensprävention und der Verkehrspolizei verlegt hatte. Max fuhr in der zweiten, bis der Motor aufheulte, und als er an dem großen elektrischen Gittertor vorbeifuhr, über dem das Schild des Ministeriums hing, hupte er. Wie immer genoss er den Anblick: Ein Haufen Bullen in einem Viertel, in dem alles drüber und drunter ging.
Er erkannte das schwarze BMW-Cabrio, das an der Kreuzung zur Via delle Capannelle parkte. Pajas blonder Pferdeschwanz und Fienos im Nacken ausrasierte Stoppelglatze. Zwei wütende Straßenköter, die keine fünfundzwanzig werden würden. Ein paar Jahre jünger als er. Zwei Arschlöcher, bis oben abgefüllt mit Koks. Die wie er in Cinecittà aufgewachsen waren. Zur Zeit der Neapolitaner hatten sie Kindern Speed verkauft. Dann hatten sie sich den Anacleti angeschlossen, der Zigeunerdynastie, die so alt war wie das Kolosseum und durch deren Hände jedes einzelne Gramm Shit und Koks ging, das zwischen Tor Bella Monaca und Piazza Tuscolo verkauft wurde. Zwischen Casilino, Cinecittà und Appia. Stinkreiche Leute, die nichts Zigeunerhaftes mehr an sich hatten, außer ihre Traditionen, ein paar alberne Bräuche, übertriebene Hochzeitsfeiern, die Gier und einen Haufen Kinder, Cousins und Enkel, die alle denselben Namen trugen.
Rocco Anacleti. Der Boss von Paja und Fieno. Max’ Boss.
Zumindest glaubte er das.
Paja streckte einen Arm aus dem offenen Fenster des BMW und winkte Max. Sein Gesichtsausdruck war so enthusiastisch, als stünde ihm eine Zahnbehandlung bevor.
– Ach, Nietzsche, du hast es geschafft. Schau mal, Fieno! Der Philosoph gibt sich die Ehre.
Der Spitzname, Nietzsche, hätte ihm eigentlich schmeicheln sollen, er hätte ihn daran erinnern sollen, dass er seine Doktorarbeit über Kant nicht nur seiner Mutter zuliebe geschrieben hatte, die zu ihrem Glück nicht mehr lebte, doch er machte ihn wütend. Er erinnerte ihn daran, dass auf der Straße alle gleich waren. Wieder so ein Schwachsinn, und er musste so tun, als würde er daran glauben. Er begrüßte Paja, indem er den Kopf kurz senkte, ohne den Helm abzunehmen, dann folgte er dem BMW ein kurzes Stück über die Tuscolana bis an die Kreuzung mit der Via del Casale Ferranti.
Abbas arbeitete gern nachts. Das war das Einzige, woran er sich in den vielen Jahren in Italien nicht hatte gewöhnen können. Dass die Arbeit den Bürozeiten und den von der Kommune aufgestellten Regeln entsprechen sollte und nicht dem Rhythmus des Körpers und seiner Bedürfnisse. Er hatte den Rollladen halb offen gelassen und hantierte mit dem kleinen Stereogerät, das ihm Farideh geschenkt hatte, seine Tochter, die zu schön und zu erwachsen geworden war. Immer wenn er sie ansah, musste er an den Tod ihrer Mutter denken. Wie sie sich in der Aufbahrungshalle des Regina-Elena-Krankenhauses beim Anblick des starren Körpers der zweiten Frau in seinem Leben an ihn gedrückt hatte. An diesem Tag hatte ihm Farideh zugeflüstert, dass sie beide es schaffen würden. Und dieses Versprechen war eine Prophezeiung geworden. Farideh war sein ganzes Leben. Sein Anker, seine Wurzeln, seine Zukunft. Deshalb gab er ihr immer recht. Auch jetzt, als er die CD der Plastic Waves und der Kiosk auspackte, der dissidenten Exilrockbands aus Teheran. Er verstand die Musik nicht, aber Farideh liebte sie. Deshalb hörte er nicht, dass ein Auto und ein Motorrad näherkamen und vor dem Laden stehenblieben.
Max hob das Visier seines Helms und machte einen Schritt in Richtung Paja und Fieno, sie setzten die Sturmhauben auf. –
Also?
– Wir gehen hinein. Du bleibst draußen. Wenn was passiert, nuschelte Fieno unter der Haube, – findest du eine Lösung. Du bist ja Philosoph oder nicht?
Die beiden zogen weiche Lederhandschuhe aus den Jeans und streiften sie sorgfältig über. Bei jeder Bewegung, bei jedem Tonfall eiferten sie ihrem großen Vorbild nach. Rocco Anacleti. Sie waren als Sklaven geboren, und Sklaven würden sie ihr ganzes Leben lang bleiben. Ihm hatte Samurai beigebracht, dass ein wirklicher Mann keinen Boss hatte. Einen Meister vielleicht, aber keinen Boss.
Paja und Fieno gingen in den Laden und zogen den Rollladen fast ganz herunter. Max setzte sich mit verschränkten Armen auf die Kühlerhaube des BMW. Der beste Platz, um die Straße zu überblicken.
Plötzlich sah Abbas die beiden vor sich. Paja verpasste ihm eine rechte Gerade ins Gesicht, seine Schneidzähne brachen und sein Mund füllte sich mit Blut. Der Iraner ging zu Boden, schlug mit der Schläfe auf. Ihm wurde schwarz vor den Augen. Trotzdem sah er den zweiten Typen mit der Sturmhaube, der einen öligen Fetzen aus der Tasche seiner Leinenjacke zog. Als er spürte, wie sie ihm ihn in den Mund steckten, dachte er, dass nun alles aus war, und versuchte, sich so gut wie möglich zu wehren.
Umsonst.
Paja zog ihn an eine Wand des Ladens und band ihn mit einem Hanfstrick an einem frei liegenden Rohr fest. Erst jetzt, als er mit ausgebreiteten Armen auf dem Rücken lag wie der Gekreuzigte, zu dem die Römer beteten, begriff er.
Paja ging zur Stereoanlage und drehte lauter. Und während Autonomy von Plastic Wave den Laden in eine akustische Halluzination verwandelte, beugte sich Fieno über Abbas. Die Gesichter der beiden berührten sich beinahe, und der Alte spürte durch die Sturmhaube hindurch den Gestank nach Nikotin und Schweiß seines Peinigers.
– Du Scheißiraner willst also tausend Euro, ha? Warum, gehören sie etwa dir? Du bist bloß ein Kaffer. Und Kaffer werden nicht bezahlt. Klar?
Abbas Pupillen weiteten sich, während sich sein Hals anspannte, in dem verzweifelten Versuch zu nicken.
– Was? Hast du verstanden? Nein, du hast nicht verstanden. Du hast Geld verlangt, du Scheißmarokkaner. Du hast einen Brief geschickt. Du hast dich an die Scheißlinken, die Kommunisten gewandt … Aber du hast einen Fehler begangen. Sag, dass du einen Fehler begangen hast! Wie? Ich kann nichts hören. Sprich lauter, Trottel, ich höre nichts!
Wie lange brauchten die beiden?
Max hörte, dass die Musik immer lauter wurde, und konnte sich nicht länger zurückhalten. Zum Teufel mit Rocco Anacleti. Er stand auf und schlüpfte in den Laden.
Paja hielt eine Holztafel in der Linken. In der Rechten hielt er einen Holzhammer, den er aus einer Werkzeuglade gefischt hatte. Er forderte Fieno mit einer Geste auf, sich auf Abbas zu setzen, damit dessen Beine aufhörten, unwillkürlich zu zucken. Dann kauerte auch er sich neben den Alten.
– Also sag mir, Scheißiraner, wo sollen wir anfangen? Rechts oder links? Mit welcher Hand arbeitest du lieber an deinen Scheißbrettern? Mit welcher Hand treibst du Geld ein? Ich habe nicht verstanden. Du sagst, es ist egal? Egal? Dann fangen wir mit der Rechten an, damit die Linke zu was nütze ist.
Max stürzte sich auf Fieno.
– Lasst ihn in Ruhe. Das ist nur ein alter Mann!
Fieno fiel um, er war nicht auf den heftigen Angriff gefasst gewesen. Aber er stand sofort wieder auf. Er zog das Schießeisen heraus, das er im Rücken eingesteckt hatte und richtete es auf Max’ Stirn. Genau zwischen die Augen.
– Das ist eine 38er, du Trottel. Noch ein Wort und ich blas dir das Hirn weg.
Max ging mit erhobenen Armen zum Rollladen. Fieno wandte sich an Paja.
– Die Schwuchtel soll sich das Schauspiel bis zum Schluss ansehen.
Paja klemmte das Holzbrett zwischen die Handfläche Abbas’, der wimmerte wie ein Tier, und das Rohr, an das sein Handgelenk gebunden war. Er hob den Hammer über die Schulter und schlug damit ein – zwei- drei-, fünfmal auf die langen Finger des Handwerkers, auf die Knöchel, auf die Nägel. Bis seine Hand eine violette Masse geschwollenen Fleischs war.
Abbas wurde ohnmächtig.
Paja drehte sich zu Fieno um, der noch immer die Pistole auf die Stirn zwischen Max’ Augen hielt.
– Sind wir fertig?
– Ich habe gesagt, das ganze Schauspiel.
– Aber der Iraner ist hinüber. Er sieht nichts mehr.
– Er kommt wieder zu sich. Es kommt darauf an, was er beim Aufwachen sieht.
– Ist gut.
Paja ging mit dem blutbeschmierten Hammer auf die andere Seite des Ladens, zeichnete damit den Entwurf einer Intarsie auf eine Platte aus Ebenholz. Dann kramte er wieder in der Werkzeuglade des Iraners.
– Was hältst du davon?
Fieno nickte.
– Mach die Musik aus, er schreit sowieso nicht mehr.
Paja ließ die Zange mehrere Male auf- und zuschnappen, als wolle er ihren Biss prüfen. Er packte Abbas rechte Hand und führte sein Werk fort, mit dem Rücken zu Max und Fieno.
– Der geht mit seinen Händen nicht mal mehr pissen.
Sie nahmen die Sturmhauben ab und verließen schweißüberströmt den Laden. Fieno steckte die Waffe wieder im Rücken ein und richtete den Zeigefinger auf Max.
– Mit dir beschäftigen wir uns später.
Max hörte, wie der BMW langsam wegfuhr und ging zu Abbas’ Körper. Er lockerte die Hanfschlinge, mit der er an das Rohr gefesselt war, befreite die Handgelenke und legte die Arme des Alten neben seinen Körper.
Sogar für einen wie ihn war das zu viel.
Vor langer Zeit hatte er sich für die Straße entschieden. Beziehungsweise die Straße hatte sich für ihn entschieden.
Aber das war nicht die Straße. So konnte die Straße nicht sein.
Er hob den Kopf des Alten vom Boden. Und dann den Oberkörper, langsam, lehnte ihn an die Wand. Er entfernte den Knebel aus seinem Mund, damit er nicht an Schleim und Blut erstickte. Erst jetzt erkannte er die Schönheit und Würde seiner vom Schmerz verzerrten Gesichtszüge. Die dunkle, von tiefen Furchen durchzogene Haut, die eingefallenen, von einem mühevollen Leben gezeichneten Wangen, die von einem zarten weißen Bart überzogen waren.
Der Alte tat ihm leid. Er hätte es nie zugegeben, aber er tat auch sich selbst leid.
Schnell lief er hinaus zu seinem Motorrad. Gerade noch rechtzeitig, um einem weißen Matiz zu begegnen, der mit der Schnauze voran vor dem Laden stehen blieb, der Rollladen war nun wieder hochgezogen. Er fuhr langsamer und blieb in einer Entfernung von ungefähr hundert Metern stehen, um zu sehen, wer es war.
Ein Mädchen. Sie unterhielt sich am Handy. Lachte.
– Ja, Alice, ich besuche gerade meinen Vater. Ja, ja, er arbeitet auch nachts. Einverstanden, ich sage es ihm … sicher.
Max beobachtete sie und hielt den Atem an. Sie war außergewöhnlich schön. Üppiger Mund, Rehaugen und lange, glänzende schwarze Haare, die ihr über den Rücken fielen. Ein Traum.
– Ist gut, Alice, ich muss mich jetzt verabschieden. Ich gehe zu Papa.
Es war Zeit abzuhauen. Im ersten Gang beschleunigte er auf neunzig. Gerade noch rechtzeitig, um nicht zu sehen, wie sie den Laden betrat. Um sie nicht schreien zu hören, als sie sah, was man ihrem Vater angetan hatte. Um auf die Tuscolana zu gelangen und über jede rote Ampel bis zum Arco di Travertino zu fahren, wo er anhielt, nicht weit entfernt von zwei Transen, die rauchend auf einem Mäuerchen der IP-Tankstelle hockten.
– Ciao, mein Schöner!
– Nicht jetzt!
Er nahm den Helm ab und stellte das Motorrad auf die Gabel. Er kramte in der Tasche seiner Leinen-Belstaff-Jacke und holte das Handy heraus. Das, mit dem er nur eine einzige Person anrufen und von dieser angerufen werden konnte.
Samurai antwortete beim zweiten Klingeln, obwohl es fast ein Uhr nachts war.
– Was ist los?
– Ich habe ein Problem. Vielleicht hast du auch eines. Ich muss dich sehen.
– Gleich?
– Ja.
– Ist gut. Am Corso Francia. In zwanzig Minuten.
Max steckte das Handy wieder in die Tasche und ging auf eine Giulietta zu, die mit ausgemachten Scheinwerfern auf dem Platz vor der Tankstelle stand.
Er kannte das Auto. Es gehörte dem Carabinieri-Maresciallo Carmine Terenzi. Er näherte sich dem Fahrersitz, gerade noch rechtzeitig, um eine behaarte dickliche Hand mit Ehering zu sehen, die in den blondierten Haaren einer Nutte wühlte. Ihr Kopf bewegte sich auf und ab wie der eines Roboters, und das Schwein saß, den Kopf an die Nackenstütze gelehnt, und leckte sich mit der Zunge über die Lippen.
Max machte noch einen Zug von seiner Marlboro und dämpfte sie an der Tür der Giulietta aus. Terenzi grinste ihm durch das Fenster zu, während er kam.
Max drehte sich um.
Ein korrupter Bulle. Auch das war mittlerweile die Straße.
Samurai war wie immer äußerst pünktlich.
– Darf ich erfahren, was so wichtig ist, dass ich meine Meditation unterbrechen musste, Max?
– Die Anacleti, Meister.
Max erzählte die Geschichte, ohne Atem zu schöpfen. Samurai hörte ihm ungerührt zu. Der Junge war aufgewühlt. Samurai konnte den sauren Geruch der Wut spüren. Und einen süßlichen Hauch von Mitleid, der ihm nicht gefiel.
– Rauch eine Zigarette, befahl er ihm schließlich, – ich muss nachdenken. Und stell dich gegen den Wind, du weißt, ich hasse Zigarettenrauch.
Max ging ein paar Schritte weg. Samurai beobachtete den nächtlichen Verkehr auf dem Corso di Francia. Das hektische Auf und Ab, das sinnlose Treiben der Menschen.
Samurai war zweiundfünfzig Jahre alt, groß, hatte kurzgeschorene graue Haare. Er war immer mit nüchterner Eleganz gekleidet, Schwarz war seine Lieblingsfarbe. Unter den Kiton-Sakkos trug er gern Stretch-Shirts, unter denen das Spiel seiner Muskeln zu sehen war, die nicht im Fitnessstudio antrainiert waren. Er kokste nicht, er rauchte nicht, nur hin und wieder bei seltenen Gelegenheiten gönnte er sich einen kleinen Single-Malt-Whisky.
Samurai war kein Sklave, von nichts und niemandem.
Samurai ließ sich von nichts und niemandem beherrschen.
Er beherrschte alles. Er war der Boss.
Er war mit dem Mythos der nationalen faschistischen Revolution aufgewachsen, erste Erfahrungen hatte er gesammelt, als er die Roten im Gymnasium verprügelte, dann hatte er Raubüberfälle begangen, um seine Bande zu finanzieren, hatte vom Staatsstreich, dem Putsch, der Ausrottung der Juden und Kommunisten geträumt. Eines Tages starb sein bester Freund bei einer Schießerei mit der Polizei. Er selbst kam wie durch ein Wunder davon. Die Bullen wussten, wer er war. Ein Verräter hatte gesungen. Das erfuhr Samurai zufällig von einem Kameraden, der dasselbe Fitnessstudio wie die Spezialeinheiten der Polizei besuchte.
Er bereitete sich darauf vor, in Würde zu sterben.
Aber die Tage vergingen. Und niemand suchte ihn. Er überlegte, ob er sich stellen sollte. Das Warten machte ihn fertig. Schließlich tauchte jemand bei ihm auf. Ein Offizier des Geheimdienstes. Er schlug ihm ein Abkommen vor. Ein paar schmutzige Jobs im Tausch gegen Protektion. Samurai sagte zu ihm, er solle scheißen gehen.
Aber natürlich kamen sie wieder. Diesmal waren es viele. Sie waren bewaffnet und stinksauer. Sie hatten vor, ihn in einen Schusswechsel zu verwickeln und ihn kalt zu machen. Die beste Lösung für alle. Das unanständige Abkommen, das man ihm vorgeschlagen hatte, würde mit ihm zu Grabe getragen werden.
Samurai hob die Arme und ließ sich mit einem spöttischen Lächeln festnehmen.
Beim Prozess schwieg er eisern. Er bekam fünf Jahre. Im Gefängnis las er Pound, Céline und Der Untergang des Abendlandes von Oswald Spengler, er trainierte, um nicht vor Langeweile zu sterben. Man hielt ihn für einen Harten, einen unbelehrbaren politischen Häftling, und ließ ihn in Ruhe. Er grüßte alle und verfeindete sich mit niemandem. Weil er ein Musterhäftling war, sollte er sechs Monate früher entlassen werden.
Aber Politik hatte nichts mit guter Führung zu tun. Zumindest nicht mehr. Samurai war enttäuscht. Im Gefängnis war er zur Promiskuität gezwungen gewesen. Er hatte die Menschen kennengelernt, wie sie wirklich waren. Es gab keine Hoffnung. Unmöglich, die Schläfrigen und Bewusstlosen aufzuwecken.
Offenbar wollte die Gesellschaft, die er verändern wollte, gar nicht verändert werden. Offenbar hatte er den falschen Weg eingeschlagen.
Am Höhepunkt des Nachdenkens beschloss er, sich auf dieselbe Weise umzubringen wie der Schriftsteller Yukio Mishima.
Er wollte eine Woche vor seiner Entlassung zur Tat schreiten. So, dass der Sinn seiner Geste für alle zu erkennen war: Ekel vor der modernen Welt, Aufbegehren gegen die Mittelmäßigkeit der Massen, Verachtung für die Elenden und Schwachen. Lieber ein heroischer Tod als ein Sklavendasein.
Ein paar Tage vor dem festgelegten Termin verlegte man ihn plötzlich in eine andere Zelle. Sein neuer Zellengenosse stellte sich als Dandi vor. Auch er stand kurz vor der Entlassung, ein großer Junge mit spöttischem Lächeln und angenehmen Umgangsformen, er rühmte sich, die mächtigste und unbesiegbarste Bande Roms gegründet zu haben. Aber nicht im Alleingang, fügte er hinzu, sondern „mit ein paar Freunden, die du kennenlernen solltest“.
– Meine Zeit ist abgelaufen, Dandi.
– Tatsächlich. Entschuldige, aber wie alt bist du? Fünfundzwanzig? Und du redest wie mein Großvater?
– Das Alter ist unwichtig, es zählt nur das, was man in sich fühlt.
– Dann erklär mir, was fühlst du in dir?
Der Typ war sympathisch und schien vertrauenserweckend. Samurai beschloss, sich ihm anzuvertrauen. Die Einsamkeit brachte ihn allmählich um. Er erzählte ihm alles. Er brauchte nicht lange. Er zitierte gerade Julius Evolas Erhebung wider die moderne Welt, doch da unterbrach ihn Dandi.
– Schon gut, alles klar, du willst dich also umbringen, weil die Scheißwelt dich nicht verdient.
Samurai nickte: eine etwas vereinfachende, aber treffende Zusammenfassung.
– Weißt du, wie du mir vorkommst? Wie einer dieser Japaner aus einem Film … die mit dem krummen Schwert, die immer einem Feind den Schädel einschlagen wollen, wegen der Ehre … wie heißen sie doch gleich, komm, hilf mir …
– Samurai.
– Genau, sehr gut. Das bist du. Ein Scheißsamurai. Entschuldige, wenn ich dir das so sage, aber da du dich ja umbringen willst, kann ich ja offen reden … ich glaube, du hast nicht begriffen, wie der Hase läuft.
– Und wer erklärt es mir, du?
– Schau, mein Lieber, du kannst ja tun, was du willst. Aber sag mir eines: Glaubst du, es schert jemanden, wenn du dich umbringst? Entschuldige, aber du warst ihnen egal, als du Raubüberfälle gemacht hast, um die Politik zu finanzieren, und du glaubst, als Leiche machst du ihnen mehr Angst? Und jetzt mach das Licht aus, ich brauche acht Stunden Schlaf, sonst habe ich morgen Ringe unter den Augen, und Ringe unter den Augen finde ich wirklich unerträglich.
Samurai versuchte sich nicht allzu sehr davon beeindrucken zu lassen, aber die Worte des Vorstadtwichsers hatten ihm einen Floh ins Ohr gesetzt. Er ließ ein paar Tage verstreichen, dann kam er wieder darauf zu sprechen.
– Was also sollte ich deiner Meinung nach tun?
– Du kränkst dich, weil du glaubst, die Welt hat dich beschissen. Zahl es ihr doch mit gleicher Münze heim. Fick sie. Fick sie alle. Du wirst sehen, danach fühlst du dich besser. Wie nach einem schönen Fick, glaub mir, Samurai.
Wer weiß. Vielleicht hatte Dandi recht. Und vielleicht lag in seinen Worten mehr Wahrheit als in allen Büchern, die ihn begeistert hatten, seitdem er beschlossen hatte, den Weg zu verlassen, den ihm seine Eltern vorgegeben hatten: Studienabschluss, Übernahme der Rechtsanwaltskanzlei, die seinem Vater gehört hatte, und davor dem Großvater, dem Urgroßvater, und davor …
Vielleicht hatte Dandi auch nur gesagt, was er hören wollte.
Der Selbstmord wurde vertagt. Dandi und Samurai verließen gemeinsam das Gefängnis Regina Coeli.
Dandi stellte ihn seinen Freunden vor.
Samurai wurde in die Bande aufgenommen.
Das war mittlerweile lange her.
Dandi war tot.
Libanese war tot.
Viele andere waren tot, ein paar waren Kronzeugen geworden, ein paar saßen ihre Haftstrafe schweigend ab, träumten davon, von vorne anzufangen, unter Umständen mit einem einfachen Job.
Samurai war noch da. Der alte Kampfname war mittlerweile nur noch ein Überbleibsel verlorener Träume. Dandi hatte ihn ihm verliehen, und er hatte versucht, sich seiner würdig zu erweisen.
Aber die Macht war konkret, lebendig, real.
Samurai war die Nummer eins.
Obwohl er, wenn ihn jemand darauf ansprach, mit einem rätselhaften Lächeln zu antworten pflegte: nur primus inter pares.
Auf diese Weise kränkte er niemanden und die Geschäfte florierten. Das alles hatte er seiner Intuition zu verdanken. Es hatte mit den Jungs aus dem Bagatto begonnen, die Saat war aufgegangen. Das Netz umfasste mittlerweile die ganze Stadt. Die Bande waren unzerstörbar.
Allerdings hatte das erloschene, graue Rom, ein Überbleibsel aus früheren, leidenschaftlichen Zeiten, nichts Heroisches mehr. Früher hatte er die Wucherei verachtet, jetzt war sie sein täglich Brot. Und die Kontrolle über die Nacht war ein Hochseilakt, der ihn ununterbrochen zwang, Zugeständnisse an eine Masse von elenden Würmern ohne Herz, Mut und Hirn zu machen.
Aber so ist es nun mal auf der Welt, nicht wahr, Dandi?
Samurai bedeutete Max mit einer Geste, er solle zu ihm kommen.
Der Junge blickte ihn noch immer mit Augen an, die fähig waren, vor Leidenschaft zu brennen. Früher einmal war auch er … Vielleicht sah er deshalb sich selbst in Max, so wie er früher einmal gewesen war. Wenn ihm das Schicksal einen Sohn beschert hätte, dann hätte er sich einen wie Max gewünscht. Anders als die Arschlöcher aus Ostia und Roma Est. Ein geborener Boss. Noch begeisterungsfähig. Und auch fähig, sich zu irren. Wie der, der ihn vor vielen Jahren verraten hatte.
– Sag mir, dass bei dieser Geschichte mit dem Iraner kein Mitleid im Spiel ist, Max.
– Er ist nur ein armer Greis, Meister. Was hat er wohl den Anacleti getan, dass sie die beiden wilden Tiere auf ihn losgelassen haben?
– Nichts, um die Wahrheit zu sagen, sie sind im Unrecht. Sie schulden ihm Geld.
– Also …
– Also darf man bei dieser Geschichte und bei allen anderen Geschichten kein Mitleid empfinden, Nietzsche.
– Auch Achilles ließ sich von Priamus’ Tränen rühren und gab ihm Hektors Leichnam zurück.
– Der Vergleich hinkt, mein Junge. Das war kein Mitleid. Das war Respekt vor einem tapferen Feind. Kriegsrecht. Danach sind die Griechen ja ins Königreich eingedrungen und haben die Trojaner niedergemetzelt. Oder hast du das vergessen?
Der Junge senkte den Kopf.
Samurai sprach weiter in zuckersüßem Tonfall.
– Wir mögen die Anacleti nicht, aber wir brauchen sie. Wir müssen ihnen eine gewisse Dosis an Brutalität zugestehen. Das hilft, sie unter Kontrolle zu halten. Dennoch gebe ich dir recht. Paja und Fieno, die beiden Hirnamöben, haben übertrieben. Sei ruhig. Ich kümmere mich darum.
Samurai ahnte, dass Max die Erklärung nicht zufriedenstellte. Auch recht, er würde schon noch verstehen. Bevor er sich von ihm verabschiedete, gab er ihm einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter.
– Ich habe Großes mit dir vor, Max. In den nächsten Tagen werden wichtige Dinge geschehen, und ich will, dass du an meiner Seite bist. Aber lass das Mitleid zu Hause. Glaub mir, in dieser Welt ist es zu nichts zu gebrauchen.
IX.
– Hallo, Spartaco?
– Wer spricht?
– Ich bins, Pippo …
– Ach, Pippo … sag mir: Kennen wir uns?
– Natürlich. Ich bin Pippo aus Borgata Fidene. Erinnerst du dich nicht? Wir haben uns bei der Eröffnung der Bar in Trigoria kennengelernt, kurz vor Ostern. Pippo, der Lange, ich habe den Jungen mit dem Shirt des Kapitäns mitgebracht und du hast es signiert, „Spartaco, Herz von Rom …“
– Weißt du, was ich dir sage, Pippo?
– Was?
– Tut mir leid. Ich hab’s vergessen … ist ja schon eine Ewigkeit her …
– Was redest du, Spartaco, du bist nicht alt, du bist unsterblich …
– Oder es liegt an der Hitze, die bringt einen ja um …
– Sie ist unerträglich, Spartaco, unerträglich!
– Oder es liegt an den Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, ich versichere dir, heute Morgen gehen mir jede Menge Gedanken durch den Kopf.
– Macht nichts, Spartaco, du bist nach wie vor der Beste.
– Ja, das sagt sich so leicht, macht nichts … Also, Pippo, was wolltest du uns erzählen?
– Ich hab die Nachrichten über den neuen Trainer gehört … diesen Jungen. Wen hat er trainiert? Wen hat er besiegt?
– Niemanden, Pippo. Roma engagiert immer Versager.
– Gab es nichts Besseres auf dem Markt? Angeblich wollen sie Roma groß herausbringen, aber mir kommt vor …
– Haben alle ein großes Maul, die Amerikaner, die Russen, die Araber … Ach, wir haben hier schon viel erlebt … Ja? Einen Augenblick, Pippo.
– Wie du willst, Spa’.
– Wie?
– Wie du willst, Spa’.
– Nein, ich spreche mit der Regie … Ach ja, sicher, warum nicht, die Sponsoren … ihr hättet euch ein wenig früher melden können, was? Ja, wir arbeiten hier alle, das könnt ihr mir glauben … Los, Tempo, Jungs, los … Pippo? Bist du noch da, Pippo?
– Glaubst du etwa, ich haue ab, wo ich dich endlich am Telefon habe?
– Sehr gut, Pippo. Wir brauchen Leute wie dich. Mit großem Herz. Hör zu, Pippo, darf ich dich was fragen?
– Mich? Natürlich, Spa’.
– Was hältst du von Sicherheit, Pippo?
– Soll das ein Scherz sein? Wenn du einem Mann die Sicherheit nimmst, nimmst du ihm alles.
– Natürlich. Also müsst ihr alle, denen die Sicherheit am Herzen liegt, ihr alle, wenn ihr zur Arbeit geht und eure Frau, eure Mutter, eure Schwester, eure Tochter allein zu Hause lässt … ihr alle, die ihr nicht Angst haben wollt, dass plötzlich ein Zigeuner bei euch einbricht, nur so als Beispiel, denn wir von Radio Fm 922 sind keine Rassisten, aber es ist nun mal eine Tatsache, dass es letzten Endes immer sie sind, wenn es einen Einbruch, einen Raubüberfall gibt, da kann man die Sache drehen und wenden, wie man will … Mit einem Wort, wenn ihr in Frieden leben wollt, MÜSST ihr, und das ist kein Scherz, Jungs, MÜSST ihr zumindest mal einen Sprung zu Rubinacci Sicherheits- und Panzertüren machen, Via di Tor Marancia, Nr. 77, ich wiederhole 77b, wo ihr die Antwort auf alle eure …
Alba Bruni kam herein, ohne anzuklopfen. Oder vielleicht hatte sie angeklopft, aber Marco Malatesta hatte es nicht bemerkt, weil er sich ganz auf den Sender konzentrierte, wo gerade der Roma-Fan zu hören war. Durch die Glasfenster der Abteilung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität im zweiten Stock eines … sogenannten funktionalen … Gebäudes hatte man eine atemberaubende Aussicht auf den Ponte Salario. Der antike Crescenzi-Turm, der letzte Wächter einer gloriosen Vergangenheit vergessener Leidenschaften, war kaum zu sehen hinter einer Mauer … funktionaler? … Gebäude, die die antike Vorstadt zu einem unheimlich modernen Stadtteil machten. Eigentlich ein schönes Symbol, dachte Marco Malatesta, unseres Zustands als Staatsdiener: Wir werden erdrückt von den widerlichen Dingen, die zum Großteil von denen geschaffen wurden, denen wir dienen sollten.
– Die Spurensicherung hat einen Coup gelandet.
– Hallelujah!
Er nahm das druckfrische Papier, das Alba ihm reichte, zögerte einen Augenblick zu lange, als ihre Fingerspitzen sich berührten. Alba, Alba …
– Fast hundertprozentige Übereinstimmung.
– Der Smart hat sie auf die Idee gebracht. Sie gleichen noch die DNS mit der seiner Mutter ab, aber sie sind sich ziemlich sicher.
– Wie sicher?
– Du kennst ja die Spurensicherung. Hin und wieder gehen sie einem auf die Nerven, aber insgesamt sind sie ziemlich zuverlässig. Sagen wir, sie haben sich selbst übertroffen. Die verkohlte Leiche in Coccia di Morto ist Marco Summa.
Sie kontrollierten am Bildschirm. Alba duftete nach Apfel, ein zarter, überhaupt nicht aufdringlicher Duft. Wie zum Teufel machten das die Frauen? Ein glühend heißer Sommer stand bevor, die Klimaanlage fiel jeden zweiten Tag aus, und sie und alle anderen sahen aus, als kämen sie gerade aus dem Beauty Center.
– Chef, konzentrieren wir uns bitte auf die Arbeit.
– Entschuldige. Schauen wir mal …
Marco Summa war wegen Drogenhandels vorbestraft und hatte eine Anzeige wegen Kuppelei, die allerdings später fallengelassen worden war. Auf dem Bildschirm tauchte ein ziemlich neues Fahndungsfoto auf. Provokante Pose, ein Blick, der düster, wenn nicht gar bedrohlich wirken wollte, jedoch nur tot war. Der Colonello und die Capitana hatten schon Hunderte solcher Gesichter gesehen, auf der Straße, in den Sicherheitszellen, auf der Anklagebank bei Prozessen, bei Verhören im Gefängnis. Jungs ohne Herz und mit ganz wenig Hirn. Schlachtvieh der Kleinkriminalität. Vielleicht hatte die kleine Maus Marco Summa, der, wie auf der Karteikarte stand, Spadino genannt wurde, versucht, eine Stufe höher zu klettern, und war dabei an eine gemeine und hungrige Ratte geraten.
– Außerdem, fügte Alba hinzu, ist er seit einigen Tagen als vermisst gemeldet.
Gut, damit war alles klar. Doch während sie Spadinos Akte durchgingen – Festnahmen, Haftprotokolle, Anzeigen –, sagte ihm sein Gespür, dass es sich dabei nicht nur um eine normale Verwaltungsangelegenheit, sondern um etwas Brisantes, um etwas Ernstes handelte.
– Er ist außerhalb seiner Zone gestorben, Alba.
– Genau. Hier steht, er ist zweimal in Cinecittà verhaftet worden.
– Und in Ostia ist er verbrannt worden … das klingt nach Grenzüberschreitung. Wenn einer wie Spadino die Grenze überschreitet, wird vielleicht ein anderer wütend.
– Mhhh … Da ist noch was. Ich habe ein wenig recherchiert. Auf der Polizeiwache Cinecittà ist was vorgefallen. Allein im letzten Jahr sind zwei Kollegen wegen Unwürdigkeit versetzt worden, ein Obergefreiter und ein Brigadiere. Zwei Kilo Kokain und zwanzig Kilo – ich wiederhole – zwanzig Kilo Haschisch sind verschwunden. Das ganze Personal wurde ausgewechselt.
– Und wer hat jetzt das Kommando?
– Ein gewisser Terenzi. Vielleicht sollten wir ihn vorladen.
– Wir gehen hin. Sofort, beschloss Marco.
– Ich brauche noch eine Stunde, sagte sie, ich muss einen Bericht über diesen Spadino vorbereiten.
Als er wieder allein war, hörte Marco wieder Radio Fm 922. Spartaco Liberati predigte noch immer. Am anderen Ende des Telefons war ein neuer Gesprächspartner, ein gewisser Gino aus Ostia.
– Du hast recht, Gino. Rom ist nicht so, wie die Klugscheißer in den Zeitungen, die Journalisten, schreiben … Leute, die Rom gar nicht kennen, die gar nicht wissen, was die Straße ist.
– Du hast recht, Spa’.
– Nimm zum Beispiel diese Geschichte mit dem Toten in Ostia. Jetzt sagen sie, Rom ist wie Chicago von Al Capone. Eine Stadt voll von Verbrechern, eine Stadt ohne Sicherheit … weißt du, wer die sind, Gino?
– Immer dieselben, Spa’.
– Natürlich! Die Roten, die Kommunisten, sie können sich nicht damit abfinden, dass sie nicht mehr in der Kommune sitzen, und jetzt spielen sie sich als Hüter der Sicherheit auf! Die Herren sollten mal daran denken, dass sie die Stadt den Zigeunern und den Kaffern überlassen haben! Weißt du, was ich dir sage, Gi’? Vielleicht hat der Typ in Ostia eine Zigarette geraucht und ist eingeschlafen. Oder es war doch Mord … aber man kann doch nicht alles kontrollieren, oder? Man weiß ja, wie es funktioniert.
– Spa’, du bist der Größte.
Ach, das Fan-Radio war ja so was von entspannend, dachte Marco Malatesta lächelnd.
Aber auch so was von nützlich. Das hatte er Alba verschwiegen, denn abgesehen von General Thierry wusste niemand über seine Vergangenheit Bescheid. Die Fan-Radios sind das Thermometer der Fankurve im Stadion. Und die Fankurve ist das Thermometer der Straße. Das Megaphon derer, die von den wichtigen Kommunikationssystemen ausgeschlossen sind, beziehungsweise vom Kommunikationssystem derer, die glauben, wichtig zu sein. Die Fan-Radios sind die Stimme einer schweigenden Masse, die auf einer eigenen Frequenz surft. Einer Frequenz, die sich mit normalen Methoden nicht analysieren lässt. Zum Beispiel: dass Spartaco Liberati über den Toten in Ostia spricht, sollte dir zu denken geben, Colonello. Das war nicht nur der Spielerpass eines alten Kameraden an die rechte Mehrheit. Es bedeutete, dass eine Sorge, wenn nicht gar eine Unruhe im Keim erstickt werden sollte. Es war eine Rede an einen „Schuldigen“, im Auftrag von jemandem, der schon immer diesen Sender hörte. Er und Alba hatten nun die Aufgabe, herauszufinden, wer das war und warum er das wollte.
Eine Kettenreaktion lief ab, ausgelöst von Spadinos verkohlter Leiche.
Marco stellte gerade Terenzis Personalakte zusammen, als Alba bei der Tür hereinkam. Etwas früher als erwartet.
– Heute machen wir nichts mehr, Marco.
Terenzi hatte sich einen Tag Urlaub genommen. Die Mission wurde auf den Tag darauf verschoben.
– Ich nütze die Gelegenheit und statte einem alten Freund einen Besuch ab, sagte Marco.
Genau in diesem Augenblick erhielt Rocco Anacleti einen Anruf.
Der Tote im Pinienhain war identifiziert worden. Es handelte sich ganz eindeutig um Spadino.
Der Zigeuner stimmte leise „Camminando, camminando su lunghe strade …“ an. Dschelem, Dschelem, die traurige Hymne, die von der Vernichtung seines Volkes durch die Schwarze Legion erzählte.
Spadino war nicht als Rom geboren, aber er war so sehr ein Rom geworden, wie ein Gadsche nur konnte. Und er war krepiert wie ein Hund, massakriert, verbrannt. Es würde lange dauern, bis seine Seele im Jenseits die Teile seines geschändeten Körpers zusammengefügt hatte.
Es war nur ein kurzer Moment der Rührung. Dann erwachte Rachedurst, spontan und unbezähmbar.
Spadino war, verdammt noch mal, einer seiner Männer gewesen.
Rocco Anacleti schrieb ein SMS.
Numero Otto wurde vom Klingelton seines Handys geweckt. Faccetta nera. Er schob Morgana weg, die quer über seinem behaarten Oberkörper lag, und las:
„Bereite das Begräbnis vor: deines.“
Unterschrift war keine vonnöten. Rocco Anacleti hatte an die Tür geklopft.
Numero Otto hatte zwei Gedanken hintereinander:
Tja, früher oder später musste es wohl so kommen.
Da habe ich wohl ein schönes Durcheinander angerichtet.
Dann schloss er erschöpft wieder die Augen. Das Koks begann zu wirken. Endlich begriff er.
Die Uoterfront.
Ostia lag im Licht des Sonnenuntergangs da, ein zauberhafter Anblick. Und die Silhouette des riesigen, vierstöckigen Casinos direkt am Meer erinnerte an diesen Berg in Brasilien, wie hieß er doch gleich? … ach ja, der Zuckerhut.
Guter Gott, wie schön das Casino doch war.
Und was für einen schönen Namen man ihm gegeben hatte.
Armageddon.
Das bedeutete so viel wie … Weltuntergang oder so was Ähnliches. Auf jeden Fall was Kraftvolles. Sogar eine Skipiste mit Kunstschnee hatte man errichtet. Mit einer Seilbahn, die vom Pinienhain direkt zum Gipfel führte.
Numero Otto betrachtete das Schauspiel von oben. Er sah Piazza Gasparri und die Uferpromenade: ein einziger Glas- und Betonblock. Ein Parkhaus über dem Wasser, bei dessen Anblick man glaubte, in Dubai zu sein. Es hieß ja: Ohne Scheißpalmen ging es einem schlechter. Ja.
Die Uoterfront.
Ein Wunder.
Numero Otto drehte sich auf dem Sitz des Sessellifts um und warf einen Blick nach unten. Via Ostiense durchschnitt eine Betonfläche, die sich Richtung Rom erstreckte, so weit das Auge reichte. Erhellt von den Lichtern der Einkaufszentren, der Wohnblöcke, der Sozial- und Luxusbauten. Parco Raffaello. Parco Michelangelo. Parco Leonardo. Parco Donatello. Wie Ninjaturtles. Den Ameisenhaufen, in denen der Quadratmeter siebentausend Euro kostete, hätte man allerdings modernere Namen geben können. Keine Ahnung, so was Ähnliches wie Parco Off-Shore, irgendetwas Angemessenes.
Zio Nino erwartete ihn am Ausstieg des Sessellifts, auf einem rosa Spannteppich mit hohem Flor.
Wie elegant Zio doch war. Ganz in beige. Eine Fotze in rotem Latexkleid scharwenzelte um ihn herum.
– Hast du gesehen, Zi’, was dein Cesare auf die Beine gestellt hat?
Sie umarmten sich und betraten ein Holzchalet auf dem Dach des Casinos, das von Fichten und Dolmen umgeben war. Hier fühlte man sich wirklich wie mitten in den Alpen.
Der Blick auf die Ebene war spektakulär.
Zwanzig Millionen Kubikmeter Beton. Abänderung des Flächenbebauungsplans hatten sie es genannt. Abänderung wovon? Das hier war keine Abänderung, das hier war eine Tatsache. Nuova Ostia für die Neue Welt. Ihre Welt.
Sie wussten gar nicht, wofür sie das Geld ausgeben sollten, so viel hatten sie aufgestellt. Sie hatten die Investitionen verdoppelt. Einige Hundert Millionen nur für die Adami. Und er hatte sich eine Yacht gekauft, so eine wie der Russe, dem Chelsea gehörte: Abramovic. Mit einem Hubschrauber an Deck. Roma, hatte er das Schiff getauft. Wie sonst? Schwarz, aus Karbonfiber, sie ankerte im Hafen vor dem Casino. Die Araber vergingen vor Neid.
Die Mittagshitze weckte Numero Otto auf, sein Speichel lief auf das Kissen.
Das Bett war leer. Seine Schläfen hämmerten. Die Zunge klebte am Gaumen.
Er streckte die Hand nach dem Handy aus und las noch einmal die Nachricht Rocco Anacletis.
Scheiß drauf, der Zigeuner wird sich schon damit abfinden.
X.
Samurai war besessen von Riten. Das war Marco Malatesta früh aufgefallen. Schon bevor er zur Polizei gegangen war. Orte, Zeitpunkte und die Art und Weise seines Auftretens in der Stadt waren Ausdruck einer Art Wiederholungszwangs, der ihm Sicherheit geben und den anderen Respekt einflößen sollte. Die Obsession hatte sich in eine Art Machtmittel verwandelt.
Ob im hellen Tageslicht oder in der Dunkelheit der Nacht: Samurai war da.
Und er, Marco, würde ihn daran erinnern, dass auch er wieder da war.
Im Übrigen war es eine günstige Gelegenheit. Wenn es Sinn machte, sich wegen Spadinos Ende ein wenig umzuhören, dann fing er wohl am besten bei Samurai an. Ob er etwas mit dem abgefackelten Auto in Coccia di Morto zu tun hatte oder nicht, war im Augenblick nebensächlich. Ungefähr zu Mittag erreichte Malatesta auf seiner Bonneville das Ende des Corso di Francia. Ungefähr hundert Meter von der letzten Tankstelle vor der Flaminia entfernt legte er sich auf die Lauer. Das Viertel hatte sich zwar verändert, zwischen dem Boulevard Fleming und dem Ponte Milvio waren kleine Lokale und Gourmetrestaurants aus dem Boden geschossen wie Pilze, beinahe hätte man vergessen können, wie das Viertel wirklich beschaffen war. Doch das Stadtviertel mit dem „schwarzen“ Herzen gehörte nach wie vor Samurai.
„Einmal am Tag kommt er vorbei. Immer an derselben Tankstelle. Wo wir als Jungs die Mopeds volltankten, bevor wir ins Stadion fuhren. Irgendjemand hat mir erzählt, er hätte sie gekauft, wie übrigens den halben Corso Francia“, hatte ihm ein Freund aus alten Zeiten zugeflüstert. Und Marco hatte keinen Grund, ihm nicht zu glauben.
Malatesta erkannte ihn sofort, trotz der Entfernung. Sobald er aus dem Smart ausstieg und ihn auf dem Platz vor der Autowaschanlage abstellte. Als er sah, wie eine kleine Schar bartloser Vorstadtwichser um ihn herumscharwenzelte, wie sie ihren Anführer respektvoll anhimmelten, lächelte er. Samurai hatte sich nicht verändert. Ein paar graue Haare. Ein maßgeschneiderter Anzug, der ihm das Aussehen eines Geschäftsmannes verleihen sollte, der er aber nicht war. Ansonsten sah er immer noch so aus, wie er ihn in jener Nacht im Bagatto kennengelernt hatte. Malatesta zündete sich eine Camel an und ging zu Fuß zu den Zapfsäulen. Unterwegs machte er ein paar Fotos mit dem iPhone. Die Anonymität gehörte zu Samurais größten Obsessionen. Die einzigen Fotos, die es von ihm gab, waren fünfundzwanzig Jahre alt. Unter Umständen war es hilfreich, ein aktuelles zu haben.
– Guten Tag.
Obwohl Marco von hinten kam, schien ihn seine Stentorstimme nicht zu verwundern. Samurai drehte sich langsam um, ohne mit der Wimper zu zucken, mit einer ausladenden Armbewegung zerstreute er die Sorge der Jungs, die um ihn herumtanzten.
Marco beschloss, ihm keine Zeit zu lassen. Aus Erfahrung wusste er, dass man Samurai diesen Vorteil nicht geben durfte. Nie.
– Können wir unter vier Augen sprechen, oder brauchst du immer eine Bühne für den großen Auftritt?
Samurai lächelte wie eine Schlange und entließ seinen Hofstaat.
– Ich habe dich zwar als ungestüm, aber mit guten Manieren in Erinnerung. Und mit Verlaub, auch mit ein paar Kilo weniger. Aber vielleicht waren die Zeit und dein neuer Beruf ein schlechter Lehrmeister. Colonello, nicht wahr?
– Tenente Colonello. Schlechte Lehrmeister hatte ich übrigens nur einen. Du kennst ihn ja.
– Ich danke dir für den Besuch, aber ich wusste bereits, dass du wieder in Rom bist. Willkommen. Was treibt dich her, Marco? Sehnsucht nach der guten alten Zeit vielleicht?
– Reine Neugier.
– Aha …
– Marco Summa. Sagt dir der Name was?
– Nein. Sollte er?
– Vielleicht kanntest du ihn als Spadino.
Samurais Lächeln verwandelte sich in eine angewiderte Grimasse. Dahinter verbargen sich Ärger und Unruhe. Gerüchte verbreiteten sich schnell in Rom. Kaum hatte ihm Rocco Anacleti mitgeteilt, was mit Spadino geschehen war, waren auch schon die Bullen da. Eine hässliche Geschichte. Bald würde es einen Flächenbrand geben.
– Tut mir leid, aber der Name sagt mir nichts.
– Na so was! Stell dir vor, sie haben ihn in Coccia di Morto gefunden. Verkohlt. Nur Zähne sind übriggeblieben.
– Guter Gott, wie schrecklich. Aber ich weiß nichts davon. Du verschwendest deine Zeit, Colonello.
Marco schenkte ihm ein herablassendes Lächeln.
– Du hast dich nicht verändert. Dasselbe Arschloch wie immer. Du dealst noch immer mit Koks und Heroin, dem ganzen Dreck, der das Hirn der Jungs zerstört. Du hast sogar Crack nach Rom gebracht.
– Du bist auf dem Holzweg, Marco.
– Blödsinn. Spadino war ein kleiner Dealer.
– Das ist nicht mein Problem. Samurai machte einen Schritt nach vor und schüttelte den Kopf. – Ich weiß nicht, wer deine Informanten sind, Colonello. Aber du solltest dir bessere suchen. Wirf einen Blick ins Handelsregister. Dort findest du meinen Namen und den meiner Firmen. Ich bin ein Geschäftsmann, verstanden? Ein Geschäftsmann. Ich habe mit dem Dealen aufgehört.
– Erzähl das wem anderen. Vielleicht den Vorstadtwichsern, die jeden Morgen vor der Zapfsäule auf dich warten.
Samurai richtete den Zeigefinger auf Malatestas Schläfe.
– Du musst deine Wut im Zaum halten, Marco. Du hast sie noch nie verbergen können. Einen Zwanzigjährigen kann man verstehen und ihm verzeihen, wie ich damals. Aber inzwischen solltest du erwachsen geworden sein. Wenn du die Fassung verlierst, schwillt deine Narbe an. Sie ist ein verlässlicher Anzeiger deiner Verwundbarkeit. Ein Vorteil, den du niemandem gewähren solltest.
Es war nicht anders zu erwarten gewesen. Samurai wühlte mit beiden Händen in dem Abgrund, der sie verband. Aber er hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Marco massierte sich die Schläfe.
– Ich habe eine schlechte Nachricht für dich, Samurai.
– Was für eine?
– Ich mag die Narbe.
– Lass mich raten. Sie macht die Damen an?
– Die Frauen haben nichts damit zu tun. Die Narbe erinnert mich bloß daran, was ich noch zu tun habe.
– Rache ist nicht immer ein edles Gefühl.
– Ich suche keine Rache, Samurai. Das Faschistengewäsch interessiert mich nicht mehr.
– Ach, mich auch nicht, das solltest du begriffen haben. Ich räche mich nicht. Ich nehme Veränderungen zur Kenntnis. Und wenn notwendig begünstige ich sie. Ich lenke das Schicksal, Marco. Ich kenne keinen Groll, weil ich dafür sorge, dass gar keiner entsteht. Das weißt du. Das war immer dein Problem, Marco. Du willst die Welt verändern. Aber die Welt verändert sich nicht. Sie will beherrscht werden.
Marco lächelte.
– Willst du was wissen, Samurai? Du bist sentimental geworden.
– Jetzt übertreib nicht.
– Als ich mir die Dummheiten angehört habe, die du im Bagatto von dir gegeben hast, hattest du einen Anschein von Menschlichkeit, oder zumindest hast du dich bemüht, einen zu haben. Jetzt bist du nur noch eine alte Schlange bei der letzten Häutung.
– Du solltest hinzufügen, dass ich immer großzügig war und noch immer bin. Dass du noch lebst, verdankst du nur mir. Ich hätte dich zertreten können wie eine Kakerlake, und habe es nicht getan. Vergiss das nicht.
– Du hättest die Sache zu Ende bringen sollen, Samurai, denn ich werde nicht großzügig sein. Ich erwidere Gefälligkeiten nicht. Ich schulde dir nichts.
Samurai seufzte.
– Mehr haben wir uns nicht zu sagen. Ich habe einen vollen Terminkalender. Ich glaube, wir können unsere angenehme Konversation jetzt beenden. Obwohl es mir ein wenig leidtut. Ich glaube nämlich, es war die letzte.
– Da irrst du dich. Du hast nicht verstanden, das ist erst der Anfang. Aber ich glaube, du hast doch verstanden, nicht wahr? Ich an deiner Stelle würde Informationen über diesen Spadino einholen. Auf bald, Samurai.
Marco drehte sich um und ging zu seiner Bonneville zurück. Samurais Stimme traf ihn wie ein Peitschenhieb.
– Darf ich dir einen Rat geben? Lass das Motorradfahren lieber bleiben. Du bist zu alt dafür, Marco. Und Rom ist eine gefährliche Stadt.
XI.
Ingenieur Laurenti traf die Entscheidung genau in dem Augenblick, in dem ihm der Direktor der Filiale Rom Prati der Cassa di Credito e Risparmio, Piazza dei Quiriti, den Folder überreichte.
– Herr Ingenieur, hier finden Sie die Antwort auf alle Ihre Fragen.
Er unterstrich die Geste mit einem süßlichen Lächeln und einem kräftigen Händedruck.
Laurenti warf ihm einen verächtlichen Blick zu, der andere nahm ihn gar nicht zur Kenntnis.
– Ist gut, sagte er und stand auf, – alles klar.
– Sie werden sehen, es gibt eine Lösung für Ihre Probleme, tröstete ihn der andere.
Der Ingenieur nickte, ließ noch einen Händedruck über sich ergehen und trat den Rückzug an.
Sein Sohn Sebastiano wartete auf ihn, steif und angespannt, wie er ihn vor zwanzig Minuten zurückgelassen hatte.
– Wie ist es gelaufen, Papa?
– Gut, gut, Junge. Alles in Ordnung, alles in Ordnung.
– Gut, Papa, dann kann ich ja gehen …
Recht so, dachte der Ingenieur. Sein Sohn hatte ja sein eigenes Leben und wollte es leben. Ich kann von Glück reden. Sebastiano ist ein sensibler Junge. Er hat begriffen, dass etwas nicht stimmte, und hat darauf bestanden, mich zu begleiten. Jetzt, wo ich ihn beruhigt habe, kann er es gar nicht erwarten, mich loszuwerden.
Aber er brachte es nicht über sich, ihn gehen zu lassen.
– Möchtest du ein Eis?, fragte er ihn plötzlich. – Wie lange haben wir zwei kein Eis mehr miteinander gegessen?
Überrascht, aber auch geschmeichelt, stimmte Sebastiano sofort zu.
Sie bogen in die Via Cola di Rienzo ein und setzten sich im Piccolo Diavolo an einen Tisch. Sie bestellten zwei große Eisbecher. Fruchteis für den Sohn, Cremeeis, so fett wie nur möglich, für den Vater. Als er sah, mit welcher Gier und Lust Sebastiano in eine Kugel Erdbeereis stach, verspürte er einen Stich ins Herz. Und leises Bedauern. Er hatte ihn barmherzig angelogen. Aber wäre es nicht aufrichtiger und loyaler gewesen, ihm die Wahrheit zu sagen?
Dann erzählte ihm Sebastiano von der Alaskareise, die er mit Chicca unternehmen würde:
– In Juneau nehmen wir ein Wasserflugzeug und fliegen übers Eis. Wenn wir Glück haben, sehen wir Eisbären auf Robbenjagd. Vielleicht verbringen wir auch ein paar Nächte in einem Zelt auf einer Insel zwischen Eisbergen. Stell dir vor, man kann dort sogar schlafen. Zuerst muss man allerdings eine Verzichtserklärung unterschreiben, immerhin erlauben sie das nicht allen.
Dem Ingenieur tat es leid, dass er es sich beinahe anders überlegt hatte. In einem kurzen Aufblitzen von Luzidität, wie es in den schwierigsten Augenblicken seines Lebens manchmal vorkam, dachte er: Sagen wir, ich schenke ihm noch ein paar Augenblicke Sorglosigkeit. Er wird sich bis zu seinem Lebensende daran erinnern, und vielleicht ist er mir dankbar dafür. Die Erinnerung an die einstige Sorglosigkeit wird ihn in den dunklen Stunden, die vor ihm liegen, begleiten. Sebastiano, der Reine, der Unschuldige. Mir hast du es zu verdanken, dass du so bist, mein Sohn. Ich habe dich die Liebe zum Abenteuer gelehrt, denn ein Mann soll immer seine Grenzen überschreiten, immer weiter gehen, bis dorthin, wo noch niemand vor ihm war. Und ich habe dich Respekt vor deinen Mitmenschen gelehrt, ich habe dich gelehrt, dass Mühe sich lohnt, dass die Mühe die Fleißigen belohnt und die Unwürdigen bestraft, dass die Mühe des Produzierens der einzige Maßstab eines Lebens ist, das es wert ist, gelebt zu werden.
Die beiden waren wirklich ein schönes Bild. Sie verströmten eine angenehme Atmosphäre von Heiterkeit und Kraft. Der Vater in Sakko und Krawatte, trotz der Hitze, fünfzig Jahre alt, doch noch immer gut in Form, hochgewachsen und vornehm, und auch der Sohn war hochgewachsen, er hatte die arrogante Haltung dessen, der gerade die Pubertät hinter sich gelassen hat. Am Grunde seines Blicks lag eine süße Unsicherheit, die mit der Zeit verschwinden würde.
Bald wirst du verstehen, mein Sohn. Und du wirst mich verfluchen. Denn ich bin dein Ruin.
Nach dem Eis gönnten sie sich noch einen Kaffee.
– Erzähl mir was, sagte der Vater plötzlich.
Instinktiv blickte der Sohn auf die alte Donald-Duck-Swatch an seinem von zartem jugendlichem Flaum bedeckten Handgelenk. Aber natürlich, wahrscheinlich hatte er eine Verabredung mit Chicca oder einem Freund, es war Zeit, an den Strand zu fahren, hatte er nicht gerade die Prüfung in Finanzmathematik mit Bestnoten bestanden? Warum sollte ich ihn zwingen, seine Zeit mit mir zu verbringen?
– Es ist Zeit, uns zu verabschieden. Ich gehe zur U-Bahn. Ich muss noch was erledigen.
Der Ingenieur bezahlte, umarmte flüchtig den Jungen und begab sich sicheren Schritts auf seine letzte Reise.
Er zögerte kurz vor dem Gebäude des Zivilgerichts auf dem Viale Giulio Cesare; es war wie gewöhnlich von einem Haufen Anwälten und Geschäftemachern belagert, die einem Haufen von Bankrotteuren, die in der Krise ihr ganzes Geld verloren hatten, falsche Hoffnungen machten. Aber es gab keine Hoffnung.
Er bereitete alles gut vor, ohne Eile. Er betrat die U-Bahnstation Lepanto, kaufte sich beim Kartenautomaten eine Fahrkarte. Er setzte sich auf eine Bank, möglichst nah beim einfahrenden Zug.
Er würde es sich nicht anders überlegen.
Er hatte dreißig Jahre lang wie ein Sklave geschuftet, er hatte eine solide Firma aus dem Boden gestampft, er hatte Häuser gebaut, in denen fröhliches Kindergeplärr und das Stöhnen der Liebespaare widerhallte, Häuser für die Ewigkeit – allerdings nicht, um einer Handvoll Arschlöcher in die Hände zu fallen.
Wenn es keine Zukunft für Luigi Laurenti gab, dann zum Teufel mit allen.
Und verzeih mir, mein Sohn, verzeih mir, dass ich dir einen Haufen Unsinn beigebracht habe. Vielleicht wirst du mich hassen. Er dachte daran, wie viele Unterschriften er von ihm verlangt hatte, als er geglaubt hatte, dass er noch einmal die Kurve kratzen würde.
Schrilles Pfeifen und heftiger Windzug kündigten an, dass der Zug einfuhr.
Ingenieur Laurenti schloss die Augen und löste sich mit einem stolzen Sprung vom Gleis.
Aber da sich das Schicksal um Stolz nicht schert, kam keiner der zahlreichen Fahrgäste der Linie A der römischen U-Bahn in den Genuss, live mitanzusehen, wie ein anständiger Mann in den Tod sprang. Ein Selbstmord ohne Zeugen, ohne Abschiedsbrief, ohne ein letztes Abschieds-SMS ist kein Selbstmord. Allenfalls kann man ihn als „Unglück“ bezeichnen, das von einem „plötzlichen Unwohlsein“ verursacht worden sei, oder, mit den Worten Don Filibertos, des alten Pfarrers der Chiesa del Redentore, dass es Gott in seinem unergründlichen Ratschluss gefallen habe, ihn zu sich zu rufen.
Sebastiano wusste Bescheid, musste jedoch eine langwierige Lobrede post mortem über sich ergehen lassen, aus der das verpönte Wort – Selbstmord – strengstens verbannt war, und dabei empfand er fast mehr Ekel als Trauer und Schuldgefühl.
Ein paar Reihen hinter ihm, mitten unter den Freunden des Opfers, die es gar nicht fassen konnten, und den Familien der Angestellten, die bange in die Zukunft blickten, saß noch jemand, der Bescheid wusste. Ein Junge, der ungefähr genauso alt war wie Sebastiano, Manfredi Scacchia, der Sohn eines der berühmtesten Kredithaie und Wucherer Roms, eines gewissen Scipione Scacchia, der gemeinsam mit seinen Kumpanen Dante Pietranera und Amedeo Cerruti ein Arschloch-Trio bildete, das in der Szene als I Tre Porcellini, die drei Schweinchen, bekannt war.
– Verdammt, das wundert mich gar nicht, dass der Ingenieur sich umgebracht hat. Er hatte ja mehr Schulden als Haare.
Der junge Manfredi hatte den Kommentar des alten Scipione mit höflicher Skepsis zur Kenntnis genommen. Er kannte die beiden Laurenti, Vater und Sohn, gut. Fünf endlos lange Jahre hatte er gemeinsam mit Sebastiano die Schulbank im renommierten staatlichen Konvikt gedrückt. Jetzt besuchten sie dieselbe Universität, Wirtschaftsfakultät, und mit demselben Gewinn. Sie waren gute Freunde. Ausgerechnet der alte Scipione hatte beschlossen, dass sein Sohn eine andere Laufbahn einschlagen sollte als er.
– Du musst dich erheben, Sohn, verstanden. Du musst dich erheben. Sei also kein Trottel, sondern tu dich mit den Bürgersöhnchen zusammen und lerne von ihnen. Wir müssen aufsteigen, hast du verstanden? Aufsteigen.
Manfredi war ein kluger und gehorsamer Sohn. Doch er glaubte nicht an die Worte seines Vaters. Der Ingenieur war ein Vorbild, ein anständiger Mensch, einer der wenigen, die es noch gab. Also, worüber sprechen wir eigentlich?
– Mein Lieber, du studierst, weil du dich erheben musst, aber in gewissen Dingen musst du auf deinen Vater hören. Horch zu, was ich dir sage. Bevor der Mann vor den Zug gesprungen ist, ist er zu einem Bankdirektor gegangen, einem Freund, um sich auszuweinen. Und mein Freund hat ihm geraten, sich an – rate mal – wen zu wenden?
– An dich?
– Sehr gut. Du siehst, wenn du dich anstrengst … Blut ist dicker als Wasser. Ich hatte schon den Finanzierungsplan bereit. Der Trottel, Gott hab ihn selig, war jedoch zu stolz. Amen.
Als Manfredi die Reihen abschritt und sich auf den Höhepunkt der bescheidenen Trauerfeier vorbereitete, darauf, dem Waisen die Hand zu drücken und ihn zu umarmen, dachte er, wenn sein Vater recht hatte, und es gab keinen Grund daran zu zweifeln, würde Sebastiano tun müssen, wozu sein Vater sich nicht imstande gefühlt hatte. Wieder ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Und als Sebastiano ihn mit aufrichtiger Zuneigung umarmte, flüsterte ihm der Sohn des Kredithais nicht nur ein brüderliches „du musst stark sein“, sondern noch einen anderen Satz zu, der aufgrund der besonderen Umstände seines wahren Sinns verloren ging: – Du kannst dich immer auf mich verlassen.
Der wahre Sinn dieses Satzes offenbarte sich Sebastiano ein paar Wochen später, in dem vergammelten Lokal des Kredithais, Stella d’Oriente, das gleich neben der Pfandleihanstalt lag. Der alte Scipione wollte es um keinen Preis aufgeben, denn das war seit sechshundert Jahren der angestammte Platz der Wucherer (was soll ich dir sagen, mein Sohn, ich bin nun mal sentimental). Man erklärte ihm, wie hoch die Schulden waren, die der verstorbene Ingenieur Laurenti hinterlassen hatte. Sebastiano hätte nur auf die Erbschaft verzichten müssen, dann wäre er davongekommen, doch sein Vater hatte ihn mit hineingezogen. Sebastiano hatte unterschrieben, er steckte mit drin. Er war der offizielle Inhaber überschuldeter Firmen. Selbstschuldner. Aufgrund einer Reihe von Unterschriften, die der junge Laurenti unter komplizierte Verträge gesetzt hatte, wurde aus dem Hoffnungsträger der römischen Finanzwelt der persönliche Sklave seines brüderlichen Freundes Manfredi.